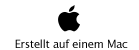Kinbote & Kaminski
Die Kritik ist sich einig in der Annahme, das Zembla-Phantasma, das in Nabokovs Roman “Fahles Feuer” zum Thema wird, sei bei aller Komik eine grandiose Umsetzung der bitteren Verlusterfahrung des Exils. Jahre zuvor bereits habe Nabokov in einem Gedicht dafür bereits die Metapher vom "verlorenen Königreich" entwickelt. Mit dieser Einordnung des Romans ist Nabokov einer von uns, hat er doch für uns eine tröstliche Botschaft parat: Einer, der alles verloren hat, kann es dennoch zu einem der größten Schriftsteller aller Zeiten bringen, ja gerade deswegen. Als verlorene ist die Heimat noch wertvoller, als sie es war, solange man sie besaß. Dergleichen setzt freilich eine besondere Charakterstatur voraus. Zu sowas sind nur wahre Eliten fähig. Als Lesende können wir partizipieren an solchen Individuen in Großformat.
Daniel Kehlmann beansprucht, mit „Ich und Kaminsky“ einen anderen Zugang zu diesem Roman eröffnet zu haben, an den tristen Gemeinplätzen vorbei, einen fröhlichen Stollen zu Nabokov gegraben zu haben, unter den Klischees hindurch, indem er mit seinem eigenen Kinbote unmißverständlich einen Narren auftreten läßt, der sich, wo immer sich eine Gelegenheit bietet, lächerlich macht und den anderen unerträglich auf die Nerven geht, wobei man sicher sein kann, daß er es selbst nicht merken wird.
Wenn Kehlmann alle Register des Komischen zieht und dabei von Nabokov gelernt haben will, wie er mal verriet, stellt sich allerdings die Frage, ob sich der Nabokov’sche Narr in seiner Lächerlichkeit erschöpft. Der Narr bei Kehlmann ist etwas, von dem wir uns leicht distanzieren können. Er ist eben nur ein lächerlicher Tölpel. Kehlmann macht es uns zu leicht, da wir uns in dem unmöglichem Betragen seines Helden nicht wiedererkennen müssen. Er liefert ihn unserem Spott aus. Zwar tut das auf den ersten Blick auch Nabokov mit seinen Helden, doch staffiert er ihn mit etwas Widerspenstigem aus, indem er seine Absonderlichkeit auf so aufwendige Weise feiert, daß er ihn sein Narrentum als Gloriole tragen läßt. Während wir uns bei Kehlmann über derartige Tölpelhaftigkeit leicht erhaben dünken können und uns unseres gesunden Menschenverstandes und unserer Normalität sicher wähnen dürfen, verfangen wir uns bei Nabokov in den Stricken, die er mit seinem Getue um seinen Narren auslegt. Es handelt sich bei diesem nicht um so etwas wie Atombomben, die es leider nun einmal gibt, was wir nicht ändern können, womit wir persönlich aber nichts zu tun haben müssen, sondern um etwas, was sich von uns, die wir es wahrnehmen, nicht wirklich trennen läßt, weil wir immer schon in das Thema verwickelt sind. Nabokovs Narr zeigt uns: Es gibt den Narren nicht ohne uns. Und uns nicht ohne ihn. Sein Narr, das sind wir alle potenziell auch selber. Nabokovs Helden sind Narren wie wir, die wie wir nicht wissen, daß wir es sind. Nabokov schildert und verteidigt den Hanswurst in uns allen. Ohne die virtuose Leichtigkeit und Spielfreude des Ausnahmeschriftstellers mit den Bleigewichten eines Schuldiskurses beschweren zu wollen, muß man doch registrieren, daß der Text eine Tiefendimension besitzt, die die Plattitüden der Psychologie untergräbt und eine Dialogizität aufscheinen läßt, die das Individuum als Element der Kömodie transzendiert. Kehlmann hat zwar recht, wenn er betont, daß das "verlorene Königreich” zugleich ein angemaßtes ist, doch verkennt er, daß bei Nabokov die Thematik eine christologische Dimension erhält und etwas besitzt, das die Kömodie mit dem Tod verknüpft.
Für diejenigen, die dieses Juwel nicht kennen, zum Inhalt des Romans: Man stelle sich vor, der frisch zugezogene Nachbar eröffne einem eines Tages, er sei in Wahrheit gar nicht der, als der er erscheint, nämlich der großgewachsene, intelligente, aber etwas aufdringlich wirkende Philologe, sondern ein König zu sein, der nach revolutionären Unruhen aus seinem landschaftlich reizvollen Reich namens Zembla fliehen mußte und es auf abenteuerlichen Wegen schließlich bis ins Nebenhaus geschafft hat, wo er nun dem Inkognito frönt. Nur einem Menschen, dem Nachbarn allein vertraut er sich an, ungefragt. Die außerordentliche Beliebtheit Carls II. erwies sich auf der Flucht; Nach der Revolution entwich er seinen Verfolgern auf abenteuerlichen Wegen über das Hochgebirge - was vor allem deshalb gelang, weil sich Hunderte von Carls Anhängern als Könige auf der Flucht ausgaben. Dank dieser den Feind verwirrenden Imitationen seiner Anhänger konnte der echte unerkannt entrinnen.
So ergeht es dem 61-jährigen Dichter John Shade im beschaulichen nordamerikanischen Universitätsstädtchen New Wye. Kürzlich ist nebenan der Literaturdozent Charles Kinbote eingezogen. Und dieser Kinbote behauptet nun tatsächlich, jener Carl II., der Vielgeliebte,
zu sein, der von Häschern verfolgte Ex-Monarch.
Und dieser Nachbar umschwärmt den verdutzten Shade als größter denkbarer Verehrer seiner Dichtkunst. Er bietet sich aufdringlich an, dessen Hauptwerk herauszugeben und zu kommentieren. In Wahrheit sucht er eine Folie, um seine eigenen wahrhaftigen und imaginierten Erlebnisse in eine poetische Form zu bringen und mit dem Anschein von Wissenschaftlichkeit zu versehen. Die Informationen über Shade und die Kommentare zu seinem Gedicht wirken wie der Vorwand zu den eigenen Vertraulichkeiten und die unzulängliche Tarnung des eigenen Romans. Jede Eselsbrücke in die eigene Biographie wird genutzt. Wird in Shades Gedicht ein Baum erwähnt oder ein Schlafzimmer, so findet Kinbote zureichenden Grund, um über Bäume und Schlafzimmer zu schreiben, die in seinem verkappten königlichen Leben eine zentrale Rolle spielten.
Zembla, ironische Idealisierung des Herkunftslandes des heimlichen Königs, haben wir uns dabei als Gemeinwesen vorzustellen, in dem vor der Revolution eigentlich alles nur zum Besten stand: “Harmonie war in der Tat die Losung dieser Herrschaft. Die schönen Künste und die Reinen Wissenschaften standen in Blüte. Technologie, angewandte Physik, industrielle Chemie und so fort waren wohlgelitten. In Onhava wuchs ein kleiner Wolkenkratzer aus ultramarinem Glas langsam höher und höher. Das Klima schien sich zu bessern. Aus dem Steuerwesen war etwas Schönes geworden. Die Armen wurden etwas reicher und die Reichen etwas ärmer ... Medizinische Fürsorge breitete sich bis an die Landesgrenzen aus ... Das Fallschirmspringen hatte sich zum Volkssport entwickelt. Mit einem Wort, alle waren zufrieden - selbst die politischen Unfugstifter, die zufrieden ihren Unfug stifteten. Aber verfolgen wir dies ermüdende Thema nicht weiter.”
Kinbote will als Kommentator des Gedichts die "Rückseite des Gewebes" zeigen - und präsentiert doch vor allem den fliegenden Teppich seiner eigenen traumatisch inspirierten Phantasie. Allzu nachdrücklich beschwört er die (wohl nur aus seiner Sicht) "herrliche Freundschaft" mit Shade, die dessen "letzte Monate überstrahlte". Und berichtet von gemeinsamen Spaziergängen, auf denen er dem Dichter ein Thema einzugeben versuchte: das eigene Königsdrama. Als Shade zu schreiben beginnt, ist es für Kinbote eine ausgemachte Sache, daß es sich nur um das grandiose Poem handeln kann, das er selbst gewissermaßen im Mutterschoß des Schriftstellerhirns gezeugt hat. Er hat mit seinem eigenen Leben die stoffliche Vorlage geliefert und ihm so manchen Tip gegeben. Auch wenn sich für so vieles im Gedicht kein Hinweis findet und der Kommentar dies verwundert beklagen muß.
“Ich erinnere mich besonders an einen ärgerlichen abendlichen Spaziergang, den mein Dichter mir mit majestätischer Großzügigkeit als Entschädigung für eine schlimme Kränkung gewährte (siehe, siehe nochmals und nochmals die Anmerkung zu Vers 181) ... Mittels scharfsichtiger Exkursionen in die Naturgeschichte wich Shade mir stets von neuem aus, mir, der ich hysterische, leidenschaftliche, unbändige Neugier hegte, zu erfahren, genau welchen Abschnitt aus den Abenteuern des zemblanischen Königs er im Verlauf der letzten vier oder fünf Tage vollendet hatte. Meine gewöhnliche Schwäche, Stolz, hielt mich davon ab, ihn mit direkten Fragen zu bedrängen, aber ich kam wieder und wieder auf meine früheren Themen zurück - die Flucht aus dem Schloß, die Abenteuer in den Bergen -, um ihm ein Bekenntnis abzuringen ... Aber nichts da! Alles, was ich auf meine unendlich zarten und behutsamen Fragen zur Antwort bekam, waren Sätze wie "Tja. 's geht ganz gut" oder "Nö. Ich sag nichts."
Wie ein überdimensionaler Parasit setzt sich Kinbotes eigener Lebensroman auf dem Wirtsorganismus des Shade-Poems fest: Er schreibt Sekundär-Literatur in einem sehr vitalen Sinn. Das Motiv des Parasitismus klingt schon im Titel an, einem Zitat aus Shakespeares "Timon von Athen": "Der Mond ist ein abgefeimter Dieb, der sein fahles Feuer von der Sonne stiehlt." Es geht um den Diebstahl als Weltprinzip. Daß Kinbote selbst den Titel nicht zuordnen kann, gehört zu den Ironien des Romans. Zwar trägt er ständig eine "Timon"-Ausgabe mit sich herum, aber leider in der fehlerhaften zemblanischen Übersetzung seines Onkels Conmal, wo "pale fire" nicht ganz zutreffend als "silbriges Licht" wiedergegeben wird.
Der gewaltsame Mord an Shade ist die Gelegenheit, an das Poem zu gelangen. Unmittelbar nach dem Mord bringt Kinbote die achtzig Karteikarten, auf denen das Gedicht notiert ist, in seinen Besitz und gibt sie künftig nicht mehr aus der Hand. Riesig allerdings seine Enttäuschung, als er darin nur von Shades unscheinbarer Existenz liest. Bald jedoch tröstet er sich mit der Idee, Zembla sei der Zensur der mißgünstigen Dichtergattin Sybil Shade zum Opfer gefallen. Als Kommentator verlegt er sich fortan aufs Dechiffrieren eines Subtexts, in dem die Wahrheit über Zembla aufgehoben sei - und scheut auch nicht das Erfinden vermeintlich gestrichener Stellen, die sich allerdings durch ihre dilettantische Holprigkeit vom Original unterscheiden.
Man erhält von Kinbote die Anweisung, daß man das Geschriebene gefälligst dreimal zu lesen habe - gemeint ist damit allerdings der Kommentar, der vor, während und dann noch einmal nach der Gedicht-Lektüre zu Rate zu ziehen sei. In grotesker Selbstzufriedenheit rundet Kinbote seine Exkurse ab: "Ich möchte glauben, der Leser hatte Spaß an dieser Anmerkung." Und versichert selbstherrlich: "Es ist der Kommentator, der das letzte Wort hat."
In Kinbotes Einbildung gerät die flüchtige Bekanntschaft mit Shade, der eher abweisend gewesen war, zu einer innigen Freundschaft. “Und er war in der Tat ein sehr lieber Freund! Dem Kalender nach habe ich ihn nur wenige Monate gekannt, aber es gibt Freundschaften, die ihre eigene innere Dauer entwickeln, ihre eigenen Äonen transparenter Zeit.” Keine Spur einer Ahnung davon, daß Kinbotes Beschattung des Dichters an Stalkertum grenzte. Die Umdeutung der Realität gönnt sich nicht geringsten Anflug eines Zweifels. “Nie werde ich vergessen, wie hochgestimmt ich war, als ich erfuhr - dies alles erwähnt in einer Anmerkung, die mein Leser noch finden wird -, daß das Vororthaus (mir zur Miete überlassen von Richter Goldsworth, der sein freies siebentes Jahr zu einem Englandaufenthalt nutzte), in das ich am 5.Februar 1959 einzog, gleich neben dem des berühmten amerikanischen Dichters stand, dessen Verse ich zwei Jahrzehnte zuvor ins Zemblanische zu übertragen versucht hatte.”
“Man lud mich ein, mit ihm und vier oder fünf anderen bedeutenden Professoren an seinem angestammten Tisch Platz zu nehmen ... Sein lakonischer Vorschlag, ich möge doch 'den Schweinebraten probieren', amüsierte mich. Ich bin strenger Vegetarier und koche gern selbst. Etwas zu mir zu nehmen, worin ein Mitmensch herumgemanscht hat, so ließ ich meine rotwangigen Tischgenossen wissen, sei mir so widerwärtig wie irgendeine Kreatur zu verspeisen, und das schlösse - ich senkte die Stimme - die üppige Studentin mit dem Pferdeschwanz ein, die, unserer Bestellungen harrend, an ihrem Bleistift leckte. Außerdem hatte ich bereits die in der Aktentasche mitgebrachten Früchte verzehrt, und deshalb würde ich mich lieber, sagte ich, mit einer Flasche guten College-Biers begnügen. Mein freies und einfaches Benehmen entkrampfte alle." Kinbote muß die Erkenntnis der geliehenen, narzißtisch forcierten Identität restlos verdrängen. Er darf von Anfang an nicht wissen, was er tut und wer er ist.
Die Literaturwissenschaft läßt übertriebene Milde walten, um aus Kinbotes solipsistischem Wahn-Universum etwas Nachvollziehbares zu machen, ein Illustriertenschicksal. In Kinbotes grotesker Fehl-Lektüre sei die verzehrende Sehnsucht zu erkennen, die eigene Leidens- und Verlustgeschichte in die (literarische) Transzendenz hinüberzuretten. In Wahrheit verkörpert Kinbote ein Prinzip menschlicher Existenz, das ganz und gar nicht zugegeben werden darf: daß wir alle potenzielle Idioten sind und daß wir über Techniken verfügen, uns Identifikationsfiguren zu schaffen, ohne und in dem anderen Idioten als Idioten wiedererkennen zu müssen. Was uns dabei hilft, uns den anderen Idioten überlegen zu fühlen, ist die Psychologie, die eigens zu diesem Zweck erfunden worden sein dürfte. Was Kinbote für den Leser bereithält, und was man sich bei “Ich und Kaminski” dazudenken muß, das ist die Erkenntnis, daß es nicht alles Psychologie ist, was die Psyche ausmacht. Neben oder jenseits der “Materie der Tagebücher”, wie Sartre den Gegenstand der Psychologie spöttisch nannte, gibt es etwas, das in manchen von uns lauert, als Sollbruchstelle oder Zeitzünder, das ins Reich der Psychosen gehört, das nicht Opfer von Verdrängungen ist, sondern von “Verwerfung”, was Psychologen für nicht-heilbar halten und was doch im Charakter-Kosmos der schönen Literatur zur Normalität dazugehört. Man kann vielleicht zwei Sorten von Literatur unterscheiden: diejenige, die von dem handelt, was jenseits der Psychologie existiert, und jene, die sich auf Psychologisches beschränkt und von dem Jenseits nichts weiß. Bei Kehlmann hab ich meine Zweifel.
Dienstag, 3. April 2012