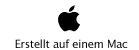Schreibhemmung
Seit Thomas Manns Novelle „Wälsungenblut“ ist die unkonventionelle Ansicht in der Welt, daß sich Autoren keineswegs leichter täten mit dem Schreiben, sondern unter Schreibhemmung litten und ebendarum Schriftsteller geworden sind, werden mußten und nicht die Freiheit hatten, einen normalen Beruf zu ergreifen. Jeder Roman hat eigentlich die Bestimmung, nicht zu erscheinen, gar nicht erst zustande zu kommen. Dennoch zustandegekommene Publikationen sind folglich Ausnahmen von der Regel. Sie verdanken sich kurzen Unterbrechungen der dem schriftlichen Formulieren ungünstigen Grundbefindlichkeit oder sind der Schreibhemmung in unendlichen Mühen und unter unsäglichen Qualen abgerungen.
Unabhängig von dieser Korrektur eines positiven Vorurteils gegenüber Schriftstellern ist die Frage, warum man überhaupt schreibt, weiterhin offen. Man könnte das Schreiben begreifen als körperliche Begleiterscheinung des normalen Auftretens eines Menschen, so wie seine verbalen Äußerungen von Gesten und Mimik begleitet und umrankt werden. Schreiben geht dem Einzelnen zwar mehr oder weniger leicht von der Hand, diese Unterscheidung ist aber unerheblich gegenüber der generellen Bestimmung des Menschen zum Schreiben als notwendige Ergänzung zur alltäglichen unmittelbaren Interaktion und zur Kompensation der unvermeidlichen Pannen und Mißverständnisse, die der verbalen Kommunikation nun einmal anhaften. Mimik und Gestik werden gemeinhin als etwas betrachtet, das die Kommunikation um die nonverbale Dimension erweitert und bereichert. Das Schreiben wäre ebenfalls eine solche Erweiterung, welche der verbalen Mitteilung eine Ebene hinzufügt, welche die verbale Sprache allein nicht abzudecken vermag.
Nun können sich Gestik und Mimik aber von dem Sinn der verbalen Äußerungen ablösen und gegen diese ein Eigenleben führen, diese konterkarieren und einen beabsichtigten oder sabotierenden Eigensinn entwickeln. Dasselbe könnte man vielleicht auch von der Verschriftlichung von Mitteilungen sagen. Schreiben wäre in Analogie zu dem nach Gilles de la Tourette benannten Syndrom zu sehen, vergleichbar mit dem Gehampel von Rameau’s Neffe, den Diderot mit gemischten Gefühlen porträtierte, oder dem von Rousseau die letzten Jahre vor seinem Tod an den Tag gelegten Zuckungen, über die sich Voltaire mokierte.
Daß Schreiben und verbales Äußern sich voneinander wegbewegen können, das verdeutlicht
Roland Barthes folgende Bemerkung: „Wissen, daß man nicht für den Anderen schreibt, wissen, daß diese Dinge, die ich schreibe, mir nie die Liebe dessen eintragen werden, den ich liebe, wissen, daß Schreiben nichts kompensiert, nichts sublimiert, daß es eben da ist, wo du nicht bist, – das ist der Anfang des Schreibens.“ Ähnliches besagt auch die folgende: “Schreiben ist genau dieser Widerspruch, der das Scheitern einer Mitteilung in eine neue Mitteilung verwandelt, ein Sprechen für den anderen, doch ohne den anderen.”
Daß das Abgetrenntsein des Schreibens von der Realität der unmittelbaren Kommunikation keinesfalls nur ein bedauerlicher Mangel ist, sondern von der Gesellschaft verlangt wird, dies kommt zum Ausdruck in dem Hilferuf, den zwei Literaturkritiker losließen angesichts der Aufgabe, über ihre Lektüreerfahrung mit dem Roman von Irene Villard zu berichten, mit dem Titel „Das 16. Kind. Glück und Abgrund einer großen Liebe“: Man hätte sich gewünscht, daß er nicht so autobiographisch wäre, sondern irgendwie literarisch überformt, seufzte der eine. Das hochpathologische Verhalten halte man gerade noch aus, solange es nur beschrieben wird, stöhnte die andere. Vollends unlesbar und unerträglich werde es aber, wenn die Autorin beginne, das alles zu deuten. Sie macht eine Therapie und gibt Interpretationen des Analytikers an den Leser weiter. Die mögen ihren Sinn haben in einem Setting, hätten aber in einem Roman nichts zu suchen. Schreiben darf dieser rigiden Poetik zufolge demnach mit der Realität möglichst wenig zu tun haben. Es muß diese in ausreichendem Maße unkenntlich machen, bannen, in ihrem Realitätsgehalt entschärfen, es muß die Realität depotenzieren, ent-realisieren. Ob die professionelle Literaturkritik sich der Implikationen und Konsequenzen dieses Dogmas bewußt ist? Was sagt die Zunft in diesem Zusammenhang zu Äußerungen Kafkas, daß Literatur nur solange interessant sei, wie das ätzenden Feuer der Erfahrungsnähe noch nicht erloschen sei?
Sonntag, 2. Januar 2011