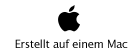Verrückte Orte
Als ungehörig oder verrückt eingestufte Verhaltensweisen lassen sich zumeist bei genauerer Betrachtung als etwas begreifen, womit die Betroffenen vermittels von Proklamationen von Distanz und Gesten situationeller Verachtung verzweifelt versuchen, Distanz zwischen sich und die nicht gebilligte Einrichtung oder Lage, in der sie sich befinden, zu bringen, wenn sie ihnen nicht entfliehen können. Irving Goffman gibt zu bedenken: „Wenn jemand seine Distanz zur Zwangs-Zusammenkunft dadurch bekundet, daß er eine Illustrierte durchblättert oder ein Getränk eingießt, obschon er doch dem Redner zuhören sollte, so hält der Verstoß ihn zumindest davon ab, den Raum gänzlich zu verlassen”.
Innerhalb von Bindungen, auf die man sich festgelegt hat, sowie in geschlossenen Einrichtungen läßt sich Distanz nur noch mit noch höheren Kosten zum Ausdruck bringen. “Die rigiden Binnenstrukturen einer Institution, wie der Schule oder der Ehe, oder einer öffentlichen Anstalt, eines Krankenhauses oder eines Asyls, können Auslöser paradoxer Verhaltensweisen sein, die sich bei genauerem Hinsehen als Strategien erkennen lassen, mit der ausweglosen Situation zurechtzukommen“. Wenn der Blick aus dem Fenster während eines Gesprächs noch als unhöfliches Betragen registriert werden mag, so wird es gefährlicher, wenn dieser jemand Grimassen schneidet oder sich Kaffee über den Kopf gießt. Damit riskiert er, für verrückt erklärt zu werden. Und in der Tat bringt er ja zum Ausdruck: „Das macht mich krank“. Kaum jemand begreift, daß diese Art situationeller Selbst-Sabotage einen Faktor in der Gleichung von Selbstverteidigung darstellen kann. So schreibt Goffman: “Es scheint so, als ob der Patient zuweilen spüre, daß das Leben auf der Station derart ungerecht und unmenschlich ist, daß die einzige Reaktion, in der noch Selbstachtung steckt, darin besteht, das Leben hier so zu handhaben, als sei es in verachtenswürdiger Weise jenseits von Realität und Ernsthaftigkeit. Das geschieht, so scheint es, indem ein Ich projiziert wird, das entsprechend verrückt und, soweit es den Handelnden betrifft, offensichtlich nicht sein wirkliches Ich ist. Der Patient demonstriert auf diese Weise, zumindest sich selber, daß sein wahres Ich nicht beurteilt werden darf nach dem gegenwärtigen Rahmen und durch diesen auch nicht gebrochen oder verdorben wurde. Aus demselben Blickwinkel teilt er implizit mit, das Verhalten, das ihn in die Anstalt gebracht habe, sei ebenfalls keine gültige Darstellung seines wahren Ich. Kurz, der Patient kann ausgesprochen verrückt handeln auf der Station, um allen normalen Leuten klarzumachen, daß er offensichtlich gesund sei.“ Man darf freilich auch nicht außr acht lassen, daß „der derart Vorgehende oder sich derart Vergehende damit nicht fertig wird. Er ist weder in der Lage, die anderen zu zwingen, seinen Affront zu akzeptieren, noch sie zu überzeugen, daß andere erklärende Gründe zu akzeptieren seien als die Verrücktheit.“
Distanzierung kann auch in alltäglichen Situationen existenziell zwingend notwendig werden. „Selbst eine locker definierte soziale Zusammenkunft ist immer noch ein enger Raum; es gibt mehr Türen, die hinaus- und hineinführen und mehr psychologisch normale Gründe, sie zu durchschreiten, als jenen träumt, die situationeller Gesellschaft gegenüber immer loyal sind.” Aus Gründen der Selbstachtung muß sich der Insasse dem Besucher gegenüber durch sein Verhalten suggerieren, daß der Ort, an dem er sich befindet, etwas sei, daß man nicht ernst nehmen kann und verachten muß. Diese Distanzierung kann er nicht unterlassen, obwohl allen Anwesenden und sogar ihm selbst klar ist, daß er diese Suggestion nicht wird durchsetzen können. Nur so kann er etwas dafür tun, daß sein wahres Ich nicht beurteilt wird nach dem gegenwärtigen Rahmen. Darum muß er es tun, auch wenn er das, was er bewirken will, so am allerwenigsten erreichen kann.
Daß es für ein solches Manöver der Selbstachtung bei den Mitakteuren in der jeweiligen Situation kein Verständnis geben zu können scheint, liegt daran, daß situationelle Erfordernisse moralischen Charakter haben. Der Einzelne ist nicht nur gezwungen, ihnen Rechnung zu tragen, sondern er muß dies auch wollen. Mißlingt es ihm, wird offiziell davon Kenntnis genommen. Er gerät nicht nur in den Verdacht, den moralischen Verpflichtungen des Situationsteilnehmers nicht grecht werden zu wollen, man zweifelt auch an seiner Kompetenz, hierzu überhaupt in der Lage zu sein.
So führt die interaktive Entwicklung einer Situation zu einer Divergenz der Wahrnehmungen und Selbstwahrnehmungen. Die Art und Weise, wie der Selbstsaboteur in diesem Moment von den anderen wahrgenommen und beurteilt wird, ist seiner Selbstbehauptung diametral entgegengesetzt. Die anderen bestehen auf der Loyalität gegenüber der Situation und können sich nicht vorstellen, daß jemand unter bestimmten Umständen von dieser Pflicht entbunden sein könnte. Sie führen eine Gerichtsverhandlung auf, in der der Abweichler für sein Vergehen bestraft wird. Jenes Ich aber, das sich zum Narren macht, um unter Einsatz der ohnehin schon prekär gewordenen sozialen Existenz die “Verrücktheit des Ortes” zu demonstrieren, der mitteilt, daß das in der Situation gefangene Ich nicht sein eigentliches Ich sei, setzt aus sich einen Narren heraus, wie eine zweite Person, die neben ihn tritt, mit der er spielt wie mit einer Puppe. Und das Stück, das er spielt, handelt von seiner eigenen sozialen Vernichtung, allerdings auch von der Erwartung der gütigen Rettung durch die anderen, die sogar stolz auf den Abweichler sind und ihn als Helden verehren.
Dazu besteht durchaus Anlaß, denn subjektiv ist sein verhalten zu vergleichen mit der aus Action-Romanen bekannten Figur eines entkleideten und an einen Stuhl gefesselten Mannes, der dem schurken, der ihm mit Tod und Folter droht, höhnisch ins Gesicht grinst oder ihn gar anspuckt. Der Held spitzt eine Situation noch freiwillig zu, um seine Verachtung für die Anmaßung des Schurken und dessen Stil auszudrücken. Stiere aus guter Zuht besitzen diesen Mut in hohem maße. Sie akzeptieren die für sie veranstalteten Turniere und kämpfen aus einer immer schwächer werdenden Position heraus weiter. Jeder kennt diesen Kult des beharrenden Mutes, der sogenannten Kämpfernatur. Beim Publikum nährt er die märchenhafte Hoffnung, daß sich das Blatt noch wenden und er dennoch siegen könnte. Seine Integrität scheint in Situationen, in denen es keine zeugen gibt, besonders wichtig zu sein.
Wir verstehen: Der unfreiwillige Patient hat sich nicht aus Schwäche in die Ausweglosigkeit seiner Lage gefügt, sondern sein wahres Selbst gegen ein Selbst behauptet, das ihm zugeschrieben wird und das er nicht akzeptieren kann. Und er hat auf der Differenz bestanden, obwohl nichts dafür sprach, daß irgendjemand seine Ansicht teilen würde. So müßte man annehmen, daß es sich nicht um eine Schwäche des Ich, sondern um einen Fall forcierter Ich-Stärke handelt. Das Ich manifestiert sich gerade in dem, was zu dem Befund seiner Schwächung führt und dazu, ihm das Ich abzuerkennen.
Goffman besteht darauf, bestimmte Verhaltensweisen, die als Indizien für Geiteskrankheit gewertet werden, als gesunde Reaktionen auf kranke Situationsanforderungen zu begreifen. Dabei muß man aber, worauf Goffman eigens hinzuweisen versäumt, beachten, daß solche Verhaltenswiesen gleichwohl alternativlos sind. Das in siner ausweglosen Situation unter den Zwang zur Wahrung der Selbstachtung gebrachte Individuum kann seine Selbstsabotage so wenig unterlassen wie der Geisteskranke sein Symptom.
Die angeführten Beispiele zur Veranschaulichung scheinen die Annahme zu bestätigen, daß es sich bei den Heldentaten, den anerkannten wie den nicht anerkannten, um etwas handelt, das dem jeweiligen Charakter eines Menschen geschuldet ist, und daß jeder jederzeit die Freiheit habe, sich heldenhaft oder abweichend zu verhalten oder nicht, wie folgenreich das Verhalten auch immer sein mag. Das Gefühl, sich selbst die Achtung schuldig zu sein, ist jedoch in vielen Fällen so stark, daß es diese unterstellte prinzipielle Willensfreiheit ausschließt. Die Intensität dieses Gefühls kann dazu führen, daß der freie Wille nicht frei ist, daß jemand gezwungen ist, freiwillig etwas zu tun, das er normalerweise nicht tun würde. Derjenige erfährt von sich etwas, das er bislang nicht wußte und das er auch nachdem es sein Handeln bestimmt hat, mit sich selbst nicht vereinbaren kann. So ging es Raskolnikoff.
Entscheidend ist, daß er, was er tut, nicht nicht tun kann, und daß er auf die anderen angewiesen ist, daß er sich von denen abhängig macht, die ihm nicht helfen werden, die sich ihm gegenüber nicht loyal zeigen werden. Wir haben also Zwangshandlungen auf beiden Seiten und eine fatale interaktive Verzahnung der Perspektiven. Für den Insassen ändert der imaginative, wahnhafte Triumph über die erlittene Zuschreibung nichts an der tatsächlichen Niederlage und Aussichtslosigkeit. Für die Außenstehenden ändert die Begegnung mit diesem Toren nichts an ihrem moralischen Überlegenheitsgefühl.
In alltäglichen Situationen ereignet sich vielfach etwas, das in geschlossenen Anstalten als untrügliches Zeichen dafür gewertet wird, daß jemand geisteskrank ist. Goffman macht darauf aufmerksam, daß jede beliebige Situation moralisch verpflichtet und daß wir alle häufig das Bedürfnis haben, uns aus der Situations-Loyalität hinauszuwinden und dies keineswegs für krank halten. Wir tun täglich mehrmals, was der geschilderte Insasse tut, ohne daß wir die Vergleichbarkeit erkennen würden. Man müsse folglich einerseits der Geisteskrankheit im Alltag einen Platz einräumen, andererseits die wenn auch „sauer-verdiente Konzeption in Frage stellen, Anstalts-Insassen seien notwendig kranke Personen.
Sonntag, 2. Januar 2011