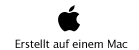Selbstgespräch
Rousseau erzählt in seinen Meditationen von einer Begebenheit, die sich auf einem seiner Spaziergänge ereignete, nicht ohne anzumerken, dieser Vorfall sei einem unvorhersehbaren Zufall gleichzusetzen. Plötzlich sieht er ich einer von einer Kutsche herjagenden dänischen Dogge konfrontiert. Er kann ihr nicht mehr ausweichen und wird von ihr umgerannt und zu Boden geschleudert. „In diesem Zusammenstoß kommt eine Kette von ursächlich miteinander verbundenen Ereignissen zur Wirkung, und dennoch kann er nur als ein absurder und grundloser Zufall verstanden werden. So wie der Zusammenstoß zufällig erfolgt, so ist man in die kontingenten Umstände des Daseins geworfen. Rousseau meinte sogar, man könne diesen Fall gar nicht empfinden, man könne sich erst nachträglich zu ihm in ein Verhältnis setzen. Er geschehe einem im Zustand der Bewußtlosigkeit. Da kann es nicht helfen, die Bewegungen in Erfahrung zu bringen und von den Umständen zu wissen, die den Zusammenstoß und den Fall der Körper herbeigeführt haben. Über seine Grundlosigkeit kommt man damit nicht hinweg.“ Die Bahn einer Biographie besteht aus einer Reihe ebensolcher Zufälle. Rousseaus Geschichtsphilosophie zufolge muß es ein derartiger Zufall gewesen sein, der die Menschen veranlaßte, in die Ordnung einer bürgerlichen Gesellschaft zu flüchten. Einmal geschehen, hat diese Flucht den Charakter einer notwendigen Ereignisfolge angenommen. Aufgrund ihrer faktischen Notwendigkeit bringt sie dann Mechanismen der Abwehr gegen Zufälle jeder Art hervor. Rousseau behauptet, es sei ein naturalistischer Fehlschluß, von der faktisch eingerichteten bürgerlichen Gesellschaft auf die Notwendigkeit ihrer Entstehung zurückzuschließen. Dies könne nur dazu führen, daß man einmal entstandene Lebensverhältnisse mit dem Schein der Legitimität umgibt. Den Spitzfindigkeiten der Vernunft würde es immer gelingen, nachträgliche Legitimationen zu finden. Das Ziel der Meditationen ist es, auf die nachträgliche Legitimation und rationale Erklärung eigener Daseinszustände zu verzichten und die Bewegung der Flucht in diese zu unterbrechen. Rousseau berichtet, er sei nach dem Sturz zu einer Selbstempfindung erwacht, die sich erst in der nachträglichen Selbstbeobachtung und in den Reflexionen über die Folgen des Unfalls verloren habe. Daß er den melancholischen Gedanken hat, er sterbe, ohne gelebt zu haben, tritt in Korrespondenz mit dem Umstand, daß sich die Nachricht verbreitete, Rousseau sei an den Folgen eins Unfalls gestorben. Ist man einmal auf eine introspektive Psychologie festgelegt, dann wird man sich auch in ihren Abgründen verlieren, indem man sich fortwährend gegen diese behaupten muß. Er stellt fest, daß es für den Prozeß der Selbstfindung und der Schuldigkeit sich selbst gegenüber gar keine verbindliche Mitteilungsform gibt. „So bin ich denn nun allein auf Erden“ (Me voici donc seul sur la terre). In den „Rèveries du promeneur solitaire“ bringt Rousseau seine Versuche zum Abschluß, die Struktur und Arbeitsweise der menschlichen Psyche anhand von Selbstanalysen aufzuklären und diese mit einer Diagnose moderner Lebensverhältnisse zu verbinden. „In der Erinnerung seiner selbst will er eine Version des Selbst sichtbar werden lassen, die man als unsichtbare Persönlichkeit bezeichnen kann. Rousseau will zur Aufklärung dieser unsichtbaren Persönlichkeit gelangen, indem er sich willkürlich dem Schmerz der Einsamkeit und Verlassenheit unterwirft, um deren Ursachen in der Selbstreflexion nach und nach wegzuarbeiten. Die Formen dieser Selbsteinkehr und des erneuten Versuchs, sich unter den Bedingungen der Einsamkeit zu sich selbst in ein unerschütterliches Verhältnis zu bringen, gewinnen ihre Mitteilungsform im Selbstgespräch.“ Rousseau hat damit eine Archäologie moderner Subjektivität geschrieben, eine Kennzeichnung des modernen Autors. (Zitate aus: Bernhard Lypp, Eine anticartesianische Version des Selbst, in: Poetik und Hermeneutik XI, Das Gespräch)
Sonntag, 16. Oktober 2011