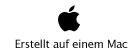Lebenskunst
Im deutlichen Kontrast zur Ratgeber-Literatur im Sinne einer neu aufgelegten Lebenskunst steht ein scheinbar nebensächlicher Hinweis Kierkegaards auf die gnostische Sekte der Karpokratianer, die Sünde in concreto zu realisieren empfahlen. Sie lehrten, daß der Mensch alle Taten, selbst die ruchlosesten, begehen müsse. Solange dies nicht erreicht sei, werde man ständig wiedergeboren. Der Hinweis auf diese im 2. Jh n. Chr. existierende Sekte findet sich in Kierkegaards Tagebuch in einer Notiz von 1836, die von der Notwendigkeit spricht, durch alle Laster zu gehen, um dadurch die erforderliche Lebenserfahrung zu gewinnen. In dieser zyklischen Dialektik der Gnostiker, die wohl auch Nietzsche inspiriert hätte, haben Fehlleistungen, Pathologien und Verbrechen einen anderen Stellenwert als in Hegels den Konsens fetischisierenden Lehre vom Bösen als notwendigem Durchgangsglied zum Guten. Diesen Rekurs verbindet Kierkegaard mit einem uneingeschränkten Plädoyer für den Einzelnen. Als Einzelner nimmt der Mensch zwar am Ablauf der Weltgeschichte teil, aber als leidendes Subjekt wird er nicht ausgewiesen. Kierkegaard durchschaut die ideale Ethik, wie sie Hegel verficht, als den “Zuchtmeister”, der zum handelnden Subjekt nicht vordringt.
Er vertritt vehement die Ansicht, daß die Veränderung der Wirklichkeit nicht durch Wissen, sondern nur durch Handeln zu erreichen sei. Das Wissen vermag an moralischen Unzulänglichkeiten des Menschen und an seinem Scheitern lügend und sich selbst belügend vorbeizudenken. Er kritisiert an Hegel, daß er die Totalität der Lebensäußerungen dem idealisierenden Kalkül der Vernunft zu unterstellen beansprucht. Sokrates dagegen sei ein Muster für jenes ironische und schelmenhafte Denken, das zum Vorbild für sein eigenes Gedankengebäude wird.
Pinocchios Abenteuer könnte man im Lichte dieser Empfehlung sehen. Er macht jeden Fehler, der sich ihm bietet, und ist außerstande aus seinen Fehlern zu lernen. Die moralische Verurteilung hilft nicht weiter. Die Fehler sind nicht als moralische Verfehlungen zu werten, auch wenn die pädagogische Lesart dies suggeriert. Er zieht aus seinen Fehlern keinen eigenen Vorteil. Er hat nicht das geringste Talent, an seinen eigenen Vorteil zu denken. Und wenn er jedem Schlamassel immer wieder gerade so entrinnt und dem Tod wieder von der Schippe springt, dann nicht, weil er einen gesunden Selbsterhaltungsinstinkt bewiese, auch nicht, weil man ein Einsehen oder Mitleid mit ihm hätte, sondern es handelt sich eher um einen Aufschub, weil die Liste seiner möglichen Fehler und Desaster noch nicht vollständig ist.
Er ist das diametrale Gegenteil von den aufgeweckten Jungs bei Mark Twain, die sich so leicht kein X für ein U vormachen lassen. Was sie auszeichnet, ist die Fähigkeit zum "debunking", der Mut für ein respektloses Durchschauen und die Furchtlosigkeit, den Kaiser in seinen neuen Kleidern zu erkennen und bloßzustellen. Wer diese Fähigkeit nicht besitzt, der gilt als begriffsstutzig.
Über Thomas von Aquin ist eine Anekdote überliefert, derzufolge er in der Klosterschule gehänselt wurde. Ein Mitschüler rief: Draußen ist gerade ein Esel vorbeigeflogen. Thomas lief ans Fenster. Brüllendes Gelächter: Wie kann man so blöd sein. Thomas sagt: Ich hätte eher geglaubt, daß Esel fliegen, als daß ein Mönch lügt.
Pinocchio hält Fuchs und Katze für seine Freunde, so daß er nicht anders kann, als ihnen zu glauben, als sie ihm sein Geld abluchsen, um es angeblich einzugraben, damit dort bald ein Geldbaum wachse und die eingesetzten Taler reichlich Früchte tragen.
Auf der Suche nach einem Hinweis auf die Herkunft des Worts debunker bietet google diese Word History: One can readily see that debunk is constructed from the prefix de-, meaning "to remove," and the word bunk. But what is the origin of the word bunk, denoting the nonsense that is to be removed? Bunk came from a place where much bunk has originated, the United States Congress. During the 16th Congress (1819-1821) Felix Walker, a representative from western North Carolina whose district included Buncombe County, carried on with a dull speech in the face of protests by his colleagues. Walker later explained he had felt obligated "to make a speech for Buncombe." Such a masterful symbol for empty talk could not be ignored by the speakers of the language, and Buncombe, spelled Bunkum in its first recorded appearance in 1828 and later shortened to bunk, became synonymous with claptrap. The response to all this bunk seems to have been delayed, for debunk is not recorded until 1923.
Donnerstag, 17. März 2011