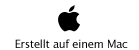Kunst und Literatur
Mit Deleuze kann man Kunst als Epiphanie begreifen. Deleuze spricht vom Schock des Ereignisses, von messianischen Erscheinungen, von dem Schock, der ausgelöst wird vom Gesicht des Anderen, von der Gegenwart von Gespenstern, vom Einbruch einer Transzendenz. Seine Erfahrung ist: Die Immanenz ist selbst eine Transzendenz. Kunst hat demnach zu tun mit dem, was Deleuze über die Begegnung mit der ersten Natur schreibt, von der man mit geröteten Augen zurückkehrt. Über die Arbeit der Kunst schreibt er in diesem Sinne, daß sie eine Arbeit sei, die den Akteuren den kopf spaltet, und darum ihnen erlaubt, eine Sahara einzufügen. Kunst ist das Regime der Wahrheit des Sinnlichen, eine Kraft des Lebens, die sich dem Organischen und instrumentellen Bereich der Körper gegenüberstellt. Für Deleuze läßt Kunst Körperzustände von der nicht organischen Wahrheit des Lebens kommen (mit Organismus ist immer das Gefüge der Institutionen gemeint). Die Epiphanie ist keine bloße Metapher. Bei Kafka gibt es einen menschlichen Organismus, der sich wirklich in einen Käfer verwandelt. Es gibt wirklich eine ontologische Blockade der sensomotorischen Logik. Prousts Suche nach der verlorenen Zeit ist für Deleuze das Spinnennetz eines Schizophrenen.
Man könnte freilich auch mit Rancière sagen, daß Prousts Roman das Produkt einer widersprüchlichen Operation sei, bei der es ihm darum gegangen sei, die Spannung zwischen den beiden Logiken Verkettung und Unterbrechung in Bewegung zu setzen. Seine Suche sei die nach einer Wahrheit, die sich selbst errichtet wie der Schock des Ungewollten. Seine Kunst sei die, sich selbst zu überraschen. Ästhetik ist das Denken der Kunst als Konstruktion eines Ausnahmesensoriums, egal ob man dieses Sensorium nun, wie Deleuze es tut, als eine ontologische Differenz begreift, oder wie Rancière als eine poetologische Differenz. Die Ontologie ist auch nur nur eine Fiktion. Proust, Kafka, Hitchcock konstruieren jeweils die Ontologie, die ihre künstlerischen Vorschläge trägt. Der Künstler lebt immer in zwei Welten gleichzeitig: „in einer, in der die sinnliche Impression der Schock des Wahren ist, und in einer, in der sie ein Indiz innerhalb einer Untersuchung über die Zuverlässigkeit der Zeichen ist.“ (Rancière, S. 79) Rancière: "An der Literatur interessieren mich zwei Dinge: Das Vergnügen daran, wie etwas um Haaresbreite seiner Repräsentation entgeht, und ebenso das repräsentative Spektrum, das sie einem aufzeigt. Diese Ambivalenz prägt auch das moderne Schreiben: Zum einen sind die Worte nicht die Dinge, zum anderen stehen sie in einem Bezeichnungsgeflecht zu den Dingen." Die Literatur erstreckt sich zwischen Voltaire, der Literatur gleichsetzte mit dem, was in der Antike "Grammatik" hieß, also dem System der schönen respektive geschmackvollen Werke der Geschichte, Rhetorik, Dichtung und Kritik, und Maurice Blanchot, für den Literatur nichts anderes als die Möglichkeit zu schreiben bedeutete.
In dem Band "Die stumme Sprache" liegt der Fokus naturgemäß auf den "Widersprüchen der Literatur". Die Entmündigung des Lesers und Zuschauers und die Entmündigung des Bürgers haben in Rancières Augen ein und denselben Ursprung: die Konsolidierung eines trügerischen gesellschaftlichen Konsens', der uns den Kontrast zwischen Armen und Reichen, stummen Minderheiten und akkreditierten Lobbys oder - auf die Literatur und Künste übertragen - der toten Schrift und der Dichterstimme vergessen lasse. Schuld daran gibt Rancière der Demokratie als Herrschaftsform, die dem Volk durch politische Kompromisse seine Stimme abgehandelt, das heißt, sie der Schrift des Gesetzes überantwortet und damit seine sinnliche Präsenz in eine schweigende Masse verwandelt habe. "Die Demokratie ist die Herrschaft der Schrift, wo die Perversion des Buchstabens identisch ist mit dem Gesetz der Gemeinschaft."
warum beklagen wir, dass Literatur nicht mehr als Faktor der sozialen Ausdifferenzierung wahrgenommen wird? Weil, so antwortet Rancière, die Herrschaft des Konsens' der Literatur wie der Demokratie schade.
Der Widerspruch zwischen dem "Fleisch" des lebendigen Worts und der totalitären Schrift der Gesetze ist in seinen Augen derselbe wie der zwischen der Straße und dem Parlament.
"Die Demokratie ist nämlich nicht ein System, das sich bloß durch eine unterschiedliche Verteilung der Macht bestimmt. Sie ist tiefer gehend als eine bestimmte Aufteilung des Sinnlichen definiert, als eine spezifische Neuverteilung ihrer Orte."
Rancière zeigt sich als Schüler Foucaults, wenn er den Begriff der Repräsentation zum Dreh-und Angelpunkt seiner Überlegungen macht und ihm das romantische, subjektivistische, fluidale Moment des stummen, vagabundierenden Worts entgegenhält, das er aus Derridas Postulat der verdoppelten Schrift und von Blanchot übernommen hat.
Die nichtrepräsentativen, nichtmimetischen Momente sind es, die Rancière für fähig hält, einer der Beliebigkeit, dem Konsum und den "schmarotzenden Diskursen" ausgelieferten und gezähmten Literatur wieder den Geist der Rebellion, der sozialen Unruhe einzuhauchen.
"Die Literatur existiert eigentlich nur als Fiktion der Literatur", sagt Rancière, nämlich "als der unendliche Übergang von einem Rand zum andern, vom Leben zum Werk und vom Werk zum Leben, vom Werk zum Diskurs über das Werk. Ein ständiges Übergehen, das sich jedoch nur vollzieht, wenn es den Riss sichtbar beläßt". Malerei sollte entsprechend zu verstehen sein.
Und wie ist es mit Foucault: Er interessiert sich für das, was ein Regime der Wahrnehmung und des Denkens verbietet, was es ausschließt. Die fundamentale Intuition, die die Konzeptualisierung Foucaults trägt, ist – in der Zusammenfassung Rancières - jene der Macht, die klassifiziert, befiehlt, verbietet, ausschließt und die, selbst da, wo sie es erlaubt, es unter der Form des Zwangs macht – (im Willen zum Wissen wird der Anspruch der freien Rede in eine durch die Macht produzierte Verpflichtung zu sprechen, umgedreht wird). Es ist die Intuition des Ausschlußes, des durch das Außen strukturierten Innen, der Vernunft, die über die Einsperrung des Wahnsinnns konstruiert ist. Deswegen ist die Episteme bei ihm eine Struktur, die Möglichkeiten der Äußerung annulliert. eine neue Episteme bedeutet, daß es Dinge gibt, die man nicht mehr sagen, die man nicht mehr denken kann.
Im Unterschied zu Foucault sollte für Ranciere Kunstgeschichte nicht davon handeln, was ein Regime der Wahrnehmung und des Denkens ausschließt und verbietet, sondern was es neu erlaubt. Eine neue Episteme ist in seinen Augen eine neue Form der Inklusion, ein Regime der Komplikation des Gegebenen.
Wann immer ein Kunstwerk mit Qualität auftaucht, handelt es sich um einen Akt der Subjektivierung innerhalb eines Konsensgefüges von gewohnten Wahrnehmungs- und Sprechweisen, eine Abweichung von der Normalität, um ein Moment der Diskontinuität, der Unterbrechung der Selbstverständlichkeit des Alltagslebens. Dabei werden für normal genommene Unterscheidungen aufgebrochen. Gesellschaft allgemein und auch die Geschichte der Kunst selbst im speziellen ist von Differenzierungen geprägt. Die Patrizier nahmen von den Plebejern an, daß sie nicht sprechen. Aus ihren Mündern komme nur unartikulierter Lärm. Die Komödie sei nur dummer Klamauk. Die Plebejer haben keinen Geschmack und keine Kultur. Dies ist so, weil sie Wesen ohne Namen sind. Sie müssen einzeln beweisen, daß sie sprechen und daß man mit ihnen verhandeln muß. Im Gesellschaftskörper, im sozialen Organismus, sind sie nur der passive Bauch, während die Patrizier dessen aktive Glieder sind. Erstmals in der französischen Revolution haben einzelne, wie Ballanche, behauptet, daß die Stummen tatsächlich sprechen. Es geht um die Frage: Wer übt und wer übt nicht die Kraft der gemeinsamen Sprache und des Denkens aus. Dies wird entschieden im Regime der Identität und des Kalküls von Identitäten. Eine große Polizei sorgt für die symbolische Konstitution einer Gesellschaft als Ensemble definierter und identifizierter Gruppen. Eine Subjektivierung ist immer eine Deidentifikation. Ein Neues separiert sich von der Gemeinschaft der Bürger. Kunstwerke sind sinnliche Unterbrechungen eines bestimmten Körpers, der an die Abhängigkeitsbedingungen angepaßt war. Jemand hat seinen Platz in der polizeilichen Verteilung der Funktionen und der sozial zugewiesenen Plätze verlassen, wie einst der Arbeiter in der französischen Revolution. Eine jede Form der Subjektivierung konstituiert sich über eine Vielheit von Einzelreignissen, von sinnlichen Mikroereignissen, die die Angleichung eines sinnlichen Körpers an einen symbolischen Körper unterbrechen. Arbeiter schaffen sich einen anderen Körper als den, den, der sie einem bestimmtem Platz zuordnet, zuschreibt, den der Produktion und der Reproduktion ohne Geschichte. Sie schaffen sich diesen neuen Körper zuallererst mithilfe der Kunst und der Poesie, indem sie sich einen ästhetischen Blick schaffen. Der neue Blick ist zuerst immer ein ästhetischer Blick. Eine neue, dem Normalen abgerungene Singularität läßt sich als Modifikation oder Mutation des Blicks begreifen. Hegel stellte eine solche Blickmutation am Beispiel der Genrebilder fest. Er sah in den Betteljungen von Murillo das Äquivalent zu den Götterstatuen und Heroen Winkelmanns. Die Betteljungen haben die Unbekümmertheit der olympischen Götter. Dasselbe hätte man auch über die Modelle Caravaggios sagen können. Eine Auslage von Früchten und Fischen oder eine Warenauslage im Kaufhaus, die Gefühle eines einfachen Lebewesens, ein Ehebruch in einer Kleinstadt der Provinz, sind genauso empfänglich für Schönheit wie die Gestalt der olympischen Götter oder die Darstellung eines Streits zwischen Fürsten. Die Geschichte der Kunst ist eine der Namen, die sich „enteignen“ (Rancière).
Jene Bettler und Straßenjungen sind schön, weil sie als solche weder etwas tun noch reden, weil ihre Körper nichts ausdrücken. Die neue Schönheit annulliert das System, durch welches Körper Zeichen repräsentierten, die Gedanken oder Gefühle übersetzten, Handlungen zusammenfaßten. Die Werke der neuen Poeten mußten nicht mehr wie bei Platon wie trügerische Bilder oder moralisch zweifelhafte Modelle berurteilt werden. Sie mußten, wie bei Aristoteles, einzig vom Standpunkt der Kohärenz der Zusammenfügungen von Handlungen, von Formen und Zeichen, die sie entwickelten, her beurteilt werden, wenn auch diese Kohärenz ihrerseits mit Normen und externen Hierarchien verknüpft war.
Die Moderne schließlich entdeckt, daß die Schönheit ganz und gar gleichgültig gegenüber der Qualität des Sujets ist. Dasselbe ließ sich in der Literatur beobachten. Bei Flaubert kennt die Literatur keine feststehenden Sujets mehr. Die Liebeserklärung kann auf der Landwirtschaftsausstellung erfolgen. Das Werk ruht in sich selbst. Es führt seinen eigenen Beweis von Satz zu Satz. Wenn die Brüder Goncourt ein Bild von Chardin beschreiben, transformieren sie die dargestellten Teller, Tischtücher oder Früchte in Ereignisse des malerischen Stoffes. Wenn Zola das „Paradies der Damen“ oder den „Bauch von Paris“ beschreibt, trägt er dazu bei, eine neue Schönheit zu erfinden. Literaur- wie Kunstgeschichte ist Geschichte solcher Singularitäten.
„Die Malerei ist nicht nur eine Kunst im Sinne eines geteilten praktischen Wissens davon, wie Werke, die man Bilder nennt, hergestellt werden, es ist die Idee der Kraft des Sichtbaren und der Mutationen seines Bezugs zur Ordnung der Bedeutungen.“ (Rancière)
Einen Akt der Subjektivierung sieht auch Foucault, u.z. in der Anmut. Wo Foucault von Anmut spricht, redet er von den Praktiken der Geschicklichkeit, der Bedeutung des rechten Augenblicks. Das Spiel der Anmut sei der Lohn der Arbeit. Die Impressionisten hatten sie entdeckt, indem sie sich dem steifen Kanon der vorgeschriebenen schicklichen Posituren verweigerten und sich für die beiläufigen Gesten, die Geschmeidigkeit in der Unbeholfenheit und die Grazie der Umständlichkeit interessierten. „Anmut ist in der Bemessenheit der Bewegungen, verknüpft mit dem Maß, das nicht das der Perfektion ist. “ (Foucault)
Zweifel an Rancières Konzet bleiben angebracht. Wenn der Arbeiter in der Französischen Revolution noch eine revolutionäre Größe gewesen sein mag, so ist heute das Klientel der privaten Unterschicht-Fernsehsender samt den „bildungsfernen Schichten“ und auch samt den konsumabhängigen neuen „jungen Kreativen“ als Träger eines Regimes der Dummheit zu betrachten, das als Konsens zur unumgänglichen Macht geworden ist. Subjektivierungen und Diskontinuitäten oder die Adaption poetischen Sprechens und die Schaffung eines ästhetischen Blicks sind von ihnen nicht zu erwarten, im Gegenteil.
Dienstag, 12. April 2011