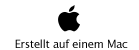Mainstream
Was wir Mainstream oder politische Mitte oder schlicht das Normale nennen, scheint denen, die sich dort angesiedelt sehen, als theoriefrei. Wer die Einstellung der CDU unter Merkel vertritt, tut dies in der Überzeugung, daß er deshalb richtig liege, weil er sich nicht durch Theorien beirren lasse, im Unterschied etwa zu linken Spinnern. Es wäre an der Zeit, den theoretischen Aufwand zu explizieren, der für eine solche vermeintlich von Theorie nicht angekränkelte Haltung tatsächlich nötig ist, und das Bizarre dieser Theorien erkennbar zu machen, die für das Aufrechterhalten des vermeintlich theoriefreien Pragmatismus erforderlich sind. Die im Mainstream schwimmen, glauben ganz einfach zu wissen, was die richtige Einstellung ist.
Eine Theorie für die Behauptung der Theorielosigkeit und Theorie-Unbedürftigkeit des Normalen und des Mainstreams lieferte John Dewey mit seiner pragmatistischen Lesart der Frage der Wahrheit. Ihm zufolge ruft eine Situation mit gegensätzlichen Tendenzen "ihre eigenen angemessenen Konsequenzen hervor und trägt ihre eigenen Früchte in Gestalt von Wohl und Wehe”. "Die von der Situation ausgelösten Gedanken, Einschätzungen, Absichten und Vorhaben rufen – gerade weil sie Einstellungen des Reagierens und der versuchten Regelung (also nicht bloße Bewußtseinszustände) sind – ebenfalls Wirkungen hervor. Das Ineinandergreifen, das wechselseitige Anpassen, das sich sodann zwischen diesen beiden Arten von Konsequenzen einstellt, bildet die Übereinstimmung, welche die Wahrheit ausmacht.”
Zweifelszustände von Personen, die nicht durch eine "reale Situation” hervorgerufen und auf sie bezogen sind, nennt Dewey ohne Umschweife "pathologisch”. Infolgedessen würden verworrene Situationen "nicht durch die Beeinflussung unserer persönlichen Geisteszustände” geglättet, aufgeklärt und in Ordnung gebracht. Der Versuch, sie durch solche Eingriffe in Ordnung zu bringen, beinhalte im Gegenteil das, was Psychiater "Realitätsflucht” nennen.
Die Gewohnheit, sich des Zweifelhaften zu entledigen, als wenn es nur zu uns statt zur realen Situation gehörte, in der wir gefangen und von der wir betroffen sind, sei ein "Erbe der subjektivistischen Psychologie”.
Die untrügliche Sicherheit, richtig gedacht zu haben, beruhe auf den Lebens- und Organformen des Denkens, der Gedanken in der natürlichen Umgebung der Alltagspraxis, in der man mit der Realität "zurechtkommen” und "fertigwerden“ muß. Deweys Theorie des Denkens ist eine Kriteriologie für die allmähliche Verwandlung einer unbestimmten Situation in eine geklärte. Im Unterschied zum "Zuschauermodell der Erkenntnis”, demzufolge man Normalität und Wahrheit durch Beobachtung ermittelt, betont Dewey den Charakter der Wahrheit als aktive Suche nach Sicherheit. Erkenntnis ist für Dewey ein Prozeßbegriff, der die logische Verknüpfung nicht als momentanes Ereignis abbildet, sondern als ein Vergangenheit und Zukunft umspannendes Kontinuum, die Summe sequentieller Ereignisse zur Klärung einer Situation.
Daß man im Zuge der Wahrheitsfindungsprozesse kollektiv über Jahre hinweg in die Irre gehen und sich komplett versteigen kann, sollte freilich angesichts der Finanzkrise wie des Reaktor-Desaters in Japan evident geworden sein. Mainstream oder Normalität sind dann nur noch der Name für das Gefängnis, das von Denkgewohnheiten gebildet wird, und damit für die Höhle, von der einst Platon sprach. Die Welt können wir ihm zufolge nur so wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen können. Über ihre tatsächliche Beschaffenheit wissen wir nichts. Wir können nur denken, was uns jeweils zu denken möglich ist. Wie Platons Höhlenbewohner leben wir im Käfig unserer begrenzten Wahrnehmungsfähigkeit und unseres begrenzten Denkvermögens, das wir durch Relevanzkriterien stets selbst begrenzen, was freilich nur solange vorhält, Die einzige Möglichkeit, aus diesem Gefängnis zu entkommen und über die Wirklichkeit jenseits dieser Grenzen etwas in Erfahrung zu bringen, scheint daher darin zu bestehen, Störungen und Unfälle zu beobachten oder diese gezielt herbeizuführen. Störungen zeigen sich als Unterbrechung der Konstitutionsprozesse von Selbstverständlichkeit. Sie machen in dem Augenblick, da etwas zusammenbricht, sichtbar, daß es sich bei dem Selbstverständlichen um eine Konstruktion gehandelt hat, und da wir alle mit drinhängen, zugleich, daß diese Konstruktion durch interaktive Aushandlungsprozesse zustande gekommen ist.
Muß man nicht entsprechend Anormalität auch als Resultat von Aushandlungsprozessen begreifen, soziale Anormalität ebenso wie psychische? Die Frage, warum eine Diktatur Wurzeln schlagen kann, ist hier ebenso relevant wie die Frage, warum und wie eine Geisteskrankheit entsteht. Auch die Überzeugung, wissenschaftlich urteilen zu können über Geisteskrankheiten, indem man an den Evidenzen der Sichtbarkeit ansetzt und sich auf sie verläßt, entspringt in letzter Instanz einer gesellschaftlichen und institutionellen Determination, der ein Aushandlungsprozeß zugrundeliegt.
David L. Rosenham zufolge dürften Geisteskrankheiten nicht als als sichtbare Tatsache verstanden werden, sondern müßten als Ausdruck anormaler soziokultureller Verhältnisse begriffen werden. (David L. Rosenham, On being sane in insane Places 1973). Er fordert, man müsse sich den Bedingungen des Auftretens von Geisteskrankheiten in der Gesellschaft zuwenden. Er ist sich darin einig mit den Protagonisten der Antipsychiatrie David Cooper, Ronald D. Laing, Thomas S. Szasz, Franco Basaglia, Felix Guattari etc…
Für großes Aufsehen sorgte seinerzeit ein Experiment Rosenhams, in dem eine Gruppe von Freiwilligen sich in einer Nervenheilanstant oder ein Irrenhaus einliefern ließ, ohne daß das Personal der Anstalt davon in Kenntnis gesetzt worden war, daß es sich um ein Experiment handelte. Obwohl die Simulanten nach ihrer Einlieferung keine psychischen Auffälligkeiten mehr zeigten, galten sie vom Augenblick der Internierung an als geistig gestörte Personen. Das Experiment bewies: Die Psychiatrie neigt dazu, die Objektivität des ärztlichen Blicks zu überschätzen, das Herrschaftsverhältnis zwischen dem Subjekt Arzt und dem Objekt Patient zu affirmieren und geschichtlich entstandene Normen, wie die, infolge derer zwischen Normalem und Pathologischem unterschieden wird, zur Bestätigung einer abstrakten Idee von Normalität einzusetzen. Nach ihrem behaviouristischen methodischen Prinzip dürfe nur das unmittelbar beobachtbare Verhalten Gegenstand der Psychologie sein. Innere “mentale” Ereignisse seien der Wissenschaft nicht zugänglich und gehörten deshalb nicht zum Forschungsgegenstand. Das Verhalten gilt als objektiv, das Mentale als bloß subjektiv.
Ein von seiner Selbstreflexion abgeschnittenes, somit krank zu nennendes Denken konstituiert eine Objektivität, der man ihre Konstruiertheit nicht mehr ansieht. Dieses kranke Denken mag einer natürlichen Neigung des Menschen entgegenkommen, im Denken selbst dessen eigene Konstitutionsprozesse zu vergessen, entsprechen, dennoch hat es diese Krankheit in dieser Absolutheit nicht immer schon gegeben. Die Menschheit hat erst in der Neuzeit den Kampf gegen diese massive Form der Dummheit aufgegeben und vergessen, daß sie Jahrtausende lang diesen Kampf geführt hat.
Frei von dieser Denkkrankheit sind die Phänomenologen, die darin übereinstimmen, das Normale und das Anormale nicht als a priori voneinander getrennte Bereiche mit fest umrissenen Grenzen aufzufassen, und stattdessen eine wechselseitige Durchdringung von Gesundheit und Krankheit annehmen. An die Stelle eines Erklärens aufgrund meßbarer Differenzen und quantitativer Abweichungen tritt bei ihnen ein einfühlendes Verstehen, das nicht von einer körperlich defizitären Naturausstattung des Kranken ausgeht, sondern dessen Leiden mit Verschiebungen in der Struktur der Wahrnehmung (Merleau-Ponty), mit biographisch relevanten Konflikterlebnissen (Freud, Sartre, Lacan) sowie mit der exzentrischen Struktur menschlichen In-der-Welt-Seins (Binswanger, Heidegger) in Zusammenhang bringt.
Es gilt nun zu bestimmen, wie das Denken von dieser phänomenolgischen Wahrheit abzuweichen vermag, was man anstellen muß, um sich erfolgreiche einzureden, daß die Wirklichkeit und das Denken anders seien, als sie die Phänomenologen sehen. Es gilt, wie das Foucault unternommen hat, den Normalitätsbegriff auf die Normativität von Diskursen und auf Normalisierungsstrategien auch nicht-diskursiver Praktiken anzuwenden. Foucault bettet hierzu die phänomenologische Kritik in eine Epistemiologie ein, die von der Einsicht getragen ist, daß “jedes Wissen an wesentliche Formen der Grausamkeit gebunden ist”, und daß der Mensch eine psychologisierbare Gattung erst geworden ist, seit sein Verhältnis zum Wahnsinn äußerlich durch Ausschluß und Bestrafung und innerlich durch Einordnung in die Moral und durch Schuld definiert worden ist. Foucault richtet sein Erkenntnisinteresse auf den Normalismus der modernen Psychologie selbst. Der Mensch ist “eine psychologisierbare Gattung erst geworden, seit sein Verhältnis zum Wahnsinn eine Psychologie ermöglicht hat.” “Die Psychologie denkt die Entstehung der Geisteskrankheit als eine Entdeckung, als das Offenlegen eines Objekts, das bereits vor seiner Entdeckung da war und nicht durch diese erst konstituiert wurde.”
Diese Psychologisierung hat dafür gesorgt, daß das Augenmerk von der individuellen Genese einer Geistesstörung abgezogen und stattdessen auf eine substrathafte, natürliche Essenz der Krankheit gelegt wurde. Indem dabei mit Begriffen operiert wird, die für die somatische Medizin bestimmt sind, arbeitetet man mit dem unausgewiesenen Postulat, demzufolge das Bewußtsein in seiner Entwicklung denselben Gesetzen unterliege wie der Körper. “Wie die organische Medizin hat auch die der Geistesstörungen zunächst versucht, das Wesen der Krankheit in der kohärenten Gruppierung der sie indizierenden Zeichen zu entziffern…” Das psychologische Erkennen richtet sich keineswegs auf das Individuelle und Konkrete einer psychischen Störung. Es dient vielmehr nur der Zementierung eines unbeweglichen Kategorienrasters, das die Psychopathologie durch einen Vergleich mit den Krankheitserscheinungen zu bestätigen sucht. Basis einer derartigen Symptomatologie bildet ein Naturalismus, der “die Krankheit zur botanischen Spezies erhebt”. Man nimmt an, daß Symptomkomplexe in einer nicht näher begründeten Anlage des seelischen Organismus präformiert bereitliegen und daß sie durch bestimmte, hypothetisch angenommene Reize ausgelöst werden. Man will nicht bemerkt haben, daß man dabei mit dem Problem zu kämpfen hat, daß eine Anwendung des Schemas in keinem Fall recht gelingen will.
Indem die allgemeine Psychologie geistige Gesundheit als naturanaloges Funktionieren seelischer Vermögen bestimmt, referiert der Terminus “Geisteskrankheit” auf das entsprechende Gegenteil: nämlich auf die “außer kraft gesetzten Funktionen”, den “Verlust des Bewußtseins” oder das “Verlöschen dieser oder jener Fähigkeit”. Sie legt damit eine “rein negative Beschreibung der Krankheit nahe; und die Semiologie einer jeden war da ganz einfach, beschränkt auf Beschreibung der eingebüßten Fähigkeiten, Aufzählung der vergessenen Erinnerungen bei Amnesien, detaillierte Aufstellung der unmöglich gewordenen Synthesen bei Persönlichkeitsspaltungen”. Wenn aber Krankheiten das Resultat einer Substraktion von Fähigkeiten sind, wie steht es dann, so fragt Foucault, um die Tatsache, daß die Persönlichkeit das Element ist, in dem sich die Krankheit entwickelt? Und wie erklärt man sich den Umstand, daß in manchen Krankheiten bestimmte Fähigkeiten einerseits negiert, zugleich aber “manisch” forciert erscheinen. Einerseits will man Diskontinuität zwischen normal und anormal, anderseits muß man ständig Kontinuitäten einräumen. Auch hinsichtlich der juristischen Implikationen kommt man nicht zu einer eindeutigen Haltung. Entweder wird der Kranke als ein an den Randlagen der Normalität angesiedeltes Subjekt betrachtet, also grundsätzlich als eine eigenverantwortliche Person, wobei er dann eigentlich gar nicht krank ist, andererseits wird ihm als Krankem der Status der Persönlichkeit aberkannt, indem er nur als seelenloser Körper fungiert.
Die medizinische Positivierung der Geisteskrankheiten hat zu einer problematischen Entdifferenzierung von körperlicher und geistiger Gesundheit geführt. Sie wiederum führt dazu, daß die irreduzible Eigenart des Subjektiven vernachlässigt wird. Die Krankheit des Bewußtseins verfügt im Gegensatz zur organischen Pathologie über eine Sinndimension, an die die somatologische Denkform nicht herankommt. Freud hatte in dieser Entwicklung eine ambivalente Rolle. Foucault charakterisierte ihn als jemanden, der die Psychopathologie unglücklicherweise durch den “Mythos von einer Identität des Kranken mit dem Kind und dem Primitiven” sowie durch einen “bio-psychologischen Begriff der Libido” bereichert habe.
Die verstehende Psychologie definiert ihr Argumentation als Kritik an einem infantile Naturalismus, der die Entwicklung einer Geistesstörung nach Art biologischer Phasen beschreibt und davon ausgeht, daß ihr Stärkegrad je nach der Zahl der ausgefallenen apriorischen Vermögen zunimmt. Verstehende Psychologie ersetzt den rohen Evolutionsgedanken durch den individualisierenden Blick auf die persönliche Geschichte des Kranken. Mentale Gesundheit und Geisteskrankheit stellen dabei verschiedene Weisen dar, sich zur grundsätzlich unhintergehbaren “Negativität” – zur Nichtfestgestelltheit und Nichtfeststellbarkeit des Menschen (Nietzsche), zu dessen exzentrischer Positionalität sowie zur Endlichkeit des Daseins in ein Verhältnis zu setzen. Verstehende Psychologie begreift die Geisteskrankheit nicht als Normverletzung, sondern umgekehrt die Normdefinition als Hinweis auf das Selbstverständnis einer Gesellschaft, die in dem Kranken, den sie verjagt oder einsperrt, nicht sich selbst erkennen will. (Alle Zitate aus: Foucault, Psychologie und Geisteskrankheit)
Der Weg führt Foucault, ganz im Sinne der Binswanger’schen Daseinsanalyse, auf das konkrete In-der-Welt-Sein des Kranken. Sie fragt: Wie erlebt ein bestimmter Mensch seine eigene Krankheit. Wie erfährt er seine Welt, die Zeit, die Mitmenschen? Wie stellt sich ihm sein Körper dar? Es besteht “zwischen dem normalen und dem pathologischen Seelenleben eine durch den Begriff der Persönlichkeit gestiftete Kontinuität: So tiefgreifend der Zerfall auch sein mag, so kann doch die Persönlichkeit niemals verschwinden. Der Patient mag noch so krank sein, diese Kohärenz bleibt unfehlbar vorhanden.” Auch das pathologische Subjekt besitzt bei allem Realitätsverlust einen intentionalen Bezug zur Weltlichkeit. Binswanger betonte, daß, wenn der Wahnkranke auch in einer anderen Welt lebt als die anderen, er doch in einer Welt lebt. Für den Kranken gilt wie für den Normalen, daß er Welt entwirft. Foucault ergänzt diese Einsicht um die Dimension des pathologischen Selbstbezugs. Es sei nämlich “sicher nichts so falsch wie der Mythus von der Krankheit, die nichts von sich weiß; der Abstand zwischen dem Bewußtsein des Arztes und dem des Kranken ermißt sich nicht am Abstand zwischen Kenntnis und Unkenntnis der Krankheit.” Der psychisch Kranke habe stets ein latentes Bewußtsein von seiner Pathologie, in der Form jedoch, daß er “sein Übel nie aus dem Blickpunkt des Arztes, d.h. niemals aus einer distanzierten, von der Krankheit selber nicht bereits erfaßten objektiven Perspektive heraus zu betrachten vermag.” Das kranke Bewußtsein entfaltet sich immer mit einer für es doppelten Beziehung, auf das Normale und das Pathologische oder auf das Einzelne und das Allgemeine, so daß der Reflexionsaufwand und die Reflexionsleistung größer und nicht geringer ist, als die Normalen.
Foucault plädiert dafür, die psychologischen Strukturen der geistig gestörten Persönlichkeit nicht durch ein von außen angelegtes Kategoriensystem zu filtern, sondern sie aus der Art, wie ein Kranker seine Krankheit annimmt oder ablehnt, wie er sie interpretiert und ihren Formen Bedeutung gibt, als eine wesentliche Dimension der Krankheit selbst zu bestimmen. Die psychische Krankheit muß als rein funktionelle Desorganisation des seelischen Strukturzusammenhangs gesehen werden, welche in Ausnahmezuständen durchaus auch das normale Bewußtsein betreffen kann. Nur so ist es möglich, der Krankheit wie der Normalität die Aura einer natürlichen Essenz zu nehmen und sie als ein psycho-biographisches Ereignis im Leben des Individuums zu verstehen. Nur so läßt sich in der Absurdität pathologischer Verhaltensweisen eine eigenwillige, gewissermaßen kreative Rationalität entdecken, die mit der Logik der normalen Entwicklung wenn schon nicht übereinstimmt, so doch zu vergleichen ist.”
Das zentrale Strukturmoment, um das die psychische Krankheit kreist, ist die Angst. Der Hysteriker verdrängt seine Angst und löscht sie, indem er sie in sein Körperschema inkarniert und in somatischen Störungen als etwas Handhabbares erträgt. Zugleich sucht er seine sozialen Umstände, seine Lebensform so einzurichten, daß Gelegenheiten für Angst-Auslösung minimiert sind, wodurch sich die eigentliche Problematik auch auf die Beziehungen belastend auswirkt. Der Betreffende lebt mit dem, was er als relativ handhabbar in Kauf nehmen muß. Während der Mensch im Normalfall ambivalente Erfahrungen in ihrer Zweideutigkeit stehen lassen kann, ohne sie beseitigen zu müssen und sie so restlos erledigen zu müssen, vermag das Bewußtsein in der Krise dies nicht. Dem Normalbewußtsein ist es möglich, sich gegenüber der Angst, die mit einer Konfliktsituation verbunden ist, jederzeit zu distanzieren, um diese geschichtlich werden zu lassen. Dieses Geschichtlich-werdenlassen-können wird in der Krise aufgelöst. Das Abgehakte ist niemals endgültig abgehakt, wird immer wieder virulent. Das Bewußtsein sieht sich den Widersprüchen letztlich wehrlos ausgesetzt. Es vermag die Integration von Gegenwart und Vergangenheit in eine konfliktlose Einheit nicht mehr zu leisten. Es erfährt das Geleistete nicht als Kapital, das man ansammeln und auf das man zurückgreifen kann, es erfährt die Probleme lediglich als angestaut. Die normalerweise integrierten Verhaltensweisen werden freigesetzt, und komplexe Koordinationsleistungen werden von archaischen Formen des Verhaltens überlagert. Pathologisches Verhalten läßt sich so in Anlehnung an Freud als regressiv bezeichnen. Im Unterschied zu Freud muß man Regression jedoch nicht substanziell verstehen, sondern als beschreibenden Terminus. Zu sagen, daß der Mensch, wenn er erkrankt, wieder zum Kind werde, ist fraglich. Besser wäre zu sagen – im Sinne der neutralen Beschreibung - daß der Kranke in seiner Krise oder aufgrund seiner Persönlichkeitsstörung segmentäre Verhaltensweisen zeigt, analog zu denjenigen einer jüngeren Altersstufe oder einer anderen Kultur.
Die Desintegration der pathologischen Welt weist keine Anzeichen für einen Ausfall normaler Leistungen auf. Sie deutet vielmehr auf eine vom Normalbewußtsein bloß graduell verschiedene Weise der Reduktion von Komplexität hin. Die damit einhergehende Errichtung eines Systems archaischer, elementarer oder ritueller Formen der Erfahrung, die in gewissem Grade auch der normalen Habitualisierung, Dogmatisierung und Automatisierung zugrundeliegen, dient beim Kranken einem ganz und gar idiosynkratischen Ziel: nämlich dem ohnmächtigen Bestreben, die mit den Virtualitäten des Daseins verknüpfte Angst restlos zunichte zu machen, sowie die Ambivalenzen, welche aus der horizontalen Struktur des Bewußtseins zwangsläufig entspringen, vollständig außer Kraft zu setzen. Die Zeit verliert ihren normalen Richtungscharakter und steht still (wie auf den Bildern di Chiricos). Die reine Gegenwart, in deren Entfaltung der Kranke der Ambivalenz, d.h. der Vorläufigkeit des Seins, zu entgehen trachtet, wird zum Kristallisationspunkt aller Tätigkeiten. Doch diese ist zugleich ein ausdehnungsloser Punkt, an dem sich lediglich die aufgestauten Objekte des kranken Bewußtseins zu sammeln vermögen. (vgl. Bergsons Begriff der gelebten Zeit und der temps vécu bei Proust)
Die Krankheit läuft nach Art eines circulus vitiosus ab: Der Kranke schützt sich durch seine aktuellen Abwehrmechanismen gegen eine Vergangenheit, deren heimliche Gegenwart die Angst aufsteigen läßt; andererseits schützt sich das Subjekt gegen die Eventualitäten einer gegenwärtigen Angst dadurch, daß es auf die ehemals im Verlauf ähnlicher Situationen eingesetzten Schutzmaßnahmen rekurriert. Jedes Individuum hat schon Angst erlebt und Abwehrmechanismen errichtet, aber der Kranke erlebt seine Angst und seine Abwehrmechanismen in einem Kreislauf, der ihn veranlaßt, sich mit eben jenen Mechanismen gegen die Angst zu wehren, die historisch an sie gebunden sind. Im Gegensatz zur Geschichte des normalen Individuums ist diese Monotonie des Kreislaufs der Grundzug der pathologischen Geschichte. Die Angst ist nicht nur akzidentelles Merkmal der Krankheit, nicht nur äußerliches Symptom, sondern sie fungiert als Prinzip und als Grund der Geschichte, als Apriori der (pathologischen) Existenz. Jede Krankheit “ist zugleich Rückzug in die schlimmste Subjektivität und Sturz in die schlimmste Objektivität”.
In dieser Verdoppelung liegt der Knotenpunkt psychischer Abnormität. Diese Doppelheit ist allerdings die Paradoxie, die Husserl für konstitutiv für die moderne Subjektivität hielt, indem er von gleichzeitigem Objektsein in der Welt und Subjektsein für die Welt sprach. Und Sartre hatte darauf bestanden, daß auch das Normalbewußtsein ein Für-Sich ist, das vergeblich versucht, Ursache seiner selbst zu sein. Waldenfels bezeichnet sogar den Prozeß, in dessen Verlauf sich die Fähigkeit zur Wahrnehmung der Fremdheit der Welt einschränkt, als Normalisierung. Demnach wäre ausgerechnet der Kranke der normalisierte Mensch schlechthin. (vgl. Thomas Rolf, Normalität. Fink Vlg. München 1999, S. 264)
„Alle Geschichten der Psychiatrie haben im Narren des Mittelalters und der Renaissance den im engen Netz religiöser und magischer Bedeutungen gefangenen verkannten Kranken darstellen wollen.” Die Psychologie versucht ihre eigenen kontingenten Anfänge zu verschleiern. u.a. dadurch, daß sie traditionelle Praktiken der gesellschaftlichen Integration des Wahnsinns, also die polymorphen Einstellungen zum Wahnsinn in den noch unpsychologischen Epochen des Mittelalters sowie der Renaissance als naive Vorstufen von Psychologie betrachtet, um dann feststellen zu können, daß in ihnen das eigentlich Krankhafte des Wahnsinns durchgängig verkannt worden sei.
Man begeht den Fehler, Krankheit lediglich als eine Abweichung von einer gesellschaftlich definierten Norm, d.h. als etwas Negatives zu betrachten und völlig außer acht zu lassen, daß sich “eine Gesellschaft in den Geisteskrankheiten, die ihre Mitglieder aufweisen, positiv ausdrückt, gleichviel, welchen Status sie diesen krankhaften Formen verleiht; ob sie sie nun ins Zentrum ihres religiösen Lebens stellt, wie das bei Primitiven häufig der Fall ist, oder ob sie versucht, sie auszubürgern, wie es in unserer Kultur geschieht.” Wenn man die Abweichung und den Abstand von der Norm zur eigentlichen Natur der Krankheit gemacht hat, so ist der Grund dafür in der Kulturillusion zu suchen. Unsere Gesellschaft will in dem Kranken, den sie verjagt oder einsperrt, sich nicht selbst erkennen; sobald sie den Kranken diagnostiziert hat, schließt sie den Kranken aus.” Einerseits wird der psychologische Diskurs über Geisteskrankheiten immer beredter, auf der anderen Seite gerät der Wahnsinn in seiner ursprünglichen Heterogenität immer stärker in die Nähe der Sprachlosigkeit, und sein Drängen, aus dieser Stummheit herauszugelangen, führt lediglich zu immer neuen Formen der Knebelung. (Normalität, S. 270ff.)
Dienstag, 29. März 2011