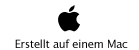die Nacht der Welt
So wie es mir beim Lesen eines Romans geht, daß das Universum, das ich mir aus den Informationen konstruiere, voller Löcher ist, von denen ich annehme, daß sie sich im Laufe des Weiterlesens schließen werden, indem ich Garfinkels Etcetera-Regel anwende, so ist es, wie Slavoj Zizek nahelegt, wohl auch mit der Realität, das eigene Leben eingeschlossen. In beiden Fällen vernähen einzelne Wörter und Sätze mit ihrer Mehrdeutigkeit jene Löcher, bei denen ich auf das Nachfragen verzichte. Zizek gibt folgende Beispiele zur Veranschaulichung (Tücke des Subjekts). Man wird den Autor eines Sherlock-Holmes-Romans nicht fragen wollen, wieviele Bücher in Holmes Bücherregal stehen. Ebensowenig wird man den leeren Signifikanten, der die ontologische Lücke verbergen muß, überprüfen wollen, auch wenn man von dieser Lücke weiß. Zwischen der symbolisch vermittelten, ontologisch konstituierten Realität und dem sich entziehenden präontologischen Realen besteht eine Kluft. Dessen gespenstische Dimension kennen wir aus den Filmen von David Lynch, der nach Mitteln gesucht hat, sie darzustellen, mit close-ups von Dingen, die in der Vergrößerung vollkommen fremd aussehen, mit unheimlichen, nicht verortbaren Klängen, mit undekodierbarer Symbolik. Die unverständlichen Flüsterlaute des Weltraumherrschers in „Dune“ müssen durch Mikrophone in artikulierte Worte übersetzt werden, durch das Medium des großen Anderen. In „Twin Peaks“ wird das „Murmeln des Realen“, aus dem Mund eines Zwerges, durch Untertitel übersetzt.
Zwischen dem Ereignis an sich und seiner symbolischen Registrierung gibt es eine Lücke, eine zeitliche Verzögerung. In Komödien nimmt das Opfer eines Schwindels, eines Mißgeschicks oder einer Überraschung das Ereignis zunächst ganz ruhig hin. Im double-take, nach einer minimalen Zeitverzögerung, erzittert das Opfer plötzlich. Die Comic-Figur bleibt eine Weile in der Luft schweben, bevor sie begreift, daß sie bereits fällt. Die Quantenphysik trägt dieser Lücke Rechnung, indem für sie eine Ereignis nur dann gegenwärtig wird, wenn es in einer Umgebung registriert wird, indem die Umgebung dieses Ereignis wahrnimmt. Die prinzipielle Ungenauigkeit der Messungen ist Teil des Dings-an-sich.
obwohl das Moment des Dings-an-sich nicht wirklich existiert, kann es und muß es doch gedacht werden können, um das Subjekt denken zu können. Nicht zuletzt darin liegt dessen Tücke. Gleichwohl dürfen wir uns dem präontologischen Zustand nur mit äußerster Vorsicht nähern. Er zeigt sich nur als Verschwindener. Das prälogische Reale, der sich entziehende Grund der Vernunft, kann niemals als solcher erfaßt werden, sondern ist etwas, das nur in der Geste seines Sich-Zurückziehens flüchtig erblickt werden kann. Er ist in Hegels Worten der Raum der „Nacht der Welt“, in dem hier und da Gespenster auftauchen, „dann ein blutiger Kopf“ hervorschießt, „dort eine andere weiße Gestalt plötzlich“ erscheint und verschwindet. In dem Moment, „da der Mensch erkannte, daß das, was wir als objektive Realität erfahren, nicht bloß da draußen gegeben ist und darauf wartet, von dem Subjekt wahrgenommen zu werden, sondern ein künstlich Zusammengesetztes ist, das durch aktive Beteiligung des Subjets
konstruiert wird“, durch die Anverwandlung der Natur und den Akt der transzendenten Synthesis, „stellt sich die Frage nach dem Status dessen, was diesem transzendentalen Akt vorausgeht“ (Zizek).
Auf der Ebene des Sprechens kann man sich ein Sprechen an-sich denken, vor jeder symbolischen Registrierung. Freilich muß man sich hüten, dieses Protosprechen zu ontologisieren, als würde es als vollständig ausgebildete Sprache existieren, etwa als body-language oder Sprache der Liebe. Wenn man annimmt, bei Liebenden sei, noch bevor das erste Wort gefallen ist, alles schon entschieden, aufgrund von verräterischen Gesten, versteckten Andeutungen, Körpersprache und Blickwechsel, dann muß man bedenken, daß dieses wortlose Sprechen nur im Rückblick existiert, nachdem es in Worte gefaßt wurde. Jenes wortlose Sprechen ging lediglich mit Bedeutung schwanger, wie man im Rückblick gern sagt. Zizek zitiert Bertrand Russel: „Ich wußte nicht, daß ich Dich liebe, bis ich es mich Dir sagen hörte.“ die Zeitlichkeit dieses „Sprechens ist die des futur antérieur: ich werde in dich verliebt gewesen sein.
Das Subjekt unterhält eine Beziehung zu einem anderen Subjekt, das noch nicht richtig subjektiviert ist, der als extremer Fremdkörper unser Nächster ist, als der Ungeheure, der Unheimliche. Es ist der Prozeß der Ödipalisierung, der den Prozeß dieser ungeheuren Andersheit aufwerten soll, in der Verwandlung in einen erwachsenen Partner, wogegen Deleuze opponiert. Auf dem Null-Niveau gibt es nur die reine Leere der Subjektivität, die einer Mannigfaltigkeit von Partialobjekten konfrontiert ist, Verkörperungen der untoten Objekt-Libido. Um dieses Pandämonium nicht zu ontologisieren, könnte man sagen, es ist nicht das Reale selbst, sondern „der unmögliche Augenblick der Geburt der Subjektivität“, die Kontraktion des in Entstehen begriffenen Subjekts. Das ungeheure Reale, das jeder sich selbst setzenden Vernunft vorausgeht, ist nicht das Chaos oder das Noumenale, sondern der urprüngliche Raum der wilden, präsynthetischen Einbildungskraft, Spontanität in Reinform, ohne Unterordnung unter irgendein selbst auferlegtes Gesetz. Dieser Bereich ist etwas, das in der Kunst nach der Renaissance von Hiernonymus Bosch bis zu den Surrealisten anschaulich erscheint.
Er geht der imaginären Identifkation als Ich-bildend voraus. Der Übergang von der Animalität zum Menschen geht nicht nahtlos, sondern erfolgt durch einen Bruch. Zwischen der unmittelbaren Animalität des in seine ökologische Nische hineingeborenen Tieres und der menschlichen Freiheit gibt es einen Moment, in dem das Ungeheuerliche der präsynthetischen Einbildungskraft Amok läuft und gespenstische Erscheinungen von Partialobjekten hervorbringt, eine Welt, in der das Subjekt sich als unmögliche Formen wahrnimmt, in deren Gestalt sich das Subjekt als absolute Spontanität sich selbst unter Objekten begegnet.
Lacan spricht vom Phantasma und vom „Durchqueren dieses Phantasmas“. Leicht wird dies mißverstanden, auf dieselbe Weise, wie man Goyas berühmtes Blatt aus den Capriccios über die Schrecken des Krieges „der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer“ gern mißversteht: als „Aufruf, das Phantasma loszuwerden, all die illusorischen Vorurteile und Falschwahrnehmungen, die unsere Sicht auf die Realität trüben, um endlich zu lernen, mit der Realität zu leben, so wie sie ist. Im Durchqueren des Phantasmas lernen wir nicht, unsere phantasmatische Produktion zurückzuhalten, die Produkte unserer Phantasie hinter uns zu lassen, sondern wir identifizieren uns gründlicher mit dem Werk unserer Einbildungskraft in all seiner Inkonsistenz, noch vor seiner Transformation in den phantastischen Rahmen, der unseren Zugang zur Realität gewährleistet.“ (Zizek 75)
Der Bereich der wilden, präsynthetischen Einbildungskraft, Spontanität in Reinform, der vorontologischen untoten Erscheinungen, wie sie auf spektakulärste Weise die Bilder eines Hieronymus Bosch bevölkern, sind nicht mehr der Untergrund, der Ausbund der unteren Schichten des Kosmos, sondern etwas im strengen Sinne Akosmisches, Antikosmisches, etwas subjektives, Teil der Selbstreflexion des Menschen als Subjekt. Wie Kants Philosophie untergraben diese Bilder den Begriff des Kosmos als eines ganzen des Universums, als einer bedeutungsreichen, hermeneutischen Totalität, gerade in dem sie ihn noch einmal beschwören. Wenn der phantasmatische Rahmen sich auflöst, als der der alte Kosmos den Individuen diente, unterliegt das Subjekt einem Realitätsverlust und beginnt, die Realität als ein irreales, alptraumhaftes Universum ohne sichere ontologische Fundierung wahrzunehmen. Dieses Pandämonium ist nicht bloße Phantasie, sondern das, was von der Realität übrigbleibt, wenn ihr die Stütze der Phantasie entzogen wurde. Was wir sehen, ist nicht mehr die Kluft zwischen der transzendental konstituierten phänomenalen Realität und dem transzendeten noumenalen Bereich, sondern das Verschwinden des Vermittlers oder das Noch-nicht-Trittgefaßthaben des Subjekts. Das Subjekt muß sich im Zustand des Noch-nicht-Subjekt-Seins selbst als Subjekt setzen. Dabei macht es Bekanntschaft mit sich selbst als etwas, das, indem es sich konstituiert, Gespenster und Monstren hervorbringt, das aus ungeheuren Formen von Partialtrieben und herumfliegenden kopflosen Organen besteht. Dessen kann es nur allmählich und nur unter Schmerzen und Alpträumen innewerden. Es geht aber, um dies noch einmal zu betonen, nicht um das Vorhandensein einer Urwelt, sondern um einen Konstitutionsprozeß, der gerade beginnt, um eine Art Urknall der Psyche. Ursprung oder Auslöser ist ein Fremdkörper in uns selbst, der die narzißtische Balance stört und in einem Prozeß der schrittweisen Ausstoßung und Strukturierung dieser inneren, verhakten Schwierigkeiten in Gang setzt, um den vertrackten Prozeß, in dem das in Gang gesetzt wird, was wir dann als externe, objektive Realität erfahren. Dies gilt auf ontogentischer genauso wie auf philogenetischer Ebene. Lacan besteht darauf, daß Psychoanalyse Erkenntnistheorie sein muß und umgekehrt. Die dritte Ebene, auf der dieser Konstitutionsprozeß stattfindet, ist der des Erschaffens eines Kunstwerks. Als Künstler bin ich selbst ein Loch im Universum.
Ich kann mich mir selbst als Lücke auch von anderer Seite her nähern. Wenn die Verständigung in der zwischenmenschlichen Realität mißlingt, haben wir immer noch den inneren Monolog, im Sinne jenes leeren großen Anderen, der anwesend ist und uns zuhört, an den wir unsere Klagen in gebetartigen Anrufen richten, von dem wir uns unser Eigenlob zurückspiegeln lassen können, oder im Schreiben, im Tagebuch oder im Roman, das uns helfen kann, unsere Gedanken ohne ein reales Gegenüber zu klären, indem wir ihnen Form geben, und es gibt die Schmährede, die wir in den Raum hinausschreien, egal, ob sie der eigentliche Adressat hört und auf sich bezieht oder nicht. Was aber ist, wenn auch dies wegfällt. Lacan spricht von einem Zustand der totalen Abwesenheit jeder Möglichkeit des Dialogs, von einem total bedeutungslosen Sprechen, das keinerlei Intersubjektivität mehr beinhaltet, le pas de dialogue..., le apparole, von Sprache als ein in sich selbst eingeschlossener Kreislauf. Er existiert ohne Realität. Das Reale ist die Unmöglichkeit. Man denkt dabei an das fröhliche asexuelle Gebrabbel der Irren ohne irgendeine traumatische Grenze. Die Interpretation ist das, was dieses Gebrabbel herunterholen muß, um dem unmöglichen Realen erneut gegenüberzutreten. Komm mal wieder runter: Das ist die Geste, die dem hemmungslosen Spiel eine Grenze setzt. Was da freigesetzt wird, zwingt zur Annahme eines primären Narzißmus, der vor der Einführung des symbolischen Gesetzes besteht, vorstellbar im Bild der sich selbst küssenden Lippen. Aber dieses Davor ist kein stabiler Zustand, den es gibt, sondern ein ontologischer Urknall, ein Vorgang, in dem die frei flottierende Vielzahl der gespenstischen und monströsen Partialobjekte freigesetzt wird.
Mittwoch, 24. August 2011