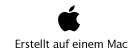Wollknäuel etc
Über einige immer wiederkehrende Gegenstände in Marion Bataillards Bildern:
umgekippte Schemel, Bälle, die auch Wollknäuel sein könnten, an den Wänden lehnende Besen oder Harken, Bettdecken, Stoffzipfel, wie zu Präsentiertellern oder Peepshow-Bühnen geschnittene Rasenstücke, Dinge, die vom Tisch rutschen, eine Plastiktüte, die sich im Fallen aufbläht, ... Sie wirken so lebendig wie die dargestellten Personen, die ihrerseits so gegenständlich wirken, wie die Gegenstände. Ich möchte diese Gegenstände Übergangsobjekte nennen. Kinder, die in Übergangsräumen leben, gehen mit solchen Übergangsobjekten um. Wenn das Verhältnis, in dem Kinder zu Erwachsenen stehen, Übertragung genannt werden kann insofern, als sie den Erwachsenen - mit einigem Recht, aber unabhängig von einer Überprüfung - unterstellen, mehr zu wissen und mächtiger zu sein als sie selber, dann pflegen Künstler ein ebensolches Verhältnis zum imaginären Betrachter ihrer Bilder und gehen auch sie mit Übergangsobjekten um, indem sie sie malen. Gemalte Bilder geben die Wirklichkeit wieder und sind zugleich proben seelischer Wirklichkeit, ohne daß dies ein Widerspruch wäre. Die Bilder konstituieren ein Reich der Illusion, einen intermediären Raum der Erfahrung, der unbefragt bleiben darf bezüglich der Zugehörigkeit zur inneren oder äußeren Realität. So wie wir das Kind nicht fragen, ob sein Übergangsobjekt, zum Beispiel sein Stoffteddybär, seine eigene Hervorbringung ist oder ob es ihm von jemandem gegeben wurde, fragen wir gegenüber der in Malereien dargestellten Wirklichkeit nicht nach der “Realität”. Bilder dokumentieren die Phase zwischen Erschaffung und Losgelöstheit vom Schöpfer als Objekte. Die Verschmelzung mit der phantasierten Stärke des imaginierten Betrachters ermöglicht dem Maler die Entwicklung einer haltenden Umwelt, einer Art Container, der dem Maler die nötige Sicherheit verleiht, die er braucht, um Affekte auszudrücken, die er sonst als zu bedrohlich empfinden würde, bedrohlich für sich wie für andere. So wie das Kind sich an ein Bettzipfel oder an ein Wäschestück der Mutter hält, die sie in ihre eigene Körpersphäre hereinzieht, die es affektiv besetzt, und die als Gegenleistung einem taktil-haptischen und olfaktorischen Kontakt beruhigend wirken, so hält sich der Künstler an bevorzugte Sujets und innerhalb der Sujets an ein Set fetischhafter Dinge. Diese Dinge siedeln auf der Grenze zwischen Symbiose und Individuation. Sie bilden eine Brücke zwischen intrapsychischer Welt und extrapsychischer Objektwelt. Sie haben eine zeitliche Dimension insofern, als sie den Übergang ins Erwachsensein oder in die Autonomie der vom Betrachter unabhängig konsistenten Bildwelt erleichtern und diesen Übergang zugleich markieren. Die eigene Räumlichkeit dieser fetischisierten Dinge und der imaginierten Betrachter ist eine andere als der Raum, in dem sich das Bild und der Betrachter tatsächlich befinden. Er ist ein Zwischenreich von Erfahrungen, zu denen innere Realität und Außenwelt gleichermaßen ihren Beitrag leisten. Dieses “Zwischen”, wie der Strand zwischen Land und Meer, resultiert daraus, daß diese Objekte nicht mehr Teil des Körpers des Malers sind, aber auch noch nicht völlig als zur Außenwelt gehörig erkannt werden. So wie der Teddybär des Kindes etwas ist, das Phyllis Greenacre nannte “the first not-me object”, aber “never totally not-me”. Das Kind schützt sich mit Hilfe dieser Übergangsobjekte vor der Überflutung durch Trennungsängste, aber auch vor seiner sadistischen Wut (auf die Mutter). Das Übergangsobjekt hat den gleichen Stellenwert wie die Garnspule oder das Wollknäuel in den Märchen. Es wird zum Element einer vom Kind dirigierten Szene; diese bedeutet etwas, ohne daß die Bedeutung sich schon vom materialen Arrangement gelöst hätte. Die Spule ist nicht nur ein Objekt, sie hat eine mimetische Darstellungsfunktion. Sie performiert die Trennungsangst von der Mutter, deren An- und Ab- und Wieder-Anwesenheit vom Kind szenisch bewältigt wird. Sie dient dazu, spielerisch und im Schutze der Bindung das Verlassenwerden als etwas überlebbares zu phantasieren und zugleich das Weggehen zu lernen. Die Spule, die das Kind rollen läßt, aber am Faden behält und wieder zu sich heranziehen kann, symbolisiert das Weggehen und freihändige Stehen als eine mit Sehnsucht und Todesangst und Angstlust zugleich verbundene Aufgabe. Die Spule ist sowohl stressvermindernd als auch lustvoll und stärkend. Die notorisch auftretenden Dinge in Marions Bildern sind so gesehen Beschwichtiger der Angst und Hüter vor Desintegration, und insoweit, als sie das Beschützen und Bestärken leisten, sind sie zugleich Objekte von sexueller Lust und Befriedigung. Als “subjektive Objekte” sind sie ganz in die Verfügung des Ich gebracht (Liebe und Gewalt) und doch andererseits magisch animiert und mit schützenden Kräften ausgestattet, die woanders herkommen, die ihr von einer Zauberin oder Fee verliehen werden, auf die man sich jedoch, wie auf die Fee mit den blauen haaren im „Pinocchio“, nicht verlassen kann. Es gehört zuweilen auch zu ihren Aufgaben, garstig und unberechenbar zu sein und zu helfen, indem sie nicht helfen, ähnlich den Gehilfen bei Kafka. jene Übergangsobjekte sind wie in den Märchen nicht bloß Gedächtnisspeicher, sondern verkörperte Erinnerung, Elemente eines archaischen Gedächtnistheaters, das immer wieder rituelle Szenen von Allmacht und Ohnmacht, von lustvollem Genießen und Wut, von Verschmelzung und Verlassenheit, von Urvertrauen und Enttäuschung, Stolz und Schwindel, von Trennung und Angst aufführt. In Gestalt dieser Dinge ist die Bildwelt noch mit der Phantasie des Malers verbunden. Die Auseinandersetzung mit der Differenz von Ich und Nicht-Ich, mit der Selbständigkeit der Objekte (die kommen und gehen), mit Gegenwart und Abwesenheit, die sich in jeder Bilderschaffung wiederholt, steht wahrscheinlich parallel zum Erwerb sprachlicher Zeichen. Auf Sprache übertragen hieße das, Begriffe sind nicht zur Fixierung der Bedeutung und Funktion da, sondern zu ihrer Auflösung. Sie dienen nicht dem Aufsuchen und Festhalten von Bedeutung, sondern dazu, sie verlassen und umschmeißen zu können. Bei Nietzsche gewinnen jene Übergangsobjekte, Bälle und Wollknäuel, eine ähnliche Bedeutung. Er machte für die Zeit nach dem Tode Gottes einen Formulierungsvorschlag für einen neuen kategorischen Imperativ: Sei selbst ein Neubeginn aus eigenen Kräften! Sei ein originales Spiel, das sich selber spielt, sei „ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-Sagen!“ Das ‚Ja’ zu sich selbst zeichnet den Umriß des Lebensraumes des Bejahenden, in Anerkennung der Tatsache, daß keine Selbstbejahungssphäre allumfassend sein kann, und daß es für andere, die sich selbst wollen, stets genug Raum geben wird, wenn auch nicht an derselben Stelle. Jedes lokale Ja schwebt in einem Raum aus vielen anderen analogen begrenzten Selbstaffirmationen. „...wer das Ich heil und heilig spricht und die Selbstsucht selig...“ Wenn der Raum dieser bedingten Freigabe der Egoismen jeweils nur ein kleiner Raum sein wird, darf man sich nicht wundern. Aber der Mensch von heute muß seine Wohnung ja nicht mehr mit dem Kosmos gleichsetzen. Weltordnung und Lebensstil sind auseinander getreten. Jeder Weltoffenheit entspricht eine Weltabwendung, jedem Wissensdrang ein Redundanzbedürfnis, jeder Neugier eine Ignoranz. Zu dem Ja zu sich selbst gehört auch das Grundrecht auf Nichtbeachtung der Außenwelt, im Sinne einer guten Limitierung mit dem Ziel des Wohlseins.
Montag, 2. April 2012