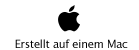Lowlife Mythodology
Dem Film ist ein Zitat von Guy Debord vorangestellt. Es lautet aus der Erinnerung sinngemäß etwa so: Die Medien zerstückeln das Leben und setzen die Teile neu zusammen zu etwas anderem, zu einem Strom, der wie das Leben aussieht und den wir für das Leben halten, während wir uns zugleich von dem Leben selbst entfremden. Die von den Medien produzierten Bilder haben die Eigenschaft, daß wir uns in ihnen repräsentiert sehen wollen und müssen, so daß wir am Ende gar nicht mehr wissen, daß es neben dem Medien-Strom ein wirkliches Leben gibt. Das Leben ist ersetzt durch das Spektakel. Debord schließt mit seiner Theorie des Spektakels an Rousseaus Medientheorie an, derzufolge die an ein Publikum adressierten Künste. allen voran das Theater, dafür sorgen, daß sich zwischen die Menschen in ihren face-to-face-Interaktionen etwas schiebt, das diese in Darsteller und Publikum zerteilt und von sich selbst entfremdet. Indem wir lernen, uns dafür zu interessieren, was andere über uns denken und uns nach den vermeintlichen Erwartungen der anderen an uns zu richten, anstatt auf uns selbst zu hören, verlernen wir, auf uns selbst zu hören und mit dem anderen unvermittelt zu interagieren. wir wollen immer wissen, wie der andere über uns denkt, was die anderen von mir halten, was sie von mir erwarten, statt zu fragen, was wir selber sind und selber wollen. Der Film mit dem Titel „Lowlife Mythology“ setzt die situationistisch-rousseauistische Diagnose in Beziehung zu der linguistischen Psychoanalyse-Version Lacans, derzufolge wir uns vor allem fragen, was man von uns will: Que vuoi? Für Lacan ist die Hauptfrage, mit der in die Welt kommen und mit der wir in der Welt sind: Was will der andere von mir. Die Lacan’sche Frage verbindet sich mit der Frage: Wie sieht mich der andere, wobei ich hoffe, er möge mich so sehen, wie ich mich selber sehe. Und wir tun alles, um die dinge dahinzulenken oder uns zumindest selber einzureden, daß es so sei. Die Medien helfen uns dabei. Die Personen des Films, die sich mit der Herstellung von Filmen beschäftigen, verfügen über die Mittel, sich mit dieser Illusion zu versorgen. Einer der Akteure sagt einmal etwas in der Art: Je länger und intensiver ich mich einer anderen Person zuwende, desto mehr glaube ich, daß sie mich spiegelt. Die Filme der Protagonisten repetieren das Geschehen des Vortages aus der Sicht des jeweilig relevanten Interaktionspartners in der Weise, daß der Autor des Films sich im anderen gespiegelt sieht. Diese Strategie der Selbstvergewisserung birgt freilich die Gefahr, nicht mehr wissen zu können, ob man noch die Wirklichkeit der anderen teilt oder möglicherweise verrückt geworden ist, da der andere als eigenständige Person und Kontrollinstanz ausfällt, weginszeniert wurde.
Im Abspann war zu lesen, das Drehbuch beruhe auf einem Roman von Pierre Menard mit dem Titel 'Nous, Maintenant, et la Lune n'existe pas' aus dem Jahre 1942. Der Name läßt aufhorchen. Er läßt einen an den fiktiven Autor denken, den Borges erfand und der ihm zufolge der eigentliche Autor des „Don Quijote“ sei. Wenn es noch einen anderen Pierre Menard geben sollte (außer dem über Städtebau in Frankreich schreibenden Stadtsoziologen gleichen Namens), einen also, der Romane schreibt, dann hab ich ihn nicht gefunden, so daß ich zu der Annahme neige, jener Roman, der angeblich als Vorlage diente, sei vom Regisseur erfunden, ein weiteres, von Borges noch nicht erwähntes Werk des erfundenen Autors.
Privilegiert durch den Zugang zu dessen privatem Archiv, kann der Ich-Erzähler des Textes von Borges “das sichtbare Werk” Pierre Menards, des “Symbolisten aus Nîmes” auflisten. Es handelt sich um ein Konvolut unterschiedlichster Text-Sorten. Es gibt Monographien über Fachaufsätze (“Ein technischer Artikel über die Möglichkeit, das Schachspiel zu bereichern, indem man einen Turmbauern ausscheidet.”), ferner “Skizzenblätter”, eine “eindringliche” Syntax-Analyse, Übertragungen, eine “Invektive gegen Paul Valéry”, welche indes interessanterweise “die genaue Kehrseite seiner wirklichen Meinung über Paul Valéry” zum Ausdruck bringt; schließlich ein auf 1934 datierter Sonett-Zyklus, und als Höhepunkt des evidenten Menardschen Werkes bemerkenswerte Vers-Dichtungen, “die ihre Wirkung der Interpunktion verdanken.” Das eigentliche Interesse des Erzählers aber gilt “dem unterirdischen, dem unbezeichenbar heroischen, dem beispiellosen” Schaffen eines Cervantes-Epigonen.
Jorge Luis Borges verrät drei Jahrhunderte nach Cervantes in einem „fiktiven Nachruf” auf jenen Menard, daß nicht Cide Hamete Benengeli, nicht der Protagonist selbst und schließlich auch nicht Miguel de Cervantes allein “den Quijote” verfaßte, sondern jener Pierre Menard die Kapitel 9 und 38 sowie, fragmentarisch, das Kapitel 22 des ersten Teils des Don Quijote geschrieben habe. „Er wollte nicht einen anderen Quijote verfassen, was leicht wäre, sondern den Quijote. Unnütz hinzuzufügen, daß er keine mechanische Übertragung des Originals ins Auge faßte; einer bloßen Kopie galt nicht sein Vorsatz. Sein bewundernswerter Ehrgeiz war vielmehr darauf gerichtet, ein paar Seiten hervorzubringen, die Wort für Wort und Zeile für Zeile mit denen von Miguel de Cervantes übereinstimmen sollten.” Zunächst nämlich wollte er, dessen ‘Identität’ ja de facto erst in Jorge Luis Borges’ Fiktion gestiftet wird, in einem umfassenden psychischen Transformationsprozeß“ gründlich Spanisch lernen, den katholischen Glauben wiedererlangen, gegen die Mauren oder gegen die Türken kämpfen, die Geschichte Europas im Zeitraum zwischen 1602 und 1918 vergessen, Miguel de Cervantes sein.” Menard hoffte offenbar durch eine derartige Metamorphose von denselben Musen inspiriert zu werden, die einst Cervantes den Don-Quijote-Roman einflüsterten, oder er setzte auf die Magie eines raum-zeitlichen Quantensprungs und wollte mit der Identität des Cervantes dessen Talent und Technik absorbieren. Daß er von dieser ebenso gründlichen wie skurrilen Methode Abstand nahm, sie erschien ihm “als zu leicht” (!) hatte zur Folge, daß Menard “den autobiographischen Prolog zum Zweiten Teil des Don Quijote ausschied. Hätte er diesen Prolog aufgenommen, so hätte ihn das zur Erschaffung einer weiteren Person nämlich Cervantes genötigt [...].”
Pierre Menard reflektiert in einem Brief die schriftstellerische Leistung des Miguel de Cervantes Saavreda, die historische Bedeutung seiner Werke sowie die für ihn, Menard selbst, bei seinem innovativen Projekt aufgetretenen “Behinderungen sprachhandwerklichen Charakters”, welche er jedoch letztlich, so Borges Erzähler-Ich, überwunden habe – mit dem Ergebnis einer qualitativen Differenz des objektiv Ununterscheidbaren: “Der Text Menards und der Text Cervantes’ sind Wort für Wort identisch; doch ist der zweite nahezu unerschöpflich reicher. (Schillernder, werden seine Verlästerer sagen; aber die schillernde Zweideutigkeit ist ein Reichtum.) Es ist eine Offenbarung, hält man den Quijote Menards vergleichend neben den von Cervantes.”
Zwar räumt der Erzähler also ein, daß sein Freund letzten Endes nichts anderes geschrieben habe als Cervantes, aber gerade in der Begründung für diese Rückkehr zum Original auf dem Umweg über vorgeblich innovative stilistische Experimente sieht er die Bedeutung des neuen Textes, der mit dem alten identisch ist. Noch die detailversessenste editionsphilologische und komparatistische Forschung muß kapitulieren vor dem Versuch, an typographisch absolut identischen Passagen aus angeblich voneinander verschiedenen Werken irgendwelche beschreibbaren Unterschiede festmachen zu wollen – egal, wie sie entstanden sein mögen. Bilderreich und erkenntnisphilosophisch ambitioniert, führt die Erzählerinstanz dieses absurde Unterfangen exemplarisch durch. Abschließend kann sie so behaupten, Menard habe womöglich gar jenseits seiner eigenen Intention , “vermittels einer neuen Technik die abgestandene und rudimentäre Kunst des Lesens bereichert, nämlich durch die Technik des vorsätzlichen Anachronismus und der irrtümlichen Zuschreibungen.” Mit Borges können wir fragen: Was ist das nur für ein Buch, das es vielleicht gar nicht gibt oder das vielleicht geschrieben wurde von einem Autor, den es doch gar nicht gibt? Mit Cervantes konnten oder sollten wir uns bereits fragen: Was ist das nur für eine seltsame Figur, die es doch offensichtlich gar nicht gibt und die in einer ritterlichen Welt lebt, die es doch gar nicht mehr gibt?
Dem Text des „Don Quijote“, den der Leser vor sich hat, sind verschiedene fiktive Texte unterlegt, die von verschiedenen fiktiven Verfassern stammen. Der gelesene Text wird von einer Person erzählt, die sich „der 2. Verfasser“ nennt; dieser will die Informationen über seine Geschichte von anderen bezogen haben. Dieser „2. Verfasser“ kann „der Erzähler“ genannt werden. Er ist nicht identisch mit Cervantes (Erzähler und Autor sind nie identisch, da ersterer eine textimmanente Instanz ist), aber er ist auch nicht klar von ihm zu trennen, insofern Cervantes durch seinen Mund spricht (etwa, wenn er über seine Intentionen spricht). Eine Art Zwischenstellung nimmt der Vorredner ein: Er spricht als Cervantes, aber auch schon als Erzähler. Seine Beziehung zu Quijote changiert zwischen der Vorgabe, eine wahre Geschichte zu erzählen, und dem Hinweis darauf, sie erfunden zu haben. Dieser 2. Verfasser, der uns die Geschichte erzählt, gibt offenbar nicht einfach fremde Texte wieder. Er erzählt die Geschichte nach. Der Vorredner präsentiert sich als Erfinder der Gedichte auf Don Quijote. Der sogenannte „2. Verfasser“ bedient sich einer Übersetzung aufgefundener Quellen; Übersetzer ist der Moriske, eine fiktive Figur. Dieser Übersetzer äußert sich gelegentlich über seine Vorlage. Er greift straffend in sie ein, er kommentiert sie, er diskutiert u.a. über ihre Glaubwürdigkeit. Der Übersetzer übersetzt den Text des Sidi Hamet Benengeli. Auch dieser hat offenbar in die Geschichte eingegriffen und sie gestaltet. Auch er reflektiert gelegentlich über die Glaubwürdigkeit des Erzählten. Damit suggeriert er die Existenz weiterer Quellen. Auf der anderen Seite wird gelegentlich suggeriert, er habe etwas erfunden oder eigenwillig interpretiert. Als Araber wird Sidi Hamet Benengeli einerseits der verzerrenden Parteilichkeit gegenüber einem christlichen Ritter verdächtigt, andererseits aber mehrfach wegen seiner Gründlichkeit gelobt. Dem Reich von 1001 Nacht steht er ohnehin verdächtig nahe. Die novellistischen Einschübe hat er zu verantworten. Bemerkungen zur Geschichte, die er gelegentlich anstellt, werden vom Übersetzer teilweise wiedergegeben, zusammengefaßt und vom 2. Verfasser referiert. Die Quellen, auf die sich Sidi Hamet Benengeli stützt, bleiben unklar. Da er nicht als Zeuge der Abenteuer gegenwärtig war, müßte es solche Quellen aber geben. Die Frage, wie er oder andere von den Szenen wissen können, die sich allein zwischen Quijote und Sancho abspielen, wird erörtert und bleibt unbeantwortbar. Auch der 2. Verfasser erwähnt anläßlich der Suche nach der Fortsetzung seiner Geschichte die Archive der Mancha. Auch er muß schon den ersten Teil (bis I, 8) auf der Basis fremder Quellen geschrieben haben.
Eine zusätzliche Komplikation in der Hierarchie der Ebenen kommt ins Spiel, als die apokryphe Fortsetzung erschienen ist. Ab jetzt tritt der Text des ‘Avellaneda’, den Cervantes im II. Teil durch seine Figuren kommentieren läßt, in Konkurrenz zum „richtigen“ Romantext, aber auch zur „richtigen“ Vorlage des Sidi Hamet Benengeli. Indem Quijote auf der Ebene der Romanhandlung absichtsvoll Dinge tut, die NICHT in der falschen Fortsetzung stehen, tritt die erzählte Wirklichkeit ihrerseits in eine Konkurrenzbeziehung zur „falschen“ erzählten Wirklichkeit. Suggeriert wird sogar die Existenz eines „falschen“ Quijote als Konkurrent des „echten“.
Kurzschlüsse zwischen den Ebenen werden zudem dadurch erzeugt, daß sich Leser über Gelesenes äußern: Quijote über den Roman, in dem er vorkommt, fiktive Gestalten aus den Ritterbüchern über Don Quijote, der „Übersetzer“ über den „Araber“, der „Araber“ über seine Quellen, der „2. Verfasser“ über die eigenen Grundlagen. Der Erzähler und der Vorredner treten zudem in einen imaginären Dialog mit dem echten Leser, indem sie ihn ansprechen.
Der „letzte Grund“ der Geschichte, die der Leser liest, verschiebt sich also immer weiter von ihm fort in einen Dunstkreis von Fiktionen, in ein Reich des Imaginären.
In einem späteren Teil des Romans wird Don Quijote selbst übrigens von der Existenz des Buches des Sidi Hamet Benengeli erfahren, und er wird sich mit anderen über diesen Text unterhalten. Die fingierte Quelle wird damit in die fiktive Geschichte gleichsam hinein gezogen - was ihren Fiktionscharakter zusätzlich unterstreicht. Daß fiktive Romanfiguren über die Sachhaltigkeit eines Berichts über ihre Taten und Abenteuer diskutieren, ist ein hochgradig ironischer Einfall in dem Feuerwerk eines Spiel mit Scheinbeglaubigungen.
So unterschiedliche Abenteuer der Held auch erlebt, sie variieren ein bestimmtes Grundmuster: Der Ritter sieht die Dinge, Personen und Situationen anders als die anderen, er sieht sie als etwas anderes, sie stellen sich ihm als etwas anderes dar als dem normalen Blick. Don Quijotes Verrücktheit wird im Roman immer wieder zum Anlaß ausdrücklicher oder unausdrücklicher Unterscheidungen zwischen Sein und Schein. Man könnte von einem den verschiedenen Episoden zugrundeliegenden „Windmühlenmodell“ sprechen. Sancho übernimmt die Rolle des Repräsentanten der Normalität. Entscheidend für DQ.s Interpretationen von Dingen, Situationen und Personen ist, daß er sie dem Lesemuster der Ritterromane unterwirft - er entziffert sie gemäß dem literarischen Code, den er verinnerlicht hat. Seine Wahn ist lektürebedingt.
Allerdings verhält es sich nun keineswegs immer so einfach, daß Don Quijote die Dinge „falsch“ auslegt und die anderen richtig. Es kommt auch zu mehreren Modifikationen des Ausgangsmodells, ja zu regelrechten Verdrehungen. Eine Art von Modifikation liegt dann vor, wenn Sancho aus Naivität bestimmte Phänomene genauso interpretiert wie sein Herr - etwa die im Dunkeln unsichtbaren Wassermühlen, welche beide für etwas Unheimliches halten. Zu Verdrehungen des Ausgangsmodells kommt es, wenn Don Quijote zwar spontan das sieht, was man auch normalerweise sehen würde, er von anderen aber mit seinen eigenen Ideen angeführt wird und sie ihm das Sichtbare gemäß seinem Code um-interpretieren.
Besonders instruktiv ist hier die Szene mit drei Bäuerinnen, die Sancho und Don Quijote begegnen, als sie sich auf der Suche nach Dulcinea befinden. Ganz anders als sein Herr, weiß Sancho, daß sie Dulcinea dort, wo sie suchen, nicht finden werden - hat er selbst den Ritter doch mit einem erlogenen Bericht über den Besuch bei Dulcinea irregeführt, um einen unmöglichen Auftrag scheinbar zu erfüllen. Aber jetzt hat er ein neues Problem: Wie windet er sich aus der für ihn schwierigen Lage heraus, die sich ergibt, als Don Quijote zusammen mit seinem Knappen die doch scheinbar durch Sancho in ihrer Existenz bestätigte Dulcinea besuchen will? Drei Bäuerinnen begegnen den beiden. Don Quijote sieht auch drei Bäuerinnen, nichts anderes. Aber Sancho macht ihm weis, es handle sich um Dulcinea und zwei andere Damen, und er, Sancho, sehe diese klar und deutlich. Der Ritter erklärt sich die Situation, indem er sich selbst (der doch „richtig“ sieht) zum Getäuschten erklärt: Er sei das Opfer eines Zauberers.
Gelegentlich verunsichert Cervantes seine Leser hinsichtlich dessen, was einzelne Figuren glauben oder bewußt erfinden. So geschieht es, daß Quijote selbst in den Verdacht gerät, zu schwindeln. Pfarrer und Barbier haben sich, wie erwähnt, verkleidet, um eine Weile in Don Quijotes Vorstellungswelt mitzuspielen; sie wollen ihn damit aber nur für die Welt der Vernünftigen zurückgewinnen. Sancho ist zwar mit im Bunde, doch er möchte seinen Herrn nicht gern betrügen. Und so versucht er, diesen über den - nach seiner in diesem Punkt durchaus „verständigen“ Meinung - „wahren“ Sachverhalt aufzuklären: Er teilt Don Quijote mit, daß dieser betrogen werden solle. Hinter der Maske von Fräulein und Ritter stecken, so Sancho, Pfarrer und Barbier; jenes ist Schein, dieses entspricht dem wahren Sein. Doch Don Quijote akzeptiert diese „Aufklärung“ nicht, da er erstens sich selbst nicht gern in der Rolle eines Mannes sieht, der von Pfarrer und Barbier getäuscht wurde, und zweitens das „Fräulein“ und den „Ritter“ auch gut für seine Vorstellungswelt gebrauchen kann. Also stellt er die Gegenthese auf: Sancho ist der Getäuschte. Zwar stecken für diesen in den Kostümen Ritter und Fräulein die beiden vertrauten Gestalten, doch eben dies ist ein Betrug böser Mächte. Hinter Sanchos vermeintlicher „Wahrheit“ verberge sich - so der Ritter - wiederum eine andere: der Pfarrer sei ein falscher Pfarrer, der Barbier ein falscher Barbier.
Die Antwort des Ritters ist verrückt, aber - und das ist das Entscheidende - unwiderlegbar. Was aus des einen Gesprächspartners Sicht Schein ist, ist für den anderen die Wahrheit, und umgekehrt. Doch eine aufklärende Reduktion des Scheins auf Wahrheit kommt nicht in Betracht, da es keine - oder vielmehr widersprüchliche - Kriterien der Wahrheit gibt. Für Sancho ist „wahr“, was ist seinen Weltentwurf paßt, aber für Don Quijote gilt das gleiche. Und beide Weltentwürfe sind tragfähig genug, um die Erscheinungen des „Fräuleins“ und des „Ritters“.
Nach demselben Muster verläuft später ein „aufklärendes“ Gespräch, das der verständige Domherr mit Don Quijote über die Ritterbücher führt: Es geht - einmal mehr - um die „Wahrheit“ poetischer Fiktionen. Diese ist, wie Don Quijote bekräftigt, für den, der an sie glaubt, nicht widerlegbar; einen Standort außerhalb der literarisch präformierten Weltentwürfe, von dem aus diese aus den Angeln zu heben wären, gibt es nicht. Der Domherr hält Don Quijote für befangen in Illusionen, für letzteren aber ist jener der Verrückte. Und wie sich jener auf eine allgemeine Meinung berufen kann (aber auch nicht auf mehr), so dieser. Mehr als nicht weiter beweisbare Evidenzgefühle für ihre Wahrheits“-Konzepte haben beide nicht vorzubringen, und ihr Streitgespräch dokumentiert deren Widersprüchlichkeit, statt sie aufzulösen. Voraussetzung dafür ist, daß keiner der Partner dem anderen überlegen ist. mit der Folge, daß niemand von sich genau wissen kann, ob er normal oder verrückt ist.
Borges legt nun nahe, die bodenlose Fiktivität erzählerischer Erfindungen auf die Realität selbst zu übertragen und den Fiktivitätsverdacht zu generalisieren. Er entspricht damit der Auffassung Gianni Vattimos über die Geschichtswissenschaft. „Die Anwendung der analytischen Werkzeuge von der Rhetorik auf die Geschichtsschreibung hat gezeigt, daß letztlich das Bild der Geschichte, das wir uns machen, ganz und gar durch die Regeln einer literarischen Gattung bedingt ist - daß die Geschichte also viel mehr 'eine Geschichte', eine Erzählung ist als das, was man im allgemeinen darunter zu verstehen geneigt ist.“ (Das Ende der Moderne. Stuttgart 1990. S. 13. Orig.: La fine della modernità, Milano 1985.) Ähnlich hat Georges Duby die grundsätzlichen Schwierigkeiten der Detektivarbeit des Historikers - auch er rekonstruiert ja Ereignisabläufe, sucht Täter und Motive - in das vielleicht extreme Bild vom ‚kontrollierten Traum’ gefaßt: Der Historiker erträumt die Vergangenheit nur noch, seine Geschichtsschreibung ist, wenn auch von Informationen und ‚Fakten’ geleitet, bloße Projektion aktueller Sorgen, Wünsche und Hoffnungen, dazu ständigem Wandel unterworfen; die vergangene Zeit als ‚historische Realität’, als etwas Wirkliches, wird so seinem direkten Zugriff entzogen. Dies rückt den Altmeister der französischen Mediävistik nicht nur in verblüffende Nähe zu Eco und dessen erträumbaren Mittelaltern. (Ernst Voltmer anläßlich seiner Auseinandersetzung mit Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“).
Bei Borges besitzt aber nicht nur die Wirklichkeit und ihre Geschichte selbst narrativen und poetischen Charakter, ihre Poesiehaftigkeit oder - um es mit Plato zu sagen: ihre Lügenhaftigkeit - hat auch eine performative oder praktische Dimension, wie sie in einer Erzählung von Leonardo Sciascia zur Geltung kommt. Sin Roman „Il Consiglio d'Egitto“ („Der Abbé als Fälscher“) erzählt die Geschichte einer ebenso dreisten wie folgenreichen Geschichtsfälschung. Der Protagonist Vella nimmt als Ausgangsmaterie eine arabische Handschrift, die niemand lesen kann (er selbst kann dies auch nicht richtig, obwohl er als Fachmann gilt), läßt sich von einem maurischen Gast (der seinerseits nicht Italienisch kann) vor Zeugen angebliche Hinweise über den „Inhalt“ des Textes geben, die er selbst - als falscher Dolmetscher - den völlig anders lautenden Bemerkungen des Mauren unterschiebt. Dann bearbeitet er seine „Quelle“, nimmt sie Blatt für Blatt auseinander, mischt die Seiten wie Karten, bindet sie neu. Aus einer Quelle, in der Mohammeds Leben erzählt wurde, entsteht ein fiktives Dokument zur Geschichte Siziliens. Die arabischen Lettern verwandelt Vella in solche, die er „mauro-sikulisch“ nennt (sogar die „Sprache“ des Textes hat er erfunden!), die tatsächlich aber verderbtes Maltesisch sind. Aus einem arabischen Text wird so ‘mauro-sikulischer’, aus einem Prophetenleben eine „Chronik“. Künstliche Alterungstechniken verleihen dem Dokument größere Authentizität. Der titelgebende mittels ebensolcher Techniken entstandene „Rat von Ägypten“ wird deshalb zu einem Politikum, weil in seiner fingierten Quelle von der Beziehung zwischen König und Vasallen in der Frühgeschichte Siziliens die Rede ist, denn damit ist der Text geeignet, als Rechtsdokument in die Auseinandersetzung zwischen den sizilianischen Baronen und dem Vizekönig hineingezogen zu werden. Indem er den Baronen weitergehende „historische“ Rechte zuschreibt, als sie bisher besaßen, macht der gefälschte Text selbst Geschichte. Es ist die literarische Phantasie, welche hier das „historische“ hervorbringt, indem sie die Öffentlichkeit mit „Geschichtlichem“ versorgt.
Ein Verhältnis wechselseitiger Auslegung und Beeinflussung von Texten und Wirklichkeit bestimmt auch das Geschehen in Ecos „Der Name der Rose“. Die Romanhandlung kreist um eine Serie von mysteriösen Todesfällen. Diese sind die „Geschichte“, mit der es die Romanfiguren zu tun haben - ihre ‘historische Realität’. Die beiden Hauptfiguren, der Detektiv Guglielmo (William) und sein Adlatus (und späterer Erzähler) Adson, wollen die Zusammenhänge in dieser Geschichte erkennen - sie recherchieren also ähnlich wie Historiographen, welche die Hintergründe von Ereignissen freilegen wollen. Allerdings haben sie keine Distanz zu den Ereignissen; sie sind ja selbst darin verstrickt und erleben einen Todesfall nach dem anderen. Dennoch scheint es, als hätte sich eine Ordnung der Todesfälle auffinden lassen - diese scheinen in ihrer Chronologie den Prophezeiungen der Johannes-Apokalypse zu folgen. Details der Todesarten und ihrer Begleitumstände scheinen in sich wiederholenden Korrespondenzen zu Motiven der einzelnen apokalyptischen Verheißungen zu stehen.
Was im Don Quijote die Ritterromane sind, das ist bei Eco die Apokalypse des Johannes. Sie spricht vom Weltende und von den Heimsuchungen, die dabei über die Menschen hereinbrechen werden. Im Kloster wird viel über die Apokalypse gesprochen; vor allem Jorge predigt das nahe Ende der Zeiten. Und es scheint William nun, als folge die Serie vermeintlicher Morde dem Muster der apokaplytischen Ereignisse - als sei die Geschichte des Klosters ein Zitat aus dem Text des Johannesevangeliums. In den einzelnen apokalyptischen Visionen ist zunächst von schwerem Hagelschlag die Rede (Adelmus starb in einer Hagelnacht), dann von einem Meer von Blut (Venantius’ Leichnam steckte in einem Bottich mit Blut), dann von Wassermassen (Berengars Leichnam lag im Waschzuber), dann von Zerstörungen in der Welt der Gestirne (Severin wurde mit einer dabei deformierten Armillarsphäre erschlagen), schließlich von giftigen Skorpionen (Malachias murmelte sterbend etwas Unverständliches über das Gift von tausenden Skorpionen, dem er zum Opfer falle). So scheint William eine Ordnung im Chaos der Ereignisse entdeckt zu haben - bis sich schließlich seine Hypothese als falsch herausstellt: Adelmus ist durch Selbstmord zu Tode gekommen, die Plazierung des Venantius im Bottich voll Blut war ein Zufall, ebenso wie das Ende des Berengar im Wasser und die Wahl der Armillarsphäre als Mordinstrument. Nur daß Malachias sterbend an ein Bild aus der Apokalypse erinnerte - an die Skorpoine - hatte etwas mit der Apokalypse zu tun, denn seine Worte waren ein Zitat der Warnungen Jorges, die er mißachtet hatte. Das falsche Lesemuster Apokalypse hilft William und Adson aber immerhin dabei, die lange vergebens gesuchte Leiche des Berengar aufzuspüren: im Wasser. Und es ist insofern nicht ganz falsch, als für den, der sich mit der Apokalypse befaßt, die Spur zu Jorge, dem Prediger der Apokalypse, weist.
Im Gespräch mit William suggeriert zuerst der steinalte Mönch Alinardus, der geistig verwirrt ist, dadurch aber an den literarischen Typus des irren Sehers erinnert, einen Zusammenhang zwischen den Prophezeiungen der Apokalypse und den Ereignissen im Kloster. Das apokalyptische Lesemuster nimmt ab jetzt Einfluß auf die Hypothesenbildungen der Detektive, mittelbar aber auch auf die weitere Folge der Mordtaten selbst. Später stellt sich allerdings heraus, daß von den Todesfällen nur einer im engeren Sinne ein Mord war; bei den anderen handelte es sich um einen Selbstmord sowie um mehrere versehentliche Selbst-Vergiftungen (für die allerdings ein Täter verantwortlich war, insofern waren es doch gewollte Todesfälle.) Schließlich gelingt es William, den Fall zu lösen: Aus den Gesprächen der Mönche und anderen Indizien erschließt er, daß hier ein Buch versteckt wird - und er erschließt sogar, welches es ist, weil er genug Menschenkenntnis und Intuition hat, um zu ahnen, welches Buch in einem von Jorge dominierten Kloster versteckt würde.
Die Apokalypse findet am Romanende dann tatsächlich statt, wenn auch im verkleinertem Maßstab des Bibliotheksbrands. Jorge wirft mit einer Öllampe nach seinen Gegnern. Das umstrittene Buch verbrennt, das Feuer greift um sich, die ganze Bibliothek verbrennt, das Kloster brennt nieder. Viele seiner Bewohner, darunter Jorge, kommen in den Flammen um. Adson und William können sich retten, aber ihre Versuche, zusammen mit den Mönchen das Feuer zu löshen, sind vergeblich. Alle Überlebenden verlassen das Kloster. Adson kehrt in sein Kloster zurück, wo er Jahrzehnte später als alter Mann seine Erinnerungen niederschreibt. Ein einziges Mal ist er noch an die Brandstätte zurückgekehrt, nach vielen Jahren, und hat sich eine Sammlung von Papierfetzen mit nachhause genommen. Diese erinnern ihn an den Brand - an das wahrhaft apokalyptische Szenario, das Jorge verschuldet hatte. Und so hat sich das Lesemuster Apokalypse dann nachträglich sogar noch als Schlüssel bestätigt.
Im letzten Gespräch mit Jorge, dessen sämtliche Geheimnisse er durchschaut hat und der ihn dafür widerwillig bewundert, äußert sich William skeptisch hinsichtlich seiner detektivischen Leistung. Gegenüber Adson bemerkt er paradoxerweise, es habe keine Intrige gegeben, und er, William, habe sie nur aus Versehen aufgedeckt, „indem ich einem apokalyptischen Muster folgte, das den Verbrechen zu unterliegen schien, und dabei war es ein Zufall. Ich bin zu Jorge gelangt, indem ich einen Urheber aller Verbrechen suchte, und dabei haben wir nun entdeckt, daß im Grunde jedes verbrechen einen anderen Urheber hatte, beziehungsweise keinen. Ich bin zu Jorge gelangt, indem ich dem Plan eines perversen, wahnhaften, aber methodisch denkenden Hirns nachging, und dabei gab es gar keinen Plan, beziehungsweise Jorges ursprünglicher Plan hatte sich selbständig gemacht und eine Verkettung von Ursachen eingeleitet, von Haupt- und Neben- und Gegenursachen, die sich auf eigene Rechnung weiterentwickelten, indem sie Wechselbeziehungen eingingen, denen keinerlei Plan unterlag.“ (Name der Rose S. 625)
Die von William und Adson gelesene „Geschichte“ ist also nichts Absolutes. Sie ist vielmehr abgeleitet von Texten, sie ahmt Texte nach, wenn sie entsprechend zusammengelesen und gedeutet wird. Sie ist ein Stück Literatur, geformt auf der Basis von Texten.
Nach diesem Umweg über Menard, Borges, Cervantes, Scascia und Eco sind wir wieder bei Debords Kritik des Spektakels angelangt.
der Film, der zu diesen labyrinthischen Spekulationen Anlaß gab, lief im Festval „Achtung Berlin“ am 21.4.2012 im Babylon. Drehbuch und Regie: Lior Shamriz
http://achtungberlin.de/programm0/preview/a-low-life-mythology/
Dienstag, 24. April 2012