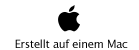Aphanisis
Der Begriff bezeichnet das Rätsel des Verlustes eines Gefühls. Dieses Rätsel verweist auch auf das Rätsel der Entflammens. Was es ist, was den Hunger auf einen bestimmten Menschen auslöste. Was machte mich so sicher, daß er oder sie es ist. Und wenn wir jenen Hunger nicht mehr spüren, was geschieht dann mit uns, oder was tun wir dann? Werden wir von einer Fähigkeit verlassen, die uns bis dahin zu Gebote stand? Verlieren wir eine Energie? Oder werden wir von etwas heimgesucht, dessen wir uns nicht mehr erwehren können? Lassen wir etwas hinter uns, oder werden wir von etwas überrannt. Um das energetische Rätsel herum wirbeln weitere Fragen. Fühlen wir uns um etwas betrogen, oder stellen wir fest, daß wir den Anderen betrogen haben? Ist etwas verdünnt worden, oder haben wir zu lange etwas in uns hineingefressen, das dann als wegen Verdickung bei Gelegenheit das Gefäß sprengen mußte. Und wie steht es mit der Moral? Wäre es ehrenhafter, unbedingt zusammenzubleiben, soll man das auf jeden Fall versuchen, was immer da von uns verlangt wird, und ist es Eingeständnis der Unfähigkeit, wenn das nicht gelingt, weil wir uns dann vor der notwendigen Mühe drücken, oder ist es nur Feigheit, wenn man sich an eine Bindung klammert, wenn sie doch nicht mehr zu halten ist? Wann bleibt man man selber, und wann verliert man sich? wann wirkt man authentisch, und wann macht man sich unglaubwürdig?
Der aus dem Altgriechischen stammende Terminus, basierend auf dem griechischen Wort aphanes = unsichtbar, wurde von Ernest Jones in das Vokabular der Psychoanalyse eingeführt und bezeichnet dort das Verschwinden jeder sexuellen Begierde. Nach McDougall sei dieser Mangel an den Wunsch gekoppelt, in das Mutter-Universum des frühkindlichen Stadiums zurückzukehren. Eine bewährte Methode, um den Bedeutungshorizont eines Wortes auszumessen, besteht darin, sich nach Synonymen umzusehen. Roland Barthes erinnert an den Begriff akedia = Verlust einer Besetzung - Trauer um die Besetzung, nicht um das besetzte Objekt. So wie man, wenn man jemanden liebt, auch die Liebe liebt, so trauert man mit der Trauer um eine Person zugleich auch um den Verlust der Liebe selbst. Das Scheitern einer Beziehung läßt das Gefühl entstehen und wachsen, zum Gefühl der Liebe und der Zuneigung generell nicht mehr fähig zu sein.
Mit diesem Phänomen eng verbunden ist das der „Alexithymie“, was wörtlich übersetzt bedeutet, “keine Worte für Gefühle“ zu haben, und die Unfähigkeit beschreibt, eigene Gefühle oder deren Abhandenkommen wahrzunehmen, diese zu identifizieren und sie in Worte zu fassen. Alexithymie beschreibt zwar auch das Vorhandensein einer konkretistischen, extern orientierten Denk- und Sprechweise, die sowohl einen Mangel an Phantasie aufweist, als auch eine klare Ausprägung der Affektivität vermissen läßt. Das Vorhandensein einer Alexithymie wird heutzutage allerdings immer häufiger unter dem Aspekt eines emotionalen Zurückgebliebenseins gesehen, als Defizit an adäquaten Bewältigungsstrategien. Einige Autoren vermuten, daß im Verlaufe psychischer oder körperlicher Erkrankungen, alexithyme Merkmale als Ausdruck „dysfunktionaler Coping-Prozesse“ auftreten. Andere Autoren Gleichzeitig berichten, daß alexithyme Patienten einer psychotherapeutischen Behandlung weniger zugänglich seien, als nicht-alexithyme Patienten.
Die fraglichen Phänomene werden in erster Linie unter dem Aspekt thematisiert, daß sie dem Psychotherapeuten die Arbeit erschweren. Der eingangs genannte Ernest Jones verfolgte allerdings einen weitergehenden Ansatz. Er glaubte, in dem Verschwinden der sexuellen Lust die tiefere Ursache für alle Neurosen gefunden zu haben. Er machte den Begriff aphanisis zum Kern seiner Variante der psychoanalytischen Theorie. Im sprachanalytisch gefärbten Theoriesystem Lacans, der dem Begriff einen ähnlich zentralen Stellenwert einräumt, beschreibt Aphanisis den Prozess, in welchem ein Subjekt durch die Zeichen selbst verfinstert wird, die es bezeichnen könnten, in dem es hinter jedwedem Signifikanten verschwindet, der helfen könnte, es zu verstehen, der dazu dienen könnte, sich von ihm eine Vorstellung zu machen. Das Subjekt als solches ist entsprechend „gebarrt“ (durchgestrichen), bloß eine Lücke, nicht mehr als eine Unterbrechung; der Signifikant regiert uneingeschränkt, hat die absolute Vormachtstellung.
In dieser Sonnenfinsternis, verdeckt durch den Anderen (durch Sprache), bleibt dem Subjekt nichts übrig, als sich von sich selbst einen Begriff zu machen vis-a-vis von etwas Anderem als es selbst, als etwas „außerhalb“ von ihm selbst oder radikal getrennt von ihm. Nach dieser pessimistischen Ansicht kann das Subjekt, indem es versucht, sich selbst denkbar zu machen und also kommunikabel, nur seine eigene radikale Entfremdung vollenden.
Weil der Andere und die allgemeingültige sprache den einzigen Weg bilden, auf dem ein 'Subjekt' denkbar gemacht werden kann, ist aphanisis, das Verschwinden oder fading des Subjekts hinter dem, was es bezeichnet und verstehbar und vorstellbar macht, ein grundlegendes Konzept zum Verstehen von Subjektivität unter Bedingungen seiner Auslöschung und angesichts der Gefahr der fundamentalen Leere. Der Angst auslösende Zustand der Begehrenslosigkeit, die Angst vor dem Nie-mehr-Begehren-Können wird im Kontext von Lacans Konzept des Spiegelstadiums und der Metapher einer sich selbst verfinsternden Sonne verstehbar als die konstitutive Abgründigkeit von Subjektivität und Selbstbewußtwerdung überhaupt. Das Subjekt als vermeintlicher inbegriff der Autonomie und Selbstmächtigkeit erweist sich als Verkörperung der Abhängigkeit und Selbstfremdheit. eine radikale lesart dieser hypothese käme der einsicht gleich, daß psychotherapie den entfremdungsprozeß nur verchlimmern und verfestigen könne.
Unter einem anderen aspekt offenbart sich das mit dem begriff aphanisis bezeichnete Phänomen, wenn wir uns mit dem anonymen autor der „Nachtwachen des Bonaventura“ darin übereinstimmen, daß weit furchtbarer, als nicht mehr geliebt zu werden, sei, nicht mehr lieben zu können. Wir ahnen, daß mit diesem als Gefühl der Hilflosigkeit erlebten Schwund-Zustand ein Schuldgefühl verknüpft ist, das unzugänglicher ist und in tiefere Regionen der Seele hinabreicht als alles andere. Aphanisis bezeichnet dann eine Angst, die tiefer reicht als die ödipale Kastrationsangst. Mit diesem unabweisbaren, nicht überspielbaren und nicht-kompensierbaren Gefühl am toten Punkt meines Lebensentwurfs setze ich mich zum Anderen in ein dialogisches Verhältnis, in dem ich mich selbst vollständig aufgebe und jede Anschuldigung wehrlos über mich ergehen lasse. Kierkegaard hat dieser Erfahrung in seinem „Tagebuch eins Verführers“ nachgeforscht.
Dieses Gefühl bringt einen in schwindelerregenden Kontakt mit einer tabuiisierten Denkmöglichkeit der frühen Kindheit, die von dem aufdringlichen Phantasma, einem könnte von einem Elternteil Gewalt angetan worden sein, verdeckt wird, nämlich daß ich als Kind den Eltern damit Gewalt angetan habe, daß ich sie nicht zu lieben vermochte. Um die Bedeutung dieser Möglicheit ermessen zu können, als Kind den Eltern Gewalt anzutun oder dies auh nur im Sinn zu haben, benötigt man eine angemessene Erkenntnistheorie des Kindes, die der aktiven Rolle Rechnung trägt, die es von Anfang an in seiner Welt spielt, und seiner noch uneingeschränkten Allmacht innerhalb der dyadischen Einheit mit der Mutter. Auch wenn es als autonomes Individuum noch gar nicht existiert, sondern als Teil der Mutter-Kind-Dyade mit der Mutter einen gemeinsamen Organismus bildet und eine gemeinsame Seele teilt, und auch wenn es mit den Händen noch nicht greifen und mit den Beinen noch nicht laufen kann, so ist das Kleinkind doch und gerade deswegen dasjenige, das es in der Hand hat, wie es der Mutter und damit auch sich selber geht. Alles hängt davon ab, wie gut das Kind zur Mutter ist. Wenn sie verärgert ist oder lange fortbleibt, dann war ich als Kleinkind nicht gut genug zu ihr. Wenn sie gar nicht mehr zurückkehrt, dann habe ich sie getötet. Eine solche Erkenntnistheorie und Psychologie, die der natur des Kleinkindes angemessen wäre, kann es nicht gebebn, weil die Erkenntnistheorie und die Psychologie einer Fiktion des Erwachsenen genügen müssen, die den Umstand ignorieren und verdrängen helfen muß, daß wir alle Kleinkinder gewesen sind und in gewisser Hinsicht immer bleiben.
Wenn man sich nun also bewußt macht, daß das Kind keineswegs das passive und hilflose Wesen ist, als das es gerne beschrieben wird, das den anderen ausgeliefert ist, obwohl es dieses noch gar nicht sein kann, weil es noch nicht alt genug ist, um hilflos sein zu können, um sich als hilfloses Wesen denken zu können, da es noch gar kein individuelles Wesen ist, sondern im Gegenteil gerade wegen seiner faktischen Hilflosigkeit als wesen, das getrennt von der dyadischen einheit mit der Mutter noch gar nicht existiert, in seiner imaginären Allmacht alles bewirken kann und muß, alles zu verantworten hat, dann läßt sich auch ermessen, was es bedeutet, wenn man als Kleinkind erfährt oder mit dem Gedanken spielt, daß man die Mutter nicht lieben kann oder auch nur mit der möglichen Verstörung oder der eventuellen Gefahr konfrontiert ist, was geschähe, wenn einen dieses Gefühl überfiele und man sich seiner nicht erwehren könnte, wenn man von dem von Angstlust erzeugten Sog dieses möglichen Gedankens fortgerissen zu werden droht. Man schickt die Mutter in den Tod und unterschreibt damit zugleich das eigene Todesurteil. Derlei darf man nicht einmal denken, denn sobald man es denkt, ja sobald man diesen Gedanken auch nur ausprobiert, ist es bereits geschehen, hat man den Gedanken in die Welt gelassen und den Tod der Mutter verursacht, was zugleich bedeutet, kein Recht zu existieren zu haben.
Die Psychotherapie will uns weismachen, daß die Befürchtung, nicht mehr geliebt zu werden, da die Mutter sich entfernt hat und allzu lange fortbleibt, so daß ich befürchten muß, daß sie gar nicht mehr kommt, etwas sei, was ich lernen soll, zu verlernen, was mir als Kind leichter fällt, wenn ich das Glück habe, eine „hinreichend gute Mutter“ zu haben, die mir das Vertrauen einflößt, immer nur vorübergehend fort zu sein. Tatsächlich aber ist das Fortgehen und Fortbleiben der Mutter etwas, das ich mir als Kleinkind beständig, mit einer enormen, unwiderstehlichen Angstlust, wie sie Balint denkbar machte, vorzustellen versuche, versuchen muß, nicht umhin kann, mir vorzustellen. Und das, obwohl oder weil ich mit dieser imaginären Ermordung der Mutter meinen eigenen Tod imaginiere. Ich übe mich beständig in der todesmutigen Tollkühnheit, sie mir für immer abwesend vorzustellen, selbst während sie bei mir ist, sie mir sogar als Anwesende abwesend, als Lebendige tot vorzustellen. Indem ich mir diesen Fall mit einem bangen aber starken Genuß vorzustellen versuche, imaginiere ich auch die Panik, die das auslösen muß.
Dieses undenkbare und in seiner Undenkbarkeit zugleich faszinierende Entsetzen, diese Angst-Lust von Poe’schem Kaliber bildet den seelischen Echoraum der Situation, in der sich ein Erwachsener gebracht sieht, der sich nicht mehr imstande fühlt, die Frau oder den Mann der Wahl zu lieben und zu begehren. Indem dieser Schwundzustand sich den frühkindlichen Echoraum der fortgedachten, totgewünschten Mutter aufruft, wird auch der dyadische Knoten von Verlassen und Verlassenwerden reevoziert. Schuldgefühle macht mir das Verlassen des anderen darum, weil es mich an das zwanghaft und chronisch gewünschte Sterben der Mutter erinnert. Ich bin wütend auf denjenigen, den ich verlassen habe, weil er oder sie mich diesem Erinnernmüssen aussetzt, daß er oder sie mir das antut. So ist es nur scheinbar paradox, daß sich der Verlassende selbst verlassen und verraten fühlt, daß er darüber zornig ist, daß der oder die Verlassene nicht Wort gehalten hat, und sich an den klammert, den er doch verlassen muß. Der Verlassende wundert sich, daß er wütend ist, während doch allein die oder der andere, den oder die er verläßt, Grund hätte, wütend zu sein. Der Verlassende kann seinen eigenen Gefühlen nicht trauen. Er will etwas sagen und weiß in dem Moment, daß sich nichts sagen läßt, weil das Gegenteil genauso wahr wäre. Er öffnet wie die der zentrale Figur der Laokoongruppe den Mund zu einem stummen Schrei.
Donnerstag, 30. Dezember 2010