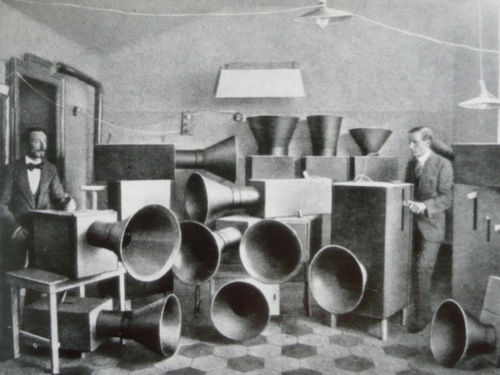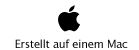Arie
Das Gestammel desjenigen, der von etwas heimgesucht wird, für das kein Diskurs bereitsteht, bei dem alle so tun, als gäbe es das gar nicht, woran sie fest glauben, hat dieselben Ursachen wie eine Opernarie, die jemand singt, ohne das, was ihn bewegt, in vernünftiger Rede artikulieren zu können. Die Opernarie stellt eine Form bereit für das, was die erwachsene, rationale, psychologisch nachvollziehbare Rede ausschließt oder was man angesichts der Auflagen der akzeptablen Rede unterdrückt, zurückhält, womit man allein bleibt: die unvernünftigen, sprachlosen, vereinsamenden Gefühle und Affekte. Während der Text sich des gesunden Menschenverstandes und der Verständlichkeit für die anderen befleißigt, verrät die Musik, daß es um etwas ganz anderes geht.
Die Oper stellt eine Form bereit für das, was die allgemein akzeptierte Rede ausschließt, indem der Protagonist verbal den Regeln dieser durch Konsens gedeckten Rede folgt, aber die Musik gegenläufig ertönt. Während verbal die Auflagen der Rede befolgt werden, kommen tonal die einsamen und unvernünftigen Gefühle als das Noch-nicht-Verstandene und Allein-nicht-Verstehbare zum Ausdruck. Die offensichtliche Gegenläufigkeit bringt dem Zuhörer, indem sie diesen ergreift, ihn ergriffen macht, zu Gehör, daß wir für das, was man allgemein für vernünftig und erwachsenen erachtet, einen zu hohen Preis zahlen, ohne daß dies bereits vollständig bewußt werden müßte. Die Opernarie hat kathartische Wirkung, die darin liegt, daß die Spannung abgeführt werden kann, die sich aus diesem Widerspruch ergibt, ohne daß wir Konsequenzen zögen. Wir sind den Tränen nahe und verlassen glücklich das Theater.
Die Arie gleicht so der Sprache des Symptoms. Diese ist das, was ich dem Arzt unbewußt mitteile, weil es mich quält, weil es sich mit mir ereignet, was ich aber nicht allein erkennen kann, wozu ich den Anderen brauche, dem ich zutraue, mehr zu wissen: den Arzt eben. Ich gehe mit dem Symptom zu ihm in der Hoffnung, er möge mich mir erklären können. Im Symptom wie in der Arie werde ich von meinem Körper fortgerissen und in eine Kommunikation hineingeworfen, deren Sinn ich als Individuum nicht erfassen kann und auf deren Verlauf und Ergebnis ich keinen Einfluß habe, in der ich mich dem anderen überantworte. Alles hängt davon ab, was der daraus macht.
In der Sprache des Symptoms teile ich dem Arzt mit, worin ich mir selbst fremd bin, worin ich mir ganz als Körper erscheine, weil ich dem Arzt zutraue, mehr über mich zu wissen als ich selbst. Ich gehe mit dem Symptom zu ihm in der Hoffnung, er möge mich wieder mit mir selber vertraut machen, Körper in Geist zurückzuverwandeln. Als Patient singe ich dem Arzt eine Arie und laß mich also gehen, während ich verbal beteuere, alles tun zu wollen, was er mir vernünftigerweise abverlangt, indem ich Kooperationsbereitschaft und Disziplin signalisiere. Auch in Situationen des Alltags, die nicht eine derartig scharfe Kontur besitzen wie der Opern- oder der Arztbesuch, die anscheinend nicht formalisiert sind, kommt die Dialektik der Symptomsprache zur Geltung. Häufig werden wir, während wir uns verbal disziplinieren und unser Denken im Sinne des gesunden Menschenverstandes kontrollieren, in unseren Gesten, unserer Mimik, unserer Stimme, vom Körper fortgerissen. Unser zu Körper gewordener Geist reißt uns mit sich fort. Was wir bei einem anderen Menschen kopfschüttelnd registrieren, wobei der Ekel im Extremfall auch zur Einweisung in die Psychiatrie führen kann, dessen schämen wir uns bei uns selber. Doch die Scham kann eine Weile von Körper-Raserei verdrängt bleiben. Solange die Raserei dauert, verwehrt uns unserer Körper zu uns selbst als Geist den Zugang.
Körper und Seele, die im Normalfall ein unteilbares Ganzes bilden, sind zuweilen getrennt als Geist oder Körper wahrnehmbar. Was dann Geist und was Körper ist, wo die grenzlinie jeweils verläuft, entscheidet sich von Moment zu Moment. Das irritierende Dominieren des Unwillkürlichen, die unheimliche und bei anderen als degoutant erlebte Verkörperlichung des Selbst ist deshalb so bedrohlich, weil es mühsam erarbeitete kulturelle Errungenschaften in Frage stellt und vermeintliche sichere Dämme unterspült. Im Namen der Kultur wehren wir uns mit abschätzigen sozialen Deklassierungen oder mit medizinischer Diagnose. Das Spektrum solcher entfemdenden Verkörperlichungen, solcher Körper-Rasereien reicht von Schluckauf und zu lautem Lachen bis zum Tourette-Syndrom, von übergebührlich heftige und ungebührlich lange Trauer bis zu Psychose und Amoklauf. Daß sich diese Phänomene auf einem energetischen Kontinuum eintragen lassen, dürfen wir nicht wissen.
Der Aufwand, mit dem wir uns von dergleichen distanzieren, indem wir alles tun, um die Möglichkeit undenkbar erscheinen zu lassen, das könnte uns selber auch passieren, fällt auf uns selber zurück. Diese latente Dialektik wiederum findet sich in Diderots Dialog mit dem Titel „Rameaus Neffe“ dargestellt. (siehe dort)
Donnerstag, 30. Dezember 2010