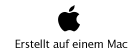Gespräche mit Leuco
Zwei Tage vor seinem Tod schickte Pavese "ein Buch, das keiner liest und das natürlich das Einzige ist, das etwas taugt" an den französischen Übersetzer Nino Frank: Gespräche mit Leuko. Als es 1947 erschien, wagten sich nur zwei italienische Zeitungen daran, es zu besprechen. Pavese war bereits tot. Er hatte seine letzten Worte in sein Manuskript der „Dialoge“ geschrieben. „Du gibst den Dingen eigene Namen“, sagt Hesiod zu Mnemosyne, „die sie anders machen, unerhört und doch lieb und vertraut wie eine Stimme, die seit langem schwieg. Oder wie das jähe Sich-Erblicken in einem Spiegel von Wasser, der uns sagen läßt: Wer ist dieser Mensch?“
Pavese läßt die Götter über die Sterblichen reden. In ihren Dialogen kommt ihre Verwunderung über diese Wesen zum Ausdruck und ihre Sehnsucht. Es ist erschütternd, wie diese Götter von Sehnsucht und Trauer zugleich ergriffen werden, wenn sie von den erbärmlichen und gleichwohl in ihren Augen beneidenswerten Menschen sprechen. Sie sehnen sich nach deren Sterblichkeit, die, weil sie vom ewigen Schicksal befreit, „alles unvermutet und Entdeckung“ werden läßt. Sie bewundern sie für ihre Fähigkeit, Dinge und Phänomene zu benennen, denn überall, sagt Dionysos zu Demeter „wo sie Mühsal und Worte aufwenden, wird ein Rhythmus, ein Sinn, eine Ruhe geboren.“ Wie schön muß es sein, „sich selbst zu gestalten, nach der eigenen Laune.“ Ihnen entgeht dabei nicht, daß die Menschen gemein und berechnend sind, daß sie ihre Geschichten mit Blut erzählen, den Wert ihrer Existenz nicht erkennen und sich an der Welt versündigen. In das Unverständnis und den Zorn hierüber mischt sich Bestürzung über die Ohnmacht der menschen. Nein, nicht ein Gott wird die Menschheit retten. Eine göttliche Erzählung allenfalls, die die Menschen lehrt, „daß der Tod auch für sie neu ist. Ihnen diese Erzählung geben. Sie ein Schicksal lehren, das sich mit dem unseren verflicht“. Diese Annäherung ist eine ganz andere als die gängige, derzufolge wir Götter als Personifizierungen von Macht betrachten und sie als solche von den realen politischen und gesellschaftlichen Kräften besetzen und instrumentalisieren lassen. In den Wäldern Piemonts könnte ein ganz anderes, neues Leben beginnen.
Jeweils zwei Götter unterhalten sich über die Sterblichen. Dionysos und Demeter, Thanatos und Eros, Herakles und Prometheus. Nur wenige der 27 Dialoge finden zwischen den großen Olympiern statt, meist werden sie zwischen Titanen, Nymphen und Kentauren, Hirten und Jägern geführt. Auch Hesiod ist unter ihnen. Die Nymphe Leuko war eine Gefährtin der Kirke. Im ersten der Dialoge geht es um die Verwunderung darüber, daß die Höchsten im Olymp zu den Menschen hinabstiegen. Herakles tötet den grausamen Lytherses, damit es mit den Menschenopfern, die die Erde befruchten sollen, endlich ein Ende hat. Als ob ein letztes Opfer passieren müßte, um eine neue Ordnung zu gründen.
Pavese erinnert nicht nur an das kulturelle Erbe der antiken Griechen, deren Fiktionen ein Wissen darstellen, das es zu bewahren lohnt. Er setzt den Leser auch auf die Spur der Ursprünge von Poesie. Mythen sind Sammelbecken von Sinnbildern. Greift man auf deren Bedeutungsinventar zurück, so wird es möglich, in einem Halbsatz "einen ganzen Organismus der Leidenschaft, des menschlichen Seins, einen ganzen Gedankenkomplex" zu entwickeln oder wiederzubeleben.
gegen Ende heißt es: „Ein Nichts genügt, und das Gelände wird wieder dasselbe wie damals, als diese Dinge geschahen. Es genügt ein Hügel, ein Gipfel, ein Abhang. Daß es ein einsamer Ort ist und daß deine Augen hinaufsteigend im Himmel anhalten werden.“
Pavese deutet die Geschichte als die einer endgültigen Entfremdung zwischen Menschen und Göttern, hätte es zuvor nicht eben jene Dialoge gegeben: die Entfremdung ist so wie das Erwachen aus einem Traum, wie eine Rückkehr in die eigene, einsame Wahrnehmung eines Trostlosen, in die hineinragt die Erinnerung an jene unsere verlorengegangenen „Begegnungen“.
Eine Verfilmung von Jean-Marie Straub und Danièle Huillet verknüpft einige der Dialoge mit Passagen aus einem frühen Roman, «La luna e i falò» (Der Mond und die Feuer“) die Erinnerung an die blutige Zeit der Resistenza. Ein Antifaschist kommt nach dem Krieg zurück aus Amerika in den Ort im Piemont, in dem er als Findelkind aufwuchs. Die Veränderungen, zu denen alles bereit schien, haben nicht stattgefunden. Über den Kadavern des Faschismus, die die Erde unerwartet freigibt, brechen sich in beängstigender Weise die alten Antagonismen Bahn.
Warum Pavese, wurden die beiden gefragt. Weil Pavese geschrieben hat: „Kommunist ist nicht, wer will. Wir sind zu unwissend in diesem Land. Man bräuchte Kommunisten, die nicht unwissend wären, die den Namen nicht verdürben.“ Und auch: „Wenn einstmals ein Feuer genügte, um Regen zu machen, darauf einen Landstreicher zu verbrennen, um eine Ernte zu retten – wieviele Häuser von Herren muß man in Brand stecken, wieviele umbringen auf Straßen und Plätzen, bevor die Welt sich zum Gerechten wendet und wir das Unsere sagen können?“
Pavese läßt den Bastard sagen: „Vorgestern bin ich unterhalb der Mora vorbeigekommen. Die Pinie am Zaun ist nicht mehr da …“ Nuto antwortet: „Der Verwalter hat sie fällen lassen, Nicoletto. Der Unwissende … Er hat sie fällen lassen, weil die Zerlumpten im Schatten stehen blieben und bettelten. Verstehst du?“ Nochmals Nuto, an einer anderen Stelle: „Bei dem Leben, das er führt … ich kann ihn nicht Trottel heißen … Wenn es nützte … Erst muß die Regierung das Geld verbrennen und den, der es verteidigt.” Die beiden verstehen ihren Film als eine kleine Rache. Eine Rache „gegen die Intrigen des Hofes“, wie es in La Carrozza d’oro heißt. Gegen all dieses Gesindel.
Was die Medien dazu zu sagen hatten: “Noch enttäuschender der Wettbewerbsbeitrag der französischen Kino-Avantgardisten Huillet und Straub. Da schwafeln minutenlang unansehnliche, schlecht gekleidete Paare, die wohl einer Art Halbgötterkaste angehören, über die Probleme der gewöhnlichen Sterblichen. Ihr Blutvergießen, ihre Fragilität und Unwissenheit. Dazu gibt es einige Naturaufnahmen mit sinnentleerten Kameraschwenks.
Ein würdiger Beitrag zum Genre des Scheißfilms also: prätentiös, gewollt langweilig und konstruiert. Was hier als intellektuell anspruchsvoll verkauft wird, ist nichts anderes als humanistisches Bildungs-Gepose, das selbst auf einer staatlich geförderten Theaterbühne nur ermüden würde. Wenn das Avantgarde sein soll, dann lieber Omas altes Erzählkino. Fast parallel lief übrigens auf dem TV-Sender RAI Uno die WM-Final-Revanche Frankreich gegen Italien. Da steckten schon in den ersten 30 Minuten mehr Dramatik, mehr Spielwitz und mehr starke Charaktere als in Huillet-Straubs sperrigem Dialogstück. Hätte man irgendwie ahnen können. (Matthias Schmidt – „stern.de“, 7. September 2006); Das Kino verdankt den Straubs und ihrer Widerborstigkeit eine Menge, aber in einem Wettbewerb verflüchtigt sich jede Provokation ins Stühleklappen derer, die das Kino vor der Zeit verlassen. (Michael Althen – „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 8. September 2006)
Donnerstag, 30. Dezember 2010