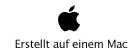Normalität
Normalität ist nicht etwas, das wir nur zu beobachten brauchen, um es zu erkennen. Sie begnügt sich nicht damit, bloße Beschreibung von etwas zu sein, sondern sie will selbst normativ regulierend wirken. Sie ist nicht nur all das, was nicht abnorm ist, sondern sie verlangt von demjenigen, der ein System zu beschreiben versucht, dieses so zu sehen, wie das System gesehen werden will. Normalität ist nicht etwas, wie es tatsächlich ist, sondern wie es sein soll, und was so ist, wie es sein soll, weil nicht sein kann, was nicht sein soll. Wenn unser Verhalten nicht als abweichendes oder nicht-nachvollziehbares auffällt, entsprechen wir dem, was man als Normalität empfindet. Die Frage ist, wie wir dies bewerkstelligen. Was macht uns so sicher?
Normalität kann nicht wie ein Ding einfach gegeben sein. Man muß annehmen, daß Normalität etwas ist, was wir alle miteinander tagtäglich konstruieren. Doch dann könnten wir nie sicher sein, daß der andere dasselbe konstruiert, daß wir auf derselben Baustelle arbeiten. Normalität ist aber per se das, dessen wir sicher sind und von dem wir überzeugt sind, daß der andere die annahmen mit uns teilt.
Soziologen gehen in Übereinstimmung mit dem Alltagsdenken davon aus, daß diese Entsprechung der Fall sei, weil wir die geltenden Normen akzeptieren und uns an sie halten. Auf ebendiese Weise verschaffen wir den Normen ihre Geltung. Die Geltung der Normen beruhe auf ihrer Anerkennung. Wenn wir alle wüßten, daß Normen nur gelten, weil wir sie anerkennen, könnten wir sie aber zu leicht außer Kraft setzen. Es muß also noch etwas hinzukommen, das uns glauben macht, die Geltung der Normen sei metaphysisch oder transzendental verfügt und gesichert. Es muß also einen höheren Zwang geben, der uns sicher macht, daß Normen nicht nur gelten, weil wir das so wollen, sondern weil wir das so wollen müssen, etwas, was ihre Kontingenz tilgt – obwohl wir auch dies selber machen müssen.
Niklas Luhmann behauptete nun, daß Normen in Wahrheit nicht darum gelten, weil wir uns nach ihnen richten und die Regeln der Gemeinschaft befolgen, sondern weil wir davon ausgehen, daß die anderen dies tun, und weil wir uns darauf verlassen. Auf diese Weise können wir andere ihrer Verstöße gegen die Normen wegen verurteilen, während wir selbst gegen sie verstoßen können, ohne uns darum als jemand fühlen zu müssen, der gegen Normen verstößt. Ohne diesen Spielraum könnten wir gar nicht handeln. Den höheren Zwang, der für die überindividuelle Geltung der Normen verantwortlich ist, sieht er in den Erwartungen den anderen gegenüber gegeben und in dem Umstand, daß wir von den anderen erwarten, daß sie erwarten, daß wir erwarten...etc. Er behauptet mithin eine soziologische Immanenz der Normen. Wir selber sind es, die die Geltung der Normen sichern, aber nicht als Individuen, sondern in der Form von Erwartungserwartungen an die anderen. Was die Normen in ihrer Geltung sichert, ist also nicht die Aktion, sondern die Interaktion, nicht das Handeln, sondern die Imagination.
Wenn es so schwierig ist, Normalität selbst in den Blick zu bekommen, ist vielleicht der bessere Weg, ihr Gegenteil in Augenschein zu nehmen, das Anormale. Auch hier hilft die etablierte Betrachtungsweise nicht weiter. Man begeht heute den Fehler, Geisteskrankheit lediglich als eine Abweichung von einer gesellschaftlich definierten Norm, d.h. als etwas Negatives zu betrachten und völlig außer acht zu lassen, daß sich “eine Gesellschaft in den Geisteskrankheiten, die einige ihre Mitglieder aufweisen, positiv ausdrückt, gleichviel, welchen Status sie diesen krankhaften Formen verleiht; ob sie sie nun ins Zentrum ihres religiösen Lebens stellt, wie das bei Primitiven häufig der Fall ist, oder ob sie versucht, sie auszubürgern, wie es in unserer Kultur geschieht.” Wenn man die Abweichung und den Abstand von der Norm zur eigentlichen Natur der Krankheit gemacht hat, so ist der Grund dafür in der Kulturillusion zu suchen. In unserer Gesellschaft will sich niemand in dem Kranken, den sie verjagt oder einsperrt, selbst wiedererkennen; sobald sie den Kranken ermittelt und seinen Defekt diagnostiziert hat, schließt sie ihn aus. Einerseits wird der psychologische Diskurs über Geisteskrankheiten immer beredter, auf der anderen Seite gerät der Wahnsinn in seiner ursprünglichen Heterogenität immer stärker in die Nähe der Sprachlosigkeit, und sein Drängen, aus dieser Stummheit zu gelangen, führt lediglich zu immer neuen Formen der Knebelung (Foucault).
Die Anerkennung der Normalität kommt der Sehnsucht des Einzelnen entgegen, so zu sein wie alle anderen und dadurch von dem Generalverdacht der Anormalität entlastet zu sein. Obwohl die Einheitlichkeit aller anderen nicht wirklich existiert, sondern nur in den Augen desjenigen, der sich anders fühlt oder nicht anders sein möchte, strebt jeder danach, in den Augen der jeweils anderen in ihr aufzugehen. Der sich derart nach Normalität sehnt, weiß nicht, daß die anderen so verschieden sind, daß jeder von ihnen von jeweils allen anderen hofft, als einer der ihren wahrgenommen und also als normal angesehen zu werden. Daß er gerade dadurch, daß er so zu sein versucht wie alle anderen, auffällt, daß er gerade durch seine angestrebte Unauffälligkeit, in Verdacht gerät, anders zu sein, ahnt er nicht. Je mehr jemand danach strebt, den anderen zu gleichen, desto mehr gewinnt er Konturen als jemand, der womöglich anders ist und seine Andersheit zu verbergen versuchen muß. Je mehr er dazu entschlossen ist, sein Anderssein zu verbergen, desto offenbarer wird es. Je eindeutiger er die Dinge und Worte zu haben wünscht, desto stärker gerät ihm alles zur Doppeldeutigkeit.
Der Protagonist in Alberto Moravias Erzählung „Il Conformista“, ein Mann namens Clerici, dachte, er habe als Kind (s)einen Chauffeur, der ihn verführen wolle, mit dessen Pistole erschossen. Diese Szene glaubt er wie ein Stigma für jederman sichtbar auf seiner Stirne zu tragen, als „die Schmauchspur seiner Kindheit“. Er glaubt, von dem Eindruck, den er stets zu machen meint, ablenken zu müssen, und ist geradezu von der Furcht besessen, wieder zum Mörder zu werden. Am Ende er wird es gerade deswegen. Der antisemitische Faschismus deckt seine Tat. In einer anderen Gesellschaft fürchtete er, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Deshalb begrüßt er den Faschismus. Der Faschismus mit seiner illusionären Idealisierung einer allgemein anerkannten Normalität verhalf ihm dazu, sich mit seiner Andersheit in Gesellschaft zu fühlen. Er lieferte ihm den narzißtischen Selbstschutz gegen die Furcht, ausgeschlossen werden zu können.
In unserem tiefsten Innern wissen wir, daß sich die auf Normalität verpflichtete Gemeinschaft, von der wir Schutz erwarten, gegen uns kehren kann, daß sie sich von einer Schutzmacht in eine Vernichtungsmaschine verwandelt kann. Da will man schon sicherheitshalber auf der richtigen Seite stehen. Dies war im Faschismus so, und es ist auch heute so.
Samstag, 1. Januar 2011