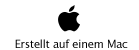Der Schrei der Eule 2
Er wollte das Mädchen wiedersehen. Vielleicht zum letzten Mal, dachte er. Aber das hatte er schon oft gedacht.... Robert stellte den Wagen auf einem Waldweg in der Nähe des Hauses ab, in dem das Mädchen wohnte, und ging zu Fuß weiter. An der Einfahrt verlangsamte er seine Schritte, ging bis zu dem umgefallenen Basketballbrett am Ende der Einfahrt und daran vorbei auf die angrenzende Wiese. Die junge Frau war wieder in der Küche.... Das erste Mal hatte er das Mädchen an einem Samstag gesehen, einem strahlenden, sonnendurchfluteten Samstag Ende September, an dem er ziellos durch die Gegend gefahren war. Sie hatte einen kleinen Teppich auf der Veranda ausgeschüttelt, als er hier vorbeikam, und obwohl er sie nur etwa zehn Sekunden lang gesehen hatte, war ihm die Szene sehr vertraut vorgekommen, wie ein Bild oder eine Person, die er von irgendwoher kannte.... Ob sie hübsch war oder nicht, konnte er nicht beurteilen, und darum ging es ihm auch nicht. Aber worum dann? Robert hätte es nicht in Worte fassen können. Doch als er das Mädchen zum zweiten und, zwei oder drei Wochen später, zum dritten Mal gesehen hatte, war ihm klargeworden, was ihm an ihr gefiel: ihre ruhige Gelassenheit, ihre offensichtliche Liebe zu dem heruntergekommenen Haus, ihre spürbare Zufriedenheit mit dem Leben, das sie führte...
Die Passage in Patricia Highsmiths Roman „Der Schrei der Eule“ hat auffällige Ähnlichkeit mit einer zentralen Passage in Goethes „Werther“:
Ich ging durch den Hof nach dem wohlgebauten Hause, und da ich die vorliegenden Treppen hinaufgestiegen war und in die Tür trat, fiel mir das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich je gesehen habe. In dem Vorsaale wimmelten sechs Kinder von elf zu zwei Jahren und ein Mädchen von schöner Gestalt, mittlerer Größe, das ein simples weißes Kleid, mit blaßroten Schleifen an Arm und Brust, anhatte. Sie hielt ein schwarzes Brot und schnitt ihren Kleinen rings herum je ein Stück nach Proportion ihres Alters und Appetits ab. Gab’s jedem mit solcher Freundlichkeit, und jedes rief so ungekünstelt sein „Danke!“, indem es mit den kleinen Händen so lange in die Höhe gereicht hatte, ehe es noch abgeschnitten war, und nun mit dem Abendbrote vergnügt entweder wegsprang, oder nach seinem stillern Charakter gelassen davonging nach dem Hoftore zu, um die Fremden und die Kutsche zu sehen, darin ihre Lotte wegfahren sollte. (Die Leiden des jungen Werther)
Daß die Frauen mit etwas beschäftigt sind, und sei es mit ihren Gedanken, das erlaubt uns nicht nur, sie unbemerkt zu betrachten wie einen Besitz, dessen Hingabe wir erwarten können, es scheint auch die Voraussetzung dafür zu bieten, ja, dies kann sogar der Anlaß dafür sein, daß ich mich in sie verliebe. Roland Barthes, nachdem er das Wesen des Sichverliebens, des Hingerissenseins beim ersten Anblick, als ein Geraubtwerden charakterisierte, bei dem der ursprüngliche Frauenraub sich in das Gegenteil einer Hypnose durch das Objekt verkehrt, kommentiert die Passage im „Werther“ in diesem Sinne:
Als Werther Lotte “entdeckt”, (als der Vorhang sich auftut und das Bild in Erscheinung tritt), ist Lotte damit beschäftigt, Brot zu schneiden. Die Frau, in die Hanold sich verliebt, ist eine Gehende (Gradiva: die “Voranschreitende”) , die überdies in den Rahmen eines Basreliefs gebannt ist. Was mich fasziniert, mich hinreißt, ist das Bild des Körpers in einer Situation. Was mich erregt, ist eine Silhouette bei der Arbeit, die mir keinerlei Aufmerksamkeit schenkt… Denn die Arbeitshaltung garantiert mir gewissermaßen die Unschuld des Bildes: je deutlicher mir der Andere die Zeichen seiner Beschäftigung, seiner Gleichgültigkeit (und meiner Abwesenheit) vermittelt, desto sicherer bin ich, ihn zu überraschen, so als ob ich, um mich zu verlieben, die unvordenklich alte Förmlichkeit des Raubes zu erfüllen hätte, nämlich die Überraschung (ich überrasche den anderen, und gerade dadurch überrascht er mich: ich war nicht darauf vorbereitet, ihn zu überraschen).
(Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe. Die Verzückung)
Es ist nicht ohne höllische Ironie, daß genau diese Szene in von Patricia Highsmiths Roman die fatale Kettenreaktion auslöst und dem Protagonisten zum Verhängnis wird.
Dienstag, 25. Januar 2011