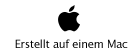Situationismus
Der Situationismus war, dem Vernehmen nach, in den 60er Jahren die vielleicht historisch letzte Anstrengung, die Welt von einem archimedischen Punkt aus aus den Angeln zu heben: von dem Punkt eines nicht entfremdeten, in der Freiheit durch keine institutionelle Ordnung beschnittenen Lebens. Für die Protagonisten dieser Bewegung, die sich immun wähnten und immunisieren wollten gegen jede Form von Ideologie, bestand die einzig glaubwürdige Form von Gesellschaftskritik in einer Art revolutionärem Existenzialismus an der Grenze zur Anarchie, wobei die Aktionen den Charakter eines Spiels nie verlieren sollten.
Die Situationisten diagnostizierten die Enteignung des Lebens von außen, die durch eigenes Zutun noch verheerender wird, vermittels all der Differenzierungen, die es im Laufe der Modernisierung und des Siegeszugs des Kapitalismus erfahren hat, die auch duch den Sozialismus nicht aufgehoben würden. Besonderes Augenmerk galt der Bewegung die Teilung der Lebenszeit in Arbeitszeit und Freizeit. Gefangen in der Tretmühle der Arbeit und eingeschlossen in ihr vermeintlich besonderes Privatleben werden die Individuen wehrlos dagegen, zu automatisierten Konsumenten erzogen zu werden. Guy Debord propagierte dagegen eine souveräne Lebensgestaltung, die alle äußerlichen Trennungen und Zuschreibungen durchkreuzt und ihrem lähmenden Einfluß unbeirrt einen selbstkontrollierten und selbstzentrierten Lebensentwurf entgegensetzt.
Eines der Zauberwörter, die als Kampfparolen fungierten, hieß: détournement – was soviel heißt wie umherschweifen, auch Umleitung, Umkehr, aber auch stehlen, entwenden. Kulturelle Praktiken werden denen, die sie annektierten und zu etwas machten, woran sie verdienen konnten, zurückgeraubt und mit neuem Sinn gefüllt, so daß sie und die Individuen wieder zu sich selber kommen - gewissermaßen in einem umgekehrten Cargo-Kult. Die Situationisten wollten das entfremdete Leben nicht nur als falsches Bewußtsein kritisieren, sondern es praktisch ändern, in der tätigen Ausübung von Gegenentwürfen im städtischen Raum, vermöge derer sich der Handelnde ebenso verändert wie die Realität, mit der er sich auseinandersetzt. Die Aktionen machen sichtbar, daß die Strukturen der sozialen Realität auch ganz anders sein könnten, sie bringen ihre vergessene Kontingenz auf stimulierende Weise wieder zum Vorschein. Damit dieses Kunststück gelingen kann, muß das Moment der Absicht und des Vorsatzes so weit wie möglich zurückgenommen und ausgeschaltet werden und muß stattdessen dem Zufall, dem Unverhofften Raum gegeben werden. Die Techniken sind so vergleichbar der désinvolture Adornos, die ein Nichtwollen im Wollen bezeichnet, ein Nichttun im Tun, dem körperlich vorgearbeitet werden muß. Die Situationisten forderten beispielsweise in diesem Sinne, alle privaten Autos aus der Stadt zu verbannen und nur Taxis zu erlauben, da zielloses Fahren mit eigenem Auto per se nicht möglich sei.
Besondere Angriffsziele solcher Raubzüge waren die Werbung, welche die Situationisten als zynische Propaganda entlarvt sehen wollten, und die Erziehung, in ihren Augen das Training von klein auf für den Verzicht auf das Leben zugunsten eines Überlebens in dem Zustand eines „bis zum Ende verschobenen Selbstmords“. Im Idealfall lief dieses Programm auf einen lebenslangen Prozeß des permanenten Umgestaltens und Abänderns hinaus, bei dem jeder Einzelne Herr seines eigenen Schicksals ist und nur einer Regel unterliegt: Genuß ohne Einschränkung.
Das wichtigste Mittel der Wiederaneignung des geraubten Lebens, das primäre Instrument solch unerschrockenen Selbstschöpfertums, ist die freie Konstruktion von “Situationen”. Der Begriff bezeichnet zunächst die kleinste soziologische Einheit, zugleich aber, in der Existenzialphilosophie Sartres stark aufgeladen mit Eigentlichkeit und dem heiligen Ernst der Entscheidung, die Idee eines authentischen Alltagslebens, das sich noch nicht von uns abgelöst hat und so Inbegriff ist für die Beanspruchung aller Augenblicke und Ereignisse unter eigener Regie. Nicht Moral, nicht Anstandsregeln, Pflichtgefühl, politische oder andere Systeme öffnen den Weg des Immerneuen, der ins Glück permanenter Wunscherfüllung führt, sondern allein konkrete Situationen, in die man ohne Vorbereitung hineingerät und die man ernst nimmt als einmalige und nicht wiederkehrende Gelegenheit.
Das Programm des Situationismus ist vor allem ein Raum-Konzept. Im Zentrum steht die Strategie der „dérive“, des Abdriftens. Diesen Begriff hatte Gilles Ivain beigesteuert. In Übereinstimmung mit seinen Ideen meinte man, die Gesellschaft am besten von ihrem Stadtraum her verändern zu können: durch bedingungslose, rücksichtslos regelwidrige Aneignung seitens der Bewohner. Wo die kapitalistische Konsumlogik das ganze Stadtleben auf reibungslose Abwicklung der Geschäfte und Verkehrsflüsse ausrichtet, ist das abdriftende Umherschweifen am Unerwarteten der sich immer neu fügenden Situationen interessiert.
Wie in einem Pilotprojekt wurde in den Wanderungen der Situationisten vorgwegenommen, was in den Unruhen des Pariser Mai in einer Massenbewegung kulminierte und was Henri Lefebvre in seinem Buch „Revolution der Stadt“ in Form einer kreativen Marx-Lektüre aufgreifen und soziologisch fruchtbar machen sollte. Oberstes Ziel dieser stadträumlich begründeten „Theorie des aktiven Nihilismus“ ist die größtmögliche Erlebnisfülle in jedem Moment. Es geht um permanente Abwechslung, ritualisierte Spontanität ohne Anflug von Langeweile, ohne Passivität und ohne tote Zeit, wie es Raoul Vaneigem in seinem „Traktat über die Lebenskunst zu Händen der jungen Generation“ formulierte: „Wir wollen keine Welt, in der die Sicherheit vor dem Hungertod mit der Aussicht darauf erkauft ist, an Langeweile zu sterben“.
Die Ambition, die Stadt von einem Raum der Trennungen und Ausschließungen zu einem offenen Raum unrestringierter Erfahrung zu machen, in dem sich das ganz Andere entfalten kann, hat viel gemein mit späteren theoretischen Überlegungen Michel de Certauxs und Michel Foucaults etwa. In gewisser Weise ist das Programm der Situationisten auch als Fortsetzung der modernen Kunst mit anderen Mitteln anzusehen: als Projekt, die Brücke zwischen Kunst und Leben zu schlagen - der Anspruch von jeher der Avantgarde, der Dichotomie von Kunst und Leben ein Ende zu setzen. Ästhetik als Existenz, auch das steckt im pathetischen Begriff der Situation. Dieses Alltagskonzept hat den Charakter eines Kunstwerks. Eines Kunstwerks allerdings, das niemals zu einem Ding erstarrt, das nicht in einem Museum ausgestellt werden kann, eher im Sinne einer Performance, einer unwiederholbaren allerdings und ohne Publikum, denn – und darin kommt auch das Rousseau’sche Fest zum Zuge, das der Trennung von Akteur und Zuschauer als eigentlichem Resultat von Entfremdung opponiert und ihr als Naturzustand vorausgeht – im Sinne eines Experiments also, das nicht zu etwas dienen soll, sondern sich selbst genügt, sein Ziel in sich selber findet. Das Fest der Situationisten ereignet sich nicht als Aufführung vor den Augen bezahlender Zuschauer, sondern jeder ist Akteur und Zuschauer in einer Person. Experimente der Kunst sind ja häufig vorweg an Mitteln interessiert, „lassen gern auf den Zweck vergebens warten“, wie Adorno schrieb, als Gegensatz zum unreflektierten Weitermachen. Hier aber ist das Mittel bereits der Zweck. Zudem sollen die Gebilde Züge enthalten können, die im Produktionsprozeß nicht absehbar, die nicht planbar sind. So daß, subjektiv gesehen, der Künstler von seinen eigenen Gebilden überrascht werde. „Darin wird Kunst sich des Moments des Zufalls bewußt“, wie Adorno weiter notierte. “Darin enthält Kunst ein Moment der Unverantwortlichkeit. Das mündet im Extrem in das Vergnügen moderner Kunst, Kunstwerke durch den Prozeß ihrer eigenen Hervorbringung ganz zu ersetzen, im Intentionslosen.“ Laßt und also unverantwortlich sein, wie später Rem Koolhaas Guy Debord paraphrasierte, ohne seine Quelle preiszugeben. In nichts anderem übten sich die Situationisten, in der körperlichen und geistigen Durchdringung der Stoffmassen des Stadtraumes im Erfinden verantwortungsloser Techniken zur subjektiven Integration des Intentionslosen. Sie erkennen den Wert der Stadt darin, daß sie dem Absichtslosen Raum gibt, dem was sich ergeben kann, ohne daß man einem Programm gehorcht oder weil man einer Kategorie oder einem Verein angehört. Wenn also von einem Programm des Situationismus die Rede sein kann, dann nur im Sinne eines Anti-Programms.
Die Situationisten wandten sich explizit gegen jede Form der Theatralisierung des Lebens und des Raumes. Am besten sei es, wenn gar nichts passiere. Sie richteten ihre Aktivitäten aber insbesondere gegen die Modernisierung des Alltagslebens im Zeichen des Funktionalismus, wie er in der Wirtschaft und in der Architektur seine perversen Triumphe feierte. Das Alltagsleben war ähnlichen Veränderungen ausgesetzt, wie in der industriellen Revolution der Arbeitsprozeß, der, in immer kleinere und sich wiederholende homogene Einheiten zerlegt, sein sozial-räumliches Pendant in der Auffassung der Stadt als Maschine finden sollte. Man hat heute Mühe, sich die inhumane Aggressivität des funktionalistischen Furors zu vergegenwärtigen, wo wir uns an die Umgestaltung der Welt in ihrem Sinne längst gewohnt haben. So sprach Le Corbusier beispielsweise als eine Art Dr. Frankenstein der Architektur von der “Desolidarisierung” der Elemente und ihrer Neuzusammensetzung nach Maßgabe ihrer funktionalen Aufgabe. Man wollte damals das, was sich täglich in einer Großstadt vollzieht, rein herausarbeiten, ohne die Schlacken vorindustrieller Sentimentalität, und es so organisieren, daß die Reibungsverluste vermindert würden und die Einzelteile sich nicht gegenseitig hemmen oder blockieren. Man wollte die Leistung der Stadt als Maschine erhöhen und dachte, mit solcher Lakonie dem Wohlergehen des Individuums zu dienen und zugleich Schönheit in die Welt zurückzubringen. "Der tägliche Zyklus der Aktivitäten” in den Stadträumen sollte sich als "Kette von Operationen” vollziehen dürfen, wie das in den modernen Fabriken Nordamerikas zu bewundern war.
Inbegriff von Ordnung und Schönheit war die Entmischung der Nutzungen nach dem Muster der innerbetrieblichen Organisation. Als "Funktion” war die Aktivität auch des Individuums als Teil eines gesellschaftlichen Ganzen begriffen. Le Corbusier in seinem Werbetext zur Ville Radieuse: "Die Organisation der kollektiven Funktionen der Stadt wird die individuelle Freiheit bringen. Einen Menschen, diszipliniert in seinen Beziehungen zum Ganzen”. Und an anderer Stelle: "Bei Ford ist alles Zusammenarbeit, Einheitlichkeit der Absichten, Einheitlichkeit des Ziels, Übereinstimmung der Totalität der Gesten und Gedanken”.
Der Anpassung an den Rhythmus der Maschinen entspricht die Unentbehrlichkeit des regulären Lebens, was dominiert ist die Uhr. Wie in Chaplins “Modern Times” bewirken individuelle Regungen den Stop der Maschinerie, geraten zur Sabotage. Kernstück dieser Rationalisierung oder "Sozialmontage” ist der "Zweitaktrhythmus” von Arbeit und Freizeit, der sich im Leben des Städters herausgebildet hatte, das Wechselbad von Verausgabung und Wiederherstellung von Arbeitskraft. Die öffentlichen Räume und kollektiven Versammlungsorte werden in diesem Konzept auf die hygienische Funktion der Regenerierung der Arbeitskraft reduziert, und die Straße wird dem Regime der Zirkulation unterworfen.
Die Gesellschaft insgesamt übte sich in der Nachahmung der Großunternehmen. "Die diabolische Tyrannei der Unordnung versäumt keine Möglichkeit zum Handeln; es genügt, daß ihr Gelegenheit geboten wird durch die mißglückte Anordnung von Gebäuden und Zugangswegen, z.B. durch die Unterbrechung zusammenhängender Folgen oder das unangebrachte Vorhandensein von Wegen, Straßen, Plätzen, Alleen etc., die zu nichts anderem dienen, als zum Vorwand zu werden für Spaziergänge, unnützen Verkehr von Produkten und Materialien ...” Beim Blick aus dem Flugzeug werde es einem klar: "Der Mensch ist eine Ameise mit den Gewohnheiten eines präzisen Lebens, einem einheitlichen Verhalten”.
Nun erlaubten sich die Situationisten, gerade auf jenen unnützen Spaziergängen und mißglückten Anordnungen und unnützen Verkehrswegen zu bestehen, und sie zogen den heißen Blick auf Augenhöhe mit den Passanten dem kalten Blick von oben aus dem Flugzeug vor. Und wenn man meinte, im Spektakel des Konsums und der Massenmedien sei die strenge Funktionalisierung aufgeweicht und überholt, dann wiesen sie nach, daß die Stadt-Maschine und die Taylorisierung des Sich-Bewegens im Raum durch das Spektakel nicht abgeschafft, sondern in ihm aufgehoben und forciert sind, ebenso weiterentwickelt wie unsichtbar gemacht. Es war zu etwas geworden, das die Stadtbenutzer verinnerlicht und habitualisiert haben. Sie betreiben, indem sie sich zu amüsieren meinen, ihre Selbstaussperrung aus dem, was Stadt der Idee nach sein könnte. Sie machen die Stadt selbst zu etwas, das ihnen immer weniger gehört. Die Frage, wie man die Stadt bewohnen kann, ist gleichbedeutend geworden mit der Frage, wie man es schafft, sich nicht am Spektakel zu beteiligen, und die Orte aufzusuchen, wo nichts geschieht, wo die Stadt schweigt.
Man könnte die situationistische Revolte auch als Aufstand der Selbstachtung bezeichnen. Für die Situationisten ist das Leben in einer räumlichen Syntax gefangen und entehrt. Die Zurichtungen erfolgen körperlich-sinnlich. Unsere ureigenen Organe Leib und Blick sind das, was uns uns selbst entfremdet. In die falschen Verhaltensweisen und Auffassungen werden wir eingeübt, sie werden uns antrainiert. Wir können uns von unserer tätigen Selbstentfremdung nicht mehr distanzieren. Wir sind Opfer einer Politik, die die Normen festschreibt und die Körper entsprechend korrigiert oder therapiert, die sie faltet, wie Foucault sagt, für den die Anprangrung dieser Ungeheuerlichkeit geradezu zur Obsession wurde.
Materiellen Niederschlag findet diese Dressur in der Stadtgestaltung, in der Architektur. Sie hat einen nicht zu überschätzenden Anteil daran, wie wir leben und wie wir die Welt und uns selbst erleben, am Aufbau und an der Stabilisierung der Selbstverständlichkeitsstrukturen unserer Alltagswelt und daran, wie es uns gelingt, von uns selber, die wir diese Welt konstituieren, abzusehen, und die Strukturen der Außenwelt und damit unsere Verhaltensnormierungen als etwas zu erfahren, das nicht wegzudenken ist, das gar nicht anders denkbar ist. Sie ist die Infrastruktur einer sich in den Körper einnistenden und um den Körper herum legenden Kultur der Gestik und der Dinge, in deren als schicklich und richtig empfundenen Gebrauchsweisen das gesamte Alltagsleben sozial kodiert wird und sich in dieser Kodiertheit als Konstituiertes und damit Kontingentes unsichtbar macht.
In der Bewegung des Körpers im Raum, in der Kunst der Geste, der Anmut, vollzieht sich zunächst die individuelle Aneignung der Existenz. Die unscheinbaren Gesten und beiläufigen Gebärden, das sind unsere Seins- und Handlungsweisen, die keiner Begründung bedürfen. Sie sind das Leben selbst. Das Subjekt ist dieser Akt selbst. Foucault spricht immer wieder mit großer Emphase von Anmut, von den Praktiken der Geschicklichkeit, der Bedeutung des rechten Augenblicks. Das Spiel der Anmut ist selbst der Lohn der Arbeit. Die Impressionisten hatten sie entdeckt, sie verweigerten sich dem steifen Kanon der ikonographisch vorgeschriebenen, schicklichen Posituren und interessierten sich für die Geschmeidigkeit in der Unbeholfenheit. „Anmut ist in der Bemessenheit der Bewegungen, verknüpft mit dem Maß, das nicht das der Perfektion ist“, um Foucault erneut zu zitieren.
Die Geste ist die Sichtbarkeit des Stils der Existenz und eine der Möglichkeiten, dem eigenen Leben Form zu geben und die Beziehung zum anderen herzustellen, etwas, was die Brücke zum anderen schlägt. In die Gesten sind zugleich die ethischen Werte und moralischen Normen wirksamer eingezeichnet als auf dem Papier des Gesetzes. Die Moral einer Epoche ist erkennbar in der Ästhetik der Geste, in der sie sich selber inszeniert. Auch die Machtverhältnisse sprechen sich in ihnen aus. Man sollte sich, wie Foucault warnt, von der Deutlichkeit der Gestennormierung etwa des Militärs nicht dazu verleiten lassen, die subtileren Mechanismen, die sich der Gestik in anderen Bereichen bemächtigen, zu übersehen, sondern sollte aufmerksam sein für diese “dunklen, anonymen Gesten, ohne genaues Datum, durch die eine ganze Gesellschaft sich gebunden findet, ohne daß sie sich davon Rechenschaft ablegen würde.”
Der Gedanke liegt nahe, genau hier anzusetzen, mit einem Gegentraining, um die Enteignung der Körper durch Gestenkontrolle und räumliche Strukturen transparent und durch Gegenübungen rückgängig zu machen und zu entmachten. Die Individuen müssen ihre Gesten neu erfinden, eine Stilistik der Existenz durch stumme Gesten neu begründen. Insofern ist Foucaults Konzept der Lebenskunst auch eine Fortführung des Situationismus.
Debord propagiert das „eilige Durchqueren abwechslungsreicher Umgebungen“. Er forderte dazu auf, eine “Topographie der Leidenschaften und Stimmungen einer Stadt” in „psychogeographischen Karten festzuhalten. Stets auf der Lauer nach dem unvorhersehbaren Ereignis meinten die Situationisten, den funktionalen Urbanismus und seine Verhaltenssyndrome mit dem Konzept des Herumstreunens zu unterlaufen und unschädlich zu machen. Auf ihren Ausflügen und Wanderungen verwandelten sie die Stadt in ein aufgeschlagenes Buch, indem sie nachts auf Hausmauern Inschriften anbrachten wie: „niemals arbeiten“. Dem permanenten Aufbrechen von Gewohnheiten, die sich zu einer Psychogeographie verfestigen, galten ihre Methoden der Abschweifung. Eine Technik hieß: Orientieren mit falschem Stadtplan: Man machte es sich beispielsweise zur Aufgabe, sich mit einem Plan von London in Paris zurechtzufinden. Nicht der möglichst reibungslose Verlauf einer Ortsveränderung in einer auf die Funktion der Infrastruktur reduzierten Stadt war das Ziel, sondern sich zu verlaufen, nicht Effektivät sondern Desorientierung.
2
Die gesellschaftlichen Bedingungen haben sich seither verändert. Wenn ich lese, wie Ulrich Beck unsere Gesellschaft beschreibt, als “Risikogesellschaft” und “reflexive Moderne”, dann fallen mir etliche Parallelen mit dem ins Auge, was die Situationisten als Apotropäum, als Gegenzauber gegen das Spektakel und die fixe Idee der Funktionalität empfahlen. Aber das Bild ist verwackelt. Es scheint so, als wären die Methoden, die damals für die Befreiung von den Fesseln eines entfremdenden Alltagslebens ersonnenen wurden, heute eine Beschreibung dessen, dem wir ausgesetzt sind und das wir alle erfüllen müssen, um unseren Job zu machen. So wie das Authentizitätspathos und der kraftmeierische Gestus der Existentialisten in die hemdsärmelig pädagogisch-therapeutische Alltagssemantik eingeflossen ist, so wird die dérive zum allgemeinen Schicksal der Lebensbewältigung. Der einstige archimedische Punkt außerhalb ist in das Phänomen hineingewandert und Teil des Symptoms selbst geworden. Was einst Revolte war, ist zum Gebot geworden, ja zum Verhängnis.
Die alten Wertesysteme und Institutionen, gegen die die Situationisten Front machten, sind heute nicht mehr intakt und geben keine Orientierung mehr, wenn wir auch nicht von ihnen lassen können. Z.B. klafft ein Widerspruch zwischen dem Arbeitsethos und der mangelnden Möglichkeiten, den Wohlstand auch zu genießen, zumal die Sicherheit, bei rigider Befolgung der Regeln einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, nicht mehr gegeben ist, da man jederzeit der Rationalisierungspolitik zum Opfer fallen kann. Die alte Regel, nach der Fleiß und Disziplin einen sicheren Arbeitsplatz und eine guten Rente garantieren, gilt nicht mehr. Das läßt den Sinn der Einordnung ins Kollektiv fraglich erscheinen. Niemand weiß mehr, bis zu welchem Punkt man die Entbehrungen des Arbeitslebens akzeptieren muß und wann Muße und Vergnügen zu ihrem Recht kommen dürfen. Und niemand weiß mehr, wie man der Verantwortung für ein eigenständiges Leben genügen kann, ohne sich selbst zu betrügen. Als Entschuldigung kann man andererseits das Faktum nicht beanspruchen. Wir tragen die alten Werte und Regeln noch mit uns herum und sehen die Welt unter falschen Prämissen.
Heute sind nicht nur die Traditionen und Gewohnheiten, die Institutionen und Rituale zerfasert und ihrer sinnstiftenden Effekte beraubt, auch die damaligen zersetzenden Modernisierungen sind nicht mehr bindend. Die Modernisierung selbst, dieses anpassungsfähige Chamäleon, hat ihren Charakter geändert. Die Zerstückelungen sind heute nicht mehr ideologisch gerichtet und überbaut. Sie schreiten fort, und es gibt immer andere hybride Neuzusammensetzungen, aber jene funktionalistisch-mechanische Einheit der Maschine ist aufgelöst. Von den Menschen wird nicht mehr Unterwerfung erwartet, sondern werden Unternehmertugenden verlangt. Es geht nicht mehr um Disziplinierung und Lagerordnung, sondern zum Überleben wird Flexibilität gefordert und erwartet, daß wir – auch im Konsum - unsere kreativen Fähigkeiten entfalten und unsere Toleranz für Überraschungen kultivieren. Wir sollen nicht nur funktionieren, sondern uns selber etwas einfallen lassen. Wir sollen unsere emotionalen Ressourcen einbringen. Man erwartet, daß wir bei der Arbeit träumen, ohne einzuschlafen. Unter Bedingungen der Knappheit wird von uns verlangt, daß wir exzessiv wünschen. Das innere Wohlbefinden ist notwendig, denn um zu handeln, müssen wir unsere Affekte mobilisieren. Dabei können wir uns nicht erlauben, zu warten, bis wir unsere Konflikte geregelt haben, während die Anforderungen zunehmen. Handlungsfähigkeit muß zu einer kontextunabhängigen Kompetenz werden. Individualisierung vollzieht sich unter Rahmenbedingungen, die Selbständigkeit gerade behindern oder unmöglich machen. Die Autonomieansprüche müssen gelebt, sie können zugleich aber nicht eingelöst werden. Jeder Einzelne ist gezwungen, das Leben auf Grund eigener Entscheidungen einzurichten. Und das Risiko für alle diese Entscheidungen selber zu tragen. Zugleich hat er keinen Einfluß auf die Bedingungen, unter denen er arbeitet und existiert. Wir erleben den Zusammenstoß der unbegrenzten Möglichkeiten mit dem Unbeherrschbaren, von Allmacht mit Ohnmacht. Von Vorherbestimmtheit und Absichtslosigkeit.
In dieser umfassenden Entriegelung des Alltagsleben fällt dem Individuum in seiner ganzen Unfreiheit die alleinige Verantwortung für die Gestaltung und den Erfolg wie auch für die Fehlschläge zu. Arbeitslosigkeit kann nur als eigenes Versagen interpretiert werden. Jeder hat eine Risikobiographie und eine Ohnmachtsgeschichte. Die von der Gesellschaft geforderte Anpassung an veränderte Verhältnisse wird von derselben Gesellschaft verraten. Sie fordert etwas, das sie zugleich bestraft.
Vordergründig ist die Verteilung von Chancen und Aufgaben durch Arbeit und Leistung reguliert. Tatsächlich ist das Leistungsprinzip aber im Verschwinden begriffen. Der globale Markt hat die Zuweisungsmechanismen von Statusgewinnen verunklärt. Man spricht von der durch die Internetbörse radikalisierten "Wirtschaftskultur der Zufälligkeit”, die dem Leistungsprinzip die Grundlage entzieht und stattdessen die durch den Zufall günstiger Gelegenheiten erzielte Ertragsgröße sozial honoriert. In dieser Unabhängigkeit vom Leistungsprinzip soll ein neuer, noch namenloser Typus den „Selfmademan“ ablösen, wie er Anfang des Jahrhunderts von Robert Merton als anomisches Zerfallsprodukt der traditionellen Gesellschaft beschrieben wurde. Der gelungene Coup legitimiert Rücksichtslosigkeit. Prestigeglück winkt als Honorierung von Risikobereitschaft, wobei die Verteilung der Prämien derjenigen in TV-Rateshows gleicht. Alles ist ein Spiel. Aber mit eingebauten Tücken, die man mit Wittgenstein folgendermaßen kennzeichnen kann: „Es ist alles so verzwickt geworden, daß, es zu bewältigen, ein ausnahmsweiser Verstand gehörte. denn es genügt nicht mehr, das Spiel gut spielen zu können, sondern immer wieder ist die Frage: ist dieses Spiel jetzt überhaupt zu spielen und welches ist das rechte Spiel?” Gesellschaft ist unwahrscheinlicher geworden. Die gegenwärtige Gesellschaft ist die unwahrscheinlichste, die es je gab. Nicht zufällig fiel Maggy Thatcher ein zu sagen: Gesellschaft gibt es nicht.
Trotz der umfassenden Unsicherheit und der greifbaren Kontingenz gehört das Bejubeln der Befreiung von den fesselnden Bindungen der Vergangenheit nach wie vor zur Alltagssemantik und ihren triumphalen Gewißheiten. Als wären wir nun endlich am Ziel angelangt. Werte, die früher Teil eines bürgerlichen Charakters waren, sind heute Bausteine zu einer Entwurf-Biographie. Treue, Fürsorge und Ordnunggssinn beschreiben keinen sozialen Charakter mehr, sondern definieren Haltungen, die mit anderen zum gewünschten und unverdächtigen Selbstbild kombiniert werden. Weil diese neue Bürgerlichkeit reflexiv ist, korreliert sie nicht per se mit bürgerlichen politischen Programmen. Sie breitet sich überall da aus, wo der Staat verschwindet, auf den Brachflächen, die sein Rückzug hinterläßt. Sie entspringt nicht der Gesellschaft, sondern der Not, man könnte auch sagen dem Augenblick.
Die Scheinselbständigkeit ist Maskerade eines prekären Lebenswandels ohne Eigentum. Wer aber diesen Weg nicht einschlägt, diese gebotene Chance nicht ergreift, der gerät ins Fadenkreuz der Schmarotzerschelte, da er das allgemeine Budget und damit die Leistungsfähigkeit der Gemeinschaft belastet. Persönliches und kollektives Fehlverhalten, welches die Schadenssumme und damit den Versichungsbeitrag für alle in die Höhe treiben kann, gerät so in den Blickwinkel öffentlicher Aufmerksamkeit und wird im günstigsten Fall durch eine höhere Risikoklasse sanktioniert. Im Normalfall wird dem Verursacher von der Versicherung gekündigt. Das Füreinander-Einstehen steht unter dem Vorbehalt, daß jeder seine Schadensrisiken selbst minimiert. Damit wird die richtige Lebensführung zu einer Frage der Vermeidung individuellen Verschuldens von Knappheit, und die Solidarisierung der Starken mit den Schwachen einer unerträglichen und, wie jeder leicht einsehen wird, unzumutbaren Belastung ausgesetzt.
Man meint, der Situationismus sei eine individualistische Emanzipationsbewegung gewesen. Auch wenn die Gruppe um Guy Debord immer kleiner wurde, bis er am Ende nur selber übrigblieb, bevor er sich das Leben nahm, die Idee, die sich in ihren Aktionen und Manifesten Ausdruck verschafft, ist eine Vision der Geselligkeit, der Freundschaft, die in einer neuen Gestik zu sich selber findet und sich im städtischen Raum wiederzufinden beansprucht. Es ist ganz im situationistischen Geist, wenn Foucault von der “Notwendigkeit des Experiments” spricht, “neue Formen der Gemeinschaft, des Zusammenlebens, der Lust zu suchen”.
Heute geht es nicht primär um den Aufweis von Freiheiten gegen scheinbar unfrei machende Institutionen – die Freiheiten werden uns gratis nachgeworfen, wir sollten uns vor ihnen hüten. Nicht im mangelnden Freiheitsbewußtsein liegt heute das Problem der Lebensführung, sondern darin, wie sich trotz der Fülle von „Kontroversen und Zweifeln“, Unsicherheiten und double-binds zu „festen Punkten“ gelangen läßt. Schon den Situationisten ging es nicht nur um Befreiung, sondern um das Durchprobieren von denkbaren Urszenen einer anderen, bewußten Vergesellschaftung. Eine der situationistischen Techniken hieß: „das mögliche Rendevous“: Zwei einander unbekannte Personen machen sich von unterschiedlichen Orten auf, zu einem nicht verabredeten Treffen. Um eine Chance zu haben, einander zu begegnen, müssen beide mit möglichst vielen Passanten Kontakt aufnehmen. André Bretons Roman “Nadja” kann man so lesen, als gäbe er ein solches Treffen zu Protokoll.
Derlei Experimente erforderten es, die Oberfläche des Spektakels zu durchbrechen, in der sich das Soziale verlaufen und verkrustet hat. Am skandalösen, häßlich knackenden Geräusch dieses Durchbrechens hat man sie gemessen. Ihre Botschaft an uns lautet anders. Und darin liegt vielleicht ihre eigentliche, noch ungezündete Sprengkraft: Wenn seinerzeit sich die Situationisten angeblich aufmachten, gegen die Routinen zu revoltieren und die erstarrten Raumaneignungsmuster zu verflüssigen, so wäre es heute nicht weniger revolutionär, das Recht auf neue Gewohnheiten zu erkämpfen. "Die wahre Freiheit”, wie Claude Lévi Strauss sagt, “liegt in dauerhaften Verhaltensweisen, Vorlieben, in einem Wort: Gewohnheiten. Eine Form von Freiheit, die ständigen Angriffen ausgesetzt ist durch all jene theoretischen Ideen, die als rational gelten.“
Donnerstag, 27. Januar 2011