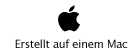Der Verlassende
Verlassen und Verlassenwerden sind Gegebenheiten des Lebens und ein zentrales Thema der Weltliteratur. Während aber diejenigen, die verlassen wurden, den Ton angeben, Geschichten, in denen jemand verlassen wird, die von dessen Gefühle berichten, nicht zu zählen sind, findet sich kein einziges Beispiel für eine Erzählung, in der ein Verlassender und damit die Verlassenden mit eigener Stimme und im eigenen Namen spricht.
Wer einen anderen verläßt, sollte man wenigstens meinen, der denkt darüber nicht weniger in subjektiver Perspektive nach, als derjenige, der sich verlassen sieht. Doch in der Literatur liegen die dinge anders, gelten andere Gesetze. Dort gilt: Wer (stärker oder länger) liebt, hat recht. Das heißt: wer verlassen wird, hat recht. Diese Regel betrifft nicht nur ein spezifisches thematisches Feld der Literatur, als Grundregel konstituiert sie die gesamte literarische Welt. Dieser Umstand wäre an sich schon bizarr genug, doch wird die Sonderbarkeit noch gesteigert dadurch, daß diese einseitige Verzerrung nicht auf das Terrain der Literatur beschränkt bleibt, sondern auf das reale Leben abfärbt. Man hat sich also nicht nur zu fragen, warum die literarische Realität eine andere ist als die reale und warum der Verlassende dort kein Sprachrecht besitzt, sondern auch, warum diese literarische Verzerrung auch in der realen Welt gilt.
Derjenige, der den anderen verläßt, hat mit nicht weniger Fragen zu tun als derjenige, der verlassen wird. Während aber das, was der zu sagen hat, der verlassen wird, tausendfach souffliert wird und immer schon inflationär ausgesprochen wurde und uns geradezu in den Ohren dröhnt, ist über das, was der denkt und fühlt, der den anderen verläßt, so gut wie nichts bekannt. Niemand hat es je zur Sprache gebracht, und niemand hat dies je bemängelt. Die möglichen Fragen und Ausbrüche und die Innenwelt des Verlassenden sind vielleicht deshalb unbekannt, weil sie nicht nur für unsäglich gehalten werden, sondern schlicht unsagbar sind.
Angesichts dieses Mangels an dokumentierten Aussagen, der verblüfft, sobald man sich dies einmal vor Augen geführt hat, weil es einem bisher noch gar nicht aufgefallen ist, macht einen der Titel eines Buches Peter von Matts „Die Treulosen in der Literatur“ hellhörig und weckt Erwartungen. Um es vorwegzunehmen, wartet man, obwohl der Titel verspricht, von den Verlassenden zu handeln, vergeblich auf deren Auftritt. Auch dieses Buch handelt ausschließlich von denen, die verlassen wurden. Wo die aufzutreten scheinen, die jene verlassen haben, handelt es sich um von anderen gezeichnete Phantombilder, wie aufgrund unzuverlässiger Beschreibungen von der Polizei angefertigt, fürs Verbrecheralbum. Und während in einem ordentlichen Verfahren der Verdächtigte oder Angeklagte selber zu Wort kommt, reden hier die anderen an ihrer Stelle, ohne daß dies irgendjemand, ob im Namen der Gerechtigkeit oder aus Interesse an der Sache, beanstanden würde.
Die Verlassenden selbst schweigen, während andere über sie oder in ihrem Namen reden, und wo jene selbst reden, da reden sie so, wie man glaubt, daß diese Phantombilder reden würden: als täten sie das Verlassen aus reinem Vergnügen, aus Sadismus, Opportunismus, Feigheit, Unfähigkeit. Um welche verächtliche Eigenschaft, um welches niederträchtige Motiv es sich im Einzelfall handeln mag, ist unerheblich. Man billigt ihnen keine mildernden Umstände zu, so wie man Mörder, die nicht unmittelbar spontan aus dem Affekt heraus handeln, sondern lange gewartet haben, bis sie zur Tat geschritten sind, die man mithin kaltblütig halten muß, besonders schwer bestraft.
Das Spekulieren über mögliche Gründe dafür, den anderen zu verlassen, erscheint müßig, denn einer ist so schlecht wie jeder andere. Sie werden sämtlich für schäbig erachtet und alle laufen automatisch auf Verurteilung und Verächtlichmachung hinaus. Das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, dem Verlassenden Bosheit zu unterstellen, ist gegenüber den unter diesem Vorzeichen denkbaren Motiven indifferent.
Niemand wollte bisher einen Verlassenden verstehen, verstehbar machen und verteidigen, sondern stets ging es darum, sein Verhalten zu verurteilen und seine allgemeine Verurteilung zu bestätigen und sich auf die Seite dessen zu stellen, der das Opfer des Verlassenden ist, weil man sich da auf der richtigen Seite weiß. Und wenn einmal jemand, etwa ein Protagonist einer Erzählung, sich zu seinem Verlassen bekannte, dann nur, um es sogleich oder später bitter zu bereuen und darin den größten Fehler seines Lebens zu sehen, so wie der Held von Ludwig Tiecks „Der Blonde Egbert“ bitter bereut, das Glück für ein Verhaltens-Ideal verraten zu haben.
Von Matt verrät den Kern des Denk-Rezepts, das der moralischen Verwaltung des Liebeslebens zugrundeliegt: Wer noch immer liebt, wer im Unterschied zum Anderen an seiner Liebe festhält, genauso wie derjenige, dessen Liebe gar nicht erst erwidert wird, dieser Liebende hat immer Recht.
So gibt es eine Unzahl von Romanen, Erzählungen, Gedichten, Songs über das Verlassenwerden und das Verlieren der Liebe des anderen. Sie handeln sämtlich von der Notlage, in die sich jemand durch das unbegreifliche Ereignis des Verlassenwordenseins gebracht sieht, von der Schwierigkeit loszulassen, den Verlust zu verschmerzen, von der Trauer und von der Empörung über den Verrat des anderen. Der andere, der weggeht, der für das Gespräch nicht mehr zur Verfügung steht, der das gemeinsame Leben für beendet erklärt, der den Bindungs-Vertrag einseitig kündigt, erscheint als jemand, der ohne Not Leid verursacht, der undankbar ist, der nicht weiß, was er im anderen hat, der das Glück der gemeinsamen Stunden vergißt, der sich nicht an Abmachungen hält, der sich als unfairer Partner entpuppt, als Zyniker, Sadist, Lump. Während zum Verlassenwerden immer zwei gehören, ist der Verlassende immer nur einer. Der Liebesverräter ist immer im Unrecht.
Sein Charakter und sein Handeln stehen immer schon unter negativem Vorzeichen: als verantwortungsloser Vertragsbrüchiger und hinterhältiger Verräter, unzuverlässiger Kandidat oder Geselle, unsicherer Kantonist, schwacher Charakter, Neurotiker, als schlechter Mensch, als Negativposten in der moralischen Buchführung. Den Verlassenen trifft dieses Schicksal stets unverdient, während der Verlassende immer vorsätzlich handelt. Die Moral ist stets auf der Seite desjenigen, der verlassen wurde. Die Verlassenden sind treulos nicht nur gegenüber dem anderen, sondern auch und erst recht gegen sich selbst. Sie tun recht daran, sich nicht rechtfertigen zu wollen.
Was der Verlassende zu sagen hätte, wenn er sprechen würde, kann nur das sein, was man ihm unterstellt. Georges Bataille hat an einem Beispiel die Methode vorgeführt, die wir bei dieser Konstruktion anwenden. Er stellte sich nach der Lektüre des Berichtes eines Deportierten einen solchen in entgegengesetzter Richtung vor, wie ihn der Henker hätte verfassen können, den der Zeuge zuschlagen sah. „Ich stürzte mich auf ihn und beschimpfte ihn, und da er, die Hände auf dem Rücken gefesselt, nicht antworten konnte, schlug ich ihm mit den Fäusten ins Gesicht, mit solcher Wucht, daß er zu Boden fiel, und meine Absätze vollendeten das Werk; angeekelt spuckte ich ihm ins geschwollene Gesicht. Ich konnte mich nicht enthalten, hellauf zu lachen...“
Während wir eigentlich wissen, daß ein Henker so nie sprechen würde, denken und konstruieren wir uns die Motive des Verlassenden zugleich auf genau diese Weise. Gleichgültig, was er selber sagen mag und ob er überhaupt etwas sagt, unterstellen wir ihm eine Rhetorik, die von der vermeintlichen Machtlosigkeit des Verlassenen diktiert wird. Wenn er schweigt, halten wir sein Schweigen für eine Übersetzung jener unterstellten Rhetorik.
Bataille kommentiert: „Es ist unwahrscheinlich, daß ein Henker je auf solche Weise schriebe. In der Regel verwendet er nicht die Sprache der Gewalttätigkeit, die er im Namen der herrschenden Macht ausübt, sondern die Sprache der Macht, die ihn anscheinend entschuldigt, die ihn rechtfertigt und ihm eine höhere Funktion verleiht. Der Gewalttätige ist geneigt zu schweigen und gewöhnt sich an den Betrug. In seiner Sicht ist der Geist des Betrugs die offene Tür zur Gewalttätigkeit. Insofern der Mensch begierig ist zu töten, stellt die Funktion des legalen Henkers eine Erleichterung dar: Der Henker spricht zu seinesgleichen, falls er es überhaupt tut, die Sprache des Staates. Wenn er aber der Leidenschaft unterliegt, gewährt ihm das heimtückische Schweigen, in dem er sich gefällt, die einzige Lust, die ihm gemäß ist.“ (Eros S. 185) Das Schweigen des Verlassenden wird so fraglos als Manifestation von Macht interpretiert. Wir denken bei seinem Schweigen an „jenes tiefe Schweigen, das der Gewalttätigkeit eigen ist, die nie sagt, daß sie existiert, die nie eine Daseinsberechtigung behauptet, die immer existiert, ohne es zu sagen“. (Eros 185)
Das Schweigen des Verlassenden erscheint als selbstbewußte, ja lustvolle Ausübung von Gewalt. Wenn er reden würde, dann wäre sein Reden wie das der Libertins in de Sades Romanen. Diese geben sich langen Gesprächen hin, in denen sie freimütig bekennen, ihre Taten im vollen Bewußtsein der verheerenden Folgen für den Verlassenen ausgeübt zu haben und mit seinen „Heldentaten“ prahlen und sich mit ihrer Abgebrühtheit brüsten und zu beweisen versuchen, daß sie mit dem, was sie tun, Recht haben, indem sie der Natur folgen. Sie behaupten den souveränen Wert der exzessiven Gewalttätigkeiten gegen andere.
De Sade unterstreicht das unterstellte Selbstbewußtsein und die Selbstgerechtigkeit der Täter, indem er sie sich durch die Erzählungen der bereits verübten Mißhandlungen zu weiteren aufstacheln läßt. In „Die hundertzwanzig Tage von Sodom oder Die Schule der Ausschweifungen“ erzählen die vier Libertins als Ich-Erzähler den vier reichen Wüstlingen von bereits erlebten Mißhandlungen: Diese geben dann den Leitfaden zur Nachahmung und Steigerung der Brutalitäten. Es werden Tagespläne erstellt, in denen die Vervielfachung der vorab geschilderten Ausschweifungen geplant werden: „Am 8. Dezember wird Curval Michette entjungfern, am 11. der Herzog Sophie [...]. Am 15. wird Curval Hébé entjungfern...“
Die Methode, die Bataille analysierte, ist vergleichbar auch mit derjenigen, die Mary Shelleys Dr. Frankenstein bei der Konstruktion seines Geschöpfs anwendet und die wir als Leser übernehmen, wobei wir uns freilich dessen bewußt werden. Obwohl gerade „geboren“ und die Wärme der vermeintlichen Mitmenschen suchend und ihren Schutz erwartend, muten wir ihm zu, ihn, wegen des Schreckens, den er uns einjagt und der unerträglichen Bedrohung, die von ihm für uns und die gesamte Menschheit angeblich ausgeht, glauben töten oder zumindest verjagen zu müssen. Mit unserer sprachlichen Konstruktion schaffen wir auf vergleichbare Weise den Verlassenden als Monster. Unser perspektivierend unterstellendes Sprachspiel liefert uns die Schrauben, mit denen wir ihn aus den Elementen unserer Phantasie zusammenbauen.
Der Verlassende spricht, weil er schweigt. Und er tut gut daran zu schweigen, denn wenn er spräche, spräche er als menschenverachtender Wüstling, als Ungeheuer. Während der Verlassene wie von selbst zur Sprache findet und bei ihr mühelos Zuflucht findet, nicht aufhören kann zu reden, die Sprache ihm entgegeneilt, ihn in ihr baden läßt, sich in ihr wie der Fisch im Wasser fühlen läßt, bleibt der Verlassende stumm und wird er von der Sprache der anderen erstickt. Während das Verlassenwerden eine fieberhafte Produktion von Wörtern in Gang setzt, die immer schon bereit liegen und augenblicklich stramm stehen, ist das Verlassen vom Versiegen der Sprache begleitet. Für Äußerungen gemäß seinem eigenen subjektivem Empfinden steht die Sprache nicht zur Verfügung. Vor dem Verlassenden zieht sie sich zurück wie Wasser bei Ebbe vom Strand. Das Verlassenwerden löst sich in Sprache auf, verflüssigt sich in Verbalität, ist pure Sprache; das Verlassen ist reines Handeln, purer Akt, das Verstocken und Austrocknen der Sprache.
Dem Verlassenden wird Unaufrichtigkeit vorgeworfen, aber Aufrichtigkeit würde an seiner Verurteilung nichts ändern. Man erwartet vom Verlassenden nicht, daß er in der Lage sei oder das Bedürfnis haben könne, die Dinge richtig zu stellen. Man würde nicht hinhören, nicht hinhören können. Man weiß ohnehin, was er sagen würde. Was er tut, ist reine Machtausübung, Souveränität. Während man sonst jeden, der Souveränität an den Tag legt, um diese beneidet, ist sie im Falle des Verlassenden Schmutz, Gegenstand größtmöglicher Verachtung.
Dem Verlassenden wird grundsätzlich unterstellt, auch anders entschieden haben zu können. Er hat einen freien Willen, während derjenige, der verlassen wird, überwältigt ist und seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat und weder seine Situation noch seine Gedanken mit dem Willen stoppen kann. Die generelle Zumutung des freien Willens, die nur bei nachgewiesener Unzurechenbarkeit gelockert wird, ist bei dem, der verlassenen wurde, umstandlos außer Kraft gesetzt, ohne daß er dafür kraft eines psychiatrischen Gutachtens für krank erklärt werden müßte, wie das sonst generell der Fall wäre. Während der Verlassene das Verhalten eines geistig Umnachteten zeigt, das ihm nicht angekreidet wird, ist der Verlassende stets bei klarem Verstand, er handelt grundsätzlich eiskalt kalkulierend. Der Verlassende ist von der Art, wie der Held von Camus’ „Der Fremde“, der am Grab seiner Mutter nicht weint und deshalb auch ein Mörder sein muß, und zwar die niederträchtigste Art von Mörder, die sich denken läßt.
Er ist immer gezwungen, sich mit seiner Rationalität selbst den Strick zu drehen. Die Vernunft des Verlassenen ist moralisch einwandfrei. Die Vernunft des Verlassenden gilt als Ausdruck eines durch und durch schlechten und asozialen Charakters. Es handelt sich dabei um einunddieselbe Vernunft. Die Vernunft selbst wird gespalten, wie in den Geschichten Heinrich von Kleists.
Wie bizarr ein dann vollzogener Schritt Außenstehenden anmuten muß, zeigt Nathaniel Hawthorne in seiner Erzählung „Wakefield“. Dort wird das Fortgehen, das Verlassen, mit dem Motiv verbunden, mit der souveränen, aber sprachlos bleibenden Tat seinen Platz in der Gemeinschaft, ja im Kosmos zu verlieren: „In der scheinbaren Verworrenheit unserer rätselhaften Welt sind die Individuen so genau einem System und die Systeme wiederum ineinander und einem Ganzen eingepaßt, daß der Mensch, der einen Moment beiseite tritt, sich der entsetzlichen Gefahr aussetzt, seinen Platz auf immer zu verlieren.”
Nach einer Weile kehrt Wakefield zurück. Es gibt für das Weggbleiben genauso wenig Grund wie für das Bleiben. Und da seine Frau genauso sprachlos bleibt und auf die gewohnte Sprachexplosion der Verlassenen verzichtet, sieht es so aus, als wäre nichts gewesen. Aber natürlich kann nichts wieder so sein wie vorher. Wir lesen diese Wendung mit Grauen.
Der Autor spekuliert wortreich daüber, was die Personen im Einzelnen gedacht haben könnten. Wakefields Frau hätte ihren Mann wahrscheinlich gern gefragt, wie lange die Fahrt dauern, wohin sie ihn führen und wann ungefähr er wieder zurückkommen werde. Aber aus Rücksicht auf seine harmlose Neigung zum Heimlichtun wirft sie ihm nur einen fragenden Blick zu. Darauf hat er ihr möglicherweise gesagt, sie möge ihn nicht unbedingt mit der Retourkutsche erwarten, noch sich aufregen, sollte er drei oder vier Tage ausbleiben, jedenfalls aber für Freitag zum Abendessen mit ihm rechnen. “Wakefield selber, das dürfen wir nicht vergessen, weiß durchaus nicht, was ihm bevorsteht. Er streckt die Hand aus, sie gibt ihm die ihre und erwidert seinen Abschiedskuß mit der Selbstverständlichkeit einer zehnjährigen Ehe; und fort geht Mr. Wakefield, ein Mann mittleren Alters, fast schon entschlossen, seine brave Frau durch eine volle Woche Abwesenheit zu verblüffen...”
Man könnte die ausufernde Literatur über diejenigen, die verlassen wurden, zu den „selbsteinräumenden Bergungsformen“ zählen, die Sloterdijk in der Schiffsmetapher wie im Kirchenbau ausmachte, und sie analog zu jenen als künstlichen Innenraum auffassen, der einem intransigenten Außen entgegengesetzt wird, wobei daß man sich auf selbstgebastelte, mitgebrachte „selbsteinräumende Bergungsformen“ verläßt, um den Vorrang des Inneren gegen ein Außen und dessen freches Anrecht auf Sprachwerdung zu behaupten. Das Verlassenwerden konstituiert auf ähnliche Weise einen Innenraum, von dem aus sich die Furcht vor einem reinen gleichgültigen Außen in die Latenz zurückstauchen läßt. Mit dem Segelschiff oder dem Kirchenschiff suggerieren die Menschen sich selbst, daß es ihnen gelänge, ihre Beziehungen zueinander in einem künstlich geschaffenen Innenraum so ernst zu nehmen, als existierten keine äußeren Tatsachen. (S. 184) „Die Lebenskünste der Moderne zielen darauf, Nicht-Gleichgültiges im Gleichgültigen zu errichten“ (184) Das Nicht-Gleichgültige verkörpert sich im Verlassenen und seiner Empörung über die Treulosen und den Liebesverrat, im Gegensatz zum Verlassenden als Inkarnation der kosmischen Gleichgültigkeit.
Die imaginären Schiffe werden nicht bemannt mit rücksichtslosen Konquistadoren, Entdeckern und Kolonisten, die vor keiner Grausamkeit gegenüber den Eingeborenen zurückschrecken, sondern vielmehr mit denen, die der unbegründbaren Furcht vor der jederzeit um sich greifen könnenden Rechtlosigkeit eine Moral entgegenzuhalten. Da sie sehr wohl spüren, daß auch sie sowohl zu Agenten der Rechtlosigkeit und Bedenkenlosigkeit werden können als auch zu deren Opfern, brauchen sie einen Raum, in dem sie mit sicherem Abstand zum Geschehen auf der moralisch sicheren Seite sind.
Dieser Innenraum stemmt sich gegen das Nichts, wie die Farbe gegen das Weiß. Das Weiß markiert „den unmarkierten Raum, in dem sich Reisende um jedes Intimitätsgefühl, jede Empfindung von Ankunft und Heimat betrogen fühlen werden. Es ist nicht umsonst die Farbe, die von den Kartographen für die terra incognita reserviert war.“ Herman Melville nannte das Weiß „die Allfarbe der Gottlosigkeit, vor der wir zurückschrecken“, weil sie uns wie die weiße Tiefe der Milchstraße an die „herzlose Leere und Unermeßlichkeit des Universums“ erinnert; sie durchdrinkt den Betrachter mit den Gedanken an seine Vernichtung im gleichmütigen Außen. Ahabs Wal muß diese Farbe tragen, da er seine Exterritorialität symbolisiert, die ansonsten keiner Erscheinung bedürftig und fähig ist. Wenn aber das Außen je als solches sich anblicken läßt: „Dann liegt die Welt gelähmt wie von Aussatz befallen vor uns, und wie ein halsstarriger Reisender in Lappland, der sich weigert, eine farbige Brille aufzusetzen, schaut sich der bedauernswerte Ungläubige blind an dem unendlichen weißen Leichentuch, in das sich die Welt um ihn herum hüllt.“ (Sloterdijk)
Nun wäre es doch vorstellbar, daß dem Verlassenden etwas zugestoßen ist, das ihn selbst ratlos macht und mit namenloser Angst erfüllt. Sein Schweigen ist möglicherweise nicht vorsätzliche Auskunftverweigerung. Sein Handeln steht möglicherweise überhaupt nicht mit einem Vorsatz in Verbindung, obwohl er derjenige ist, der die Beziehung beendete. Sein Denken kreist vielleicht rastlos um das Rätsel, das er sich selber ist, und zu dem ihm der Zugang versagt bleiben muß. Er hält es für unmoralisch, sich gegen die Unterstellungen zu wehren und dagegen, daß man an seiner Stelle spricht, weil er selbst nicht dahinter kommt, was in ihm vorgeht, und solange die Deutungen der anderen gelten lassen muß. Die Frage, die gestellt werden müßte aber nie gestellt wird, ist, was er nicht versteht, worin er sich selber fremd geworden ist.
Mit J. P. Sartre könnte man mutmaßen, daß er sich fremd geworden ist, weil er sich ohnmächtig fühlt und in seiner Ohnmacht zum Handeln gezwungen sieht. Er ist sich als Ohnmächtiger fremd. Er flieht vor sich selbst, weil er sich nicht in der Ohnmacht zunichte machen kann. Er weiß nicht, was er tun kann und wird doch zum Handeln gedrängt. Der Schritt, den er tut, wenn er den anderen verläßt, resultiert aus der Zusammenballung von Selbstentfremdung und Handlungsdruck. Je länger ihn das Rätsel quält und lähmt, desto unmöglicher wird es, das erste Wort zu sagen.
Sonntag, 2. Januar 2011