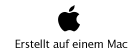Rameaus Neffe
Der Erzähler in Denis Diderots Dialog „Le Neveu de Rameau“ stellt sich uns vor mit dem Verweis auf seine Gewohnheit, „bei gutem wie schlechtem Wetter gegen fünf Uhr nachmittags im Palais Royal spazierenzugehen“. heute ein stiller Platz hinter der Comedie Francaise, gaben sich dort vor der Revolution die von politischem und ökonomischem Ehrgeiz getriebenen Künstler und Schriftsteller mit den schönsten Frauen von Paris ihr Stelldichein beim Promenieren unter freiem Himmel und an den Tischen der neuen Cafes und Restaurants. Der Erzähler empfiehlt sich als einer der Intellektuellen, die man „philosophes“ nannte. Als solcher ist er fasziniert von dem Milieu, während er zugleich die Distanz seiner Gedanken und Bewegungen zur Welt des Palais Royal betont: „Ich sitze allein auf einer Bank, lasse meinen Gedanken freien Lauf, und wenn es kalt oder regnerisch ist, dann gehe ich ins Cafe de la Regence, um den Schachspielern zuzuschauen.“ Eben in diesem Cafe trifft er Jean-Francois Rameau, den Neffen des berühmten Komponisten Jean-Philippe Rameau, ein den Parisern vertrautes „Original“, wie man damals Stadtstreicher der gehobenen Kategorie nannte, mit einem „Temperament, so wechselhaft wie das Wetter“. Man nannte Rameau einen „verwachsenen Riesen“, einen „Adler des Geistes mit der praktischen Veranlagung einer Schildkröte“, und stadtbekannt war sein „hervorstehender Kiefer, der wie das Emblem einer auf alles Genießbare konzentrierten Weltanschauung“ aussah.
Sich selbst beschreibt Rameau scheinbar noch viel gnadenloser als seine Zeitgenossen, aber doch auch mit dem spürbaren Gefallen an der unüberbietbaren Provokation, als „Abschaum“ und „verwöhntes Mittelmaß“, er nennt sich „Speichellecker“, „Lügner“, „Dieb“, vor allem aber immer wieder „prinzipienlos“ und „bettelarm“. Er würde alles tun, um „guten Wein zu trinken, opulente Gerichte zu verschlingen, sich an hübschen Frauen zu räkeln und in weichen Betten zu schlafen“. Mit dieser Lebensphilosophie erhebe er sich, so der Erzähler, zu einem „wesentlichen Geist“ seiner Zeit.
Mehr noch als seine Überzeugungen aber drängt das gewaltsame Tempo seiner Rede den Philosophen-Erzähler an den Rand des Gesprächs. Rameau verschafft sich Aufmerksamkeit mit ohrenbetäubender Stentorstimme, er schleudert seinem Gegenüber Salven aus Verben und Substantiven entgegen, die am Ende stets ironisch klingen. Er spielt mit Hunderten von Namen, die Klatschgeschichten und Skandale in Erinnerung rufen, welche vor allem für die Aufklärungspartei schmerzhaft sein dürften vor allem aber unterläuft der Neffe listig die Fragen und Argumente des Philosophen, indem er sie wörtlich nimmt: „Was ich so tue? Dasselbe wie alle anderen. Gutes, Schlechtes und nichts. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich, sofern sich Gelegenheit bietet; wenn ich Durst habe, trinke ich manchmal; und weil dabei mein Bart wächst, lasse ich mich dann und wann auch rasieren.“
Gewiß hatte Hegel recht, als er in der „Phänomenologie des Geistes“ meinte, daß der Autor Diderot in zwei Rollen anwesend sein wolle, im „zerrissenen Bewußtsein“ des Neffen und im „ruhigen, ehrlichen Bewußtsein“ des Philosophen. Aber mit dieser Beobachtung beraubt Hegel den Dialog zugleich seiner explosiven Potenz. Der Diderot dieses Textes kann, anders als sein Autor Diderot, seinem Gesprächspartner einfach nicht Paroli bieten. Die zunächst angestrengt durchgehaltene Selbstironie des Philosophen - „mein Geist ist wohl beschränkt“ - löst sich in eine ernüchternde Situationsbeschreibung auf: „Ich war verwirrt von Rameaus Geistesschärfe und seiner Verderbtheit, von einer solchen Perversion der Gefühle und so außergewöhnlicher Ehrlichkeit.“
Zugleich dämmert dem Philosophen, daß er weniger an den Überzeugungen seines Gesprächspartners Anstoß nimmt als an dessen „Ton“, ohne freilich Rameaus Zynismus, der ihm so zu schaffen macht, und dessen Stimme, die ihm entgegenschallt, auseinanderhalten zu können. Als dieser voller Bewunderung die Geschichte eines „Renegaten“ und „Verräters“ erzählt, der das freundschaftliche Vertrauen eines Juden gewann, um ihn bald mit erfundenen Berichten über die Inquisition in Unruhe zu versetzen und ihn am Ende um sein Vermögen zu bringen, verliert der Philosoph schließlich die Fassung: „Ich weiß wirklich nicht, was mich mehr erschreckt, die Abgefeimtheit des Renegaten oder der Ton, in dem er von ihr berichtet.“
War das wechselhafte Wetter am Beginn des Berichts ein vorweggenommenes Emblem von Rameaus Temperament gewesen, so wird der Klang seiner Stimme nun zu einem Medium, in dem sich dieses Temperament artikuliert und zur Mißstimmung verdichtet. Ständig summt oder singt Rameau Musikstücke, die sich den Themen des Gesprächs anzuschmiegen scheinen. Doch das Summen und Singen ist nur ein Übergang zu dem bizarren Verhalten, das der Erzähler als „Rameaus Pantomime“ erlebt. Rameau kopiert Bedeutungen in körperlichen Gesten, statt sie durch Wörter zu repräsentieren: „Rameau griff das, wovon ich sprach, als Pantomime auf. Er hatte sich auf den Boden geworfen und sein Gesicht gegen die Erde gepreßt, er weinte, er schluchzte. Dann stand er plötzlich auf und sprach in ernstem und wohlüberlegtem Ton weiter.“
Am Ende spielt der Neffe ein ganzes Orchester mit all seinen Instrumenten, einschließlich der Bewegungen des Dirigenten - bis zur völligen Erschöpfung. Längst hat er die Aufmerksamkeit der Zuschauer in Bann geschlagen, und auch der Philosoph kann ihm nicht eine gewisse, wenn auch ironisch gebrochene Bewunderung versagen: „Ich wäre nicht einmal würdig, Ihr Schüler zu sein.“ „Er“ ist den Gefühlen von „Ich“ um mehr als nur ein paar Schritte voraus.
Das Voraussein des Körpers macht freilich auch dem Neffen selbst zu schaffen. So verfällt Rameau für einen Moment in Gesten verzweifelter Depression. Er sieht sich zur Rechtfertigung genötigt. Zur Pantomime und zu solchen Konvulsionen des Körpers, klagt er, seien Marginalisierte verdammt, denen, anders als den Mächtigen, die Erfüllung allen Begehrens verwehrt sei.
Das Gespräch zwischen den beiden Protagonisten endet so überraschend und abrupt, wie es begonnen hatte. Plötzlich merkt Rameau, daß es spät geworden ist. Er hat kaum Zeit, sich zu verabschieden, und läßt den Philosophen allein, ja betreten zurück, um in die Oper zu gehen, wo er, wie er eilig bemerkt, die Musik des heute vergessenen Antoine Dauvergne hören wird.
Was Goethe an diesem Text so begeisterte, daß er das damals noch unveröffentlichte Manuskript ohne Titel 1805 als „Rameaus Neffe“ ins Deutsche übersetzte, können wir einer Anmerkung entnehmen. Diderot, so schreibt er, habe „die heterogensten Elemente der Wirklichkeit in ein ideales Ganzes zu vereinigen“ gewußt, und ohnehin sei klar, „daß Niemand ihm an Lebhaftigkeit, Kraft, Geist, Mannigfaltigkeit und Anmut“ gleichkomme. Jenes ideale Ganze sei eben nicht auf die analytische Seite der Aufklärung beschränkt, sondern schließe die Emotion und die Affekte ein. Der statische Raum der Vernunft fülle sich in Diderots Text mit frenetischem Leben. Indem Diderot den Neffen Emotionen und Körperlichkeit so prall verkörpern und so vollkommen ausleben läßt, bringe er den allzu häufig geleugneten anderen Raum, jene anderen Gesten, jene andere Stimmung der Aufklärung zu Bewußtsein.
Das latente Gegenklima der Aufklärung schließt an die Figur des Narren an, wiewohl dieser offiziell abgeschafft und verfemt worden war. Der Figur des Narren wohnt die Potenz inne, die Relation zwischen den Gewievten und den Betrogenen, den Konformen und den Diskriminierten umzukehren. Rameaus Neffe von Diderot kitzelt mit Anspielungen auf Sokrates diesen dialektischen Charakter des Narren hervor. Dieser hat nicht nur äußerliche Ähnlichkeit mit Sokrates, er spricht auch wie dieser.
Das Verhältnis von Philosoph und “Original” kehrt sich um. Dem Philosophen entgleitet die Gesprächsführung. Der Neffe als Antiphilosoph und amoralisches Subjekt übernimmt immer mehr die sokratische Gesprächsrolle, die Rolle dessen, der die Überlegenheit des Fragenden auszuspielen versucht. Der überhebliche Philosoph wird von seinem unwürdigen Kontrahenten immer mehr in die Aporie getrieben. Der Neffe übernimmt die Rolle dessen, der das Gespräch strukturiert.
In Zeiten, die in Konventionen erstarrt ist, könnte gerade dies nötig sein. “Kommt ein solcher in eine Gesellschaft, so ist er ein Krümchen Sauerteig, das das Ganze hebt und jedem einen Teil seiner natürlichen Individualität zurückgibt. Er schüttelt, er bewegt, bringt Lob oder Tadel zur Sprache, treibt die Wahrheit hervor, macht rechtliche Leute kenntlich, entlarvt die Schelme, und da horcht ein Vernünftiger zu und sondert die Leute.” Das Bild vom Sauerteig hat dieselbe Funktion wie die älteren vom Zitterrochen (Menon) und vom Geburtshelfer, die ebenfalls in den Pantomimen angesprochen werden, wodurch die mäeutisch-sokratische Gesprächsführung deutlich benannt ist. Angemaßter Philosoph und Narr tauschen unmerklich die Rollen in einem karnevalesken Bachtin’schen Dialog.
(Hans Robert Jauß, Der dialogische und der dialektische Neveu de Rameau oder: Wie Diderot Sokrates und Hegel Diderot rezipierte. In Poetik und Hermeneutik XI. Das Gespräch. Wilhelm Fink, München 1996.
Sonntag, 2. Januar 2011