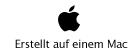Vernunft
Man meint, es gebe nur eine Vernunft. Auf ihrer Basis könne man nicht verschiedener Meinung sein. Kleist belehrt uns eines Besseren. Heinrich von Kleists Geschichten kreisen um das Grauen der Erkenntnis, unversehens jeden Einfluß auf das Geschehen verlieren, jeder Zeit ohne eigenes Verschulden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden zu können. Er erzählt von der traumatischen Erfahrung, urplötzlich zur Welt und zum Gegenüber keinen Zugang mehr zu haben, sie mit Worten nicht mehr erreichen zu können, erleben zu müssen, daß für einen in der Welt plötzlich kein Platz mehr ist. Hier stehen sich nicht Vernunft und Unvernunft gegenüber, sondern zwei Vernünfte, die miteinander nicht kompatibel sind. Gewinnen tut die, welche die Macht hat, weil sie einfacher zu denken ist, während die voraussetzungsvollere Version keine Chance hat. Die Logik vieler seiner Geschichten tritt die Nachfolge des antiken Fatums und der antiken Tragik an, während alle Welt davon überzeugt ist, daß es in der bürgerlichen demokratischen Gesellschaft seit der französischen Revolution dergleichen nicht mehr geben könne.
Von Michael Koolhaas gilt allgemein, daß er als militanter Querulant ein entfernter Verwandter des Amokläufers sei. Koolhaas wolle das Recht zu seinen Gründen herabziehen, aus diesem Grund sei er manischer Jäger der Gesetzeskunde geworden, der an jeder Gesetzesfassung die Eigenverletzung nachbuchstabiert. Auf diese Weise wird er in Deutschstunden und Philosophie-Sendungen diffamiert. Kleist aber hatte nicht im Sinn, bizarres Verhalten bloßzustellen, als Abweichung, die man an Vernunft als verläßlichem Maßstab messen könne. Vielmehr legte er den Finger auf die Unverläßlichkeit des Maßstabs selber.
Die junge Marquise von O. ist von ihrer Familie verstoßen worden, weil sie schwanger wurde und nicht bereit war, ihren Fehltritt einzugestehen. Sie hat bis zuletzt geleugnet, überhaupt schwanger zu sein. Als dies medizinisch nachweislich der Fall und nicht mehr zu leugnen war, hat sie bestritten, den Erzeuger zu kennen. Alle Welt ist davon überzeugt, daß sie lügt und nicht die Courage hat, zu dem zu stehen, was sie getan hat, und immer nur gerade so viel zugibt, wie sich nicht mehr vermeiden läßt. Man macht ihr wiederholt Angebote, ihr zu verzeihen, wenn sie nur gestände. Da sie auf ihrer Unschuld besteht und verstockt bleibt, beschuldigt man sie nicht nur der Lüge und der Respektlosigkeit den Eltern gegenüber, sondern auch der Blasphemie, weil das Vorrecht der unbefleckten Empfängnis Maria vorbehalten sei.
Obwohl die Marquise bis dahin niemals und niemandem Anlaß zu der Annahme gegeben hatte, ein mißratener Charakter zu sein, kam doch niemand auf die Idee, sich zu fragen, ob es nicht für die Vorgänge doch eine Erklärung geben müsse, die ihre Ehrlichkeit und charakterliche Qualität und die Wahrhaftigkeit ihrer Aussagen nicht in Frage stellt.
Nach ihrer Niederkunft, die dem Offizier, der während des Krieges in dem Haus dieser Familie einquartiert war, zu Ohren kommt, erfährt die Geschichte eine Wendung. Dieser Offizier gesteht, sich während seiner Einquartierung in die Marquise verliebt zu haben und, während sie nach einem Bombeneinschlag ohnmächtig dalag, sich ihrer sexuell bemächtigt zu haben. Die Marquise war also schwanger geworden, ohne davon gewußt zu haben. Das Offensichtliche, nämlich die Schwangerschaft, und das von der Marquise standhaft behauptete Unschuld, werden plötzlich erkennbar als zwei Dinge, die einander nicht ausschließen.
Doch diese Aufklärung kommt zu spät. Indem die Marquise fassungslos erkennen muß, daß ihr niemand glaubt, sieht sie sich im Gegensatz zur ganzen Welt. Sie allein auf der einen Seite, ohne die Fähigkeit, sich verständlich zu machen, und die ganze restliche Welt auf der anderen Seite, felsenfest überzeugt von ihrer Schuld und nur allzu gern bereit, sie zu verurteilen. Sie macht in ihrer Ohnmacht die ganze Welt zu einem Raum, in den hinein sie ihre Unfähigkeit entläd, für möglich zu halten, daß man ihr mißtraut und nicht glaubt.
Ihre Eltern und die sonst noch involvierten Mitmenschen sind nicht in der Lage, sich die Blickrichtung der Marquise anzueignen. Während sie an der vermeintlichen Verstocktheit der Marquise verzweifeln, sind sie es selber, die in ihrer eigenen Verstocktheit gefangen sind. Es ist der Common-sense, der sie daran hindert, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Der Teil des Denkbaren, der eine die Marquise nicht ins Unrecht setzende Erklärung bereit hält, ist ihnen nicht zugänglich. Für jederman ist die Sache sonnenklar.
Kleists Figur der Marquise leugnet nicht aus Scham, sondern sie zeichnet sich dadurch aus, daß sie außerstande ist zu lügen. Sie kann nicht nicht wahrhaftig sein. Auf Wahrheit und Genauigkeit zu bestehen, das ist, sofern man dies als Defekt ansehen will, ihre einzige schlechte Eigenschaft, die man mangelnde Flexibilität oder Biegsamkeit nennen könnte, die sie mit Kleist selber teilt. Subjektiv huldigt sie mit ihrer Ehrlichkeit den Eltrn und ihren Prinzipien,. Objektiv gereicht ihr ihre Unfähigkeit zu lügen zur Verurteilung als durch und durch schlechter, verdorbener Charakter, den man nicht mehr zögert, für das Böse schlechthin zu halten, ja warum nicht gleich als die Verkörperung des Bösen selbst. Die Marquise wird zum Fliegenfänger aller schlechten Eigenschaften, die ein mensch nur haben kann. Die Menschen lassen sich von ihrer Ehrlichkeit in einen Paroxysmus der Diskriminierung und Verteufelung hineintreiben. Ihre Unbeweglichkeit provoziert einen Amoklauf. Man bildet sich etwas ein auf den gesunden Menschenverstand. Wir können zwei und zwei zusammenzählen. Für wie blöd hälst du uns! Nicht mit uns!
Mit der fortgesetzten absolut widersinnigen Weigerung anzuerkennen, daß die Schwangerschaft eine Ursache haben muß, riskiert sie, die Logik selbst zu verhöhnen und über die Schande hinaus, die sie der Familie zufügt, den Ausschluß aus der Gemeinschaft der Menschen überhaupt, ja aus dem Sein. Ihr Schicksal hat Ähnlichkeit mit dem der Antigone. Die Verbannung der Marquise, so komfortabel sie uns auch vorkommen mag, kommt der Strafe, bei lebendigem Leib eingemauert zu werden, erschreckend nahe.
Als Leser der Erzählung kommen wir einerseits, solange das Rätsel der Marquise nicht aufgelöst ist, nicht umhin, ihre Fassungslosigkeit angesichts des Umstands zu teilen, daß man ihr das vertrauen entzieht und ihr nicht glaubt, wo es doch in ihrem bisherigen Leben, wie es im Text heißt, nie Anlaß zu Klagen über sie gegeben hatte, und können zugleich nicht umhin, die Fassungslosigkeit und Empörung der Angehörigen zu verstehen. Wir sind als Leser gespalten in zwei unversöhnlich nebeneinander stehende Teile.
Als durch das Geständnis des Offiziers offenbar wird, was sich tatsächlich zugetragen hat, und obwohl die Anschuldigungen gegen die Marquise sich als unberechtigt herausstellen, und diese Aufklärung die Familie in Verlegenheit bringt und dazu veranlaßt, sich für die voreilige Verurteilung zu entschuldigen, ist dieses Einlenken darum keine Auflösung. Der durch das Mißtrauen durch die Welt gegangene Riß bleibt vorhanden, denn es handelt sich nicht um einen Irrtum, der sich aufklären läßt, sondern um eine Krise der Wahrheit. Die Seite der Gemeinschaft und des Common-sense und die Seite des Individuums und der Wahrhaftigkeit lassen sich im Konfliktfall nicht versöhnen. Es scheint keine Sprache und keine Rituale zu geben, die eine Brücke bilden und beide Seiten der Vernunft als Teile derselben Welt erkennbar machen.
Diejenigen, die die Marquise verurteilt haben, erweisen sich selber als schuldig, obwohl sie sich nach dem Buchstaben des Gesetzes keines Vergehens schuldig gemacht haben. Und die Marquise ist schuldig, obwohl wir nicht sagen können, woran.
Ein Satz ragt aus dem Textgefüge heraus. Er steht quer zu ihm wie eine Gräte, die sich im Hals quergestellt hat. Von der Marquise heißt es da, sie habe sich auf Münchhausenweise selbst kennen gelernt. “Durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht, hob sie sich plötzlich, wie an ihrer eigenen Hand, aus der ganzen Tiefe, in welche das Schicksal sie herabgestürzt hatte, empor.” Dies geschieht mit der Marquise, nachdem der Vater von ihr die Übergabe der Kinder verlangt hatte. Sie war stattdessen mit ihren Kindern geflohen und hatte sich damit dem Vater widersetzt. Der Satz zählt zu einer Gruppe von Wendungen, die für Kleist typisch sind. Andere Beispiele finden sich etwa in der „Penthesilea“: Was geschieht? Warum? Was will ich denn? Wenn ich ... will ich..? oder im „Prinzen von Homburg“.
Die Psychologie verlangt das Eingeständnis einer Schuld auch da, wo keine ist. Die Marquise sollte, um dem Ritual Genüge zu tun, sich für das, was sie nicht wußte, also für ihr Unbewußtes verantwortlich fühlen. Indem sie diese Geste der Unterwerfung unter die Gemeinschaft aber schuldig blieb, und zwar nicht mit der Absicht, sich zu widersetzen und die Autorität zu provozieren, sondern weil sie in ihrer Machtlosigkeit zur Orientierung nur die Wahrhaftigkeit besaß und in ihr – wie Antigone - den Maßstab für die Moral wähnte und die Bedingung für das Aufgenommensein in die Gemeinschaft, wird sie zu jemand, der, auch nachdem die Ankläger ihren Irrtum eingestanden haben, und den Ausschluß zu revidieren bereit sind, sich dieser Gemeinschaft entfremdet sieht. Sie erkennt, daß das, was sie an diese Gemeinschaft band, nur die Angst war, von ihr verstoßen zu werden. Sie hat nun den begründeten Verdacht, daß die Gemeinschaft wie die von Hobbes konstruierte nur aus solchen Mitgliedern besteht, die ihr nur aus der Angst davor angehören, von ihr ausgestoßen zu werden, und andere ausstoßen müssen, um diese Angst zu verdrängen. Als eine jedoch, die mit sich selbst Bekanntschaft gemacht hat und sich selbst aus der Tiefe emporhob, hat sie mit dieser Art von Gemeinschaft nichts mehr zu schaffen. Das Individuum ist erst dann eigentlich gesellschaftsfähig, wenn es der Gesellschaft nicht mehr bedarf, wenn es gegen sie zu handeln in der Lage ist. Es ist moralisch, wenn es unmoralisch geworden ist.
Der emblematische Satz will sich nicht bruchlos in den Kontext einfügen. Mit ihm wendet sich derjenige, von dem in ihm etwas festgestellt wird, nicht an andere Personen innerhalb der Welt der Erzählung oder des Drama, um sie über den Vorfall zu unterrichten oder um den Kontakt zu ihnen zu halten, sondern mit ihm wendet sich der Autor direkt an den Leser, so daß uns der Satz direkt anspricht. Er spricht als metaphysische Botschaft aus einem Jenseits zu uns. Man könnte Sätze dieses Typus ikonische Sätze nennen, in Analogie zu der Unterscheidung, die Peter Weiss getroffen hat, als er auf einen wesentlichen und epochalen Unterschied zwischen der Malerei Cimabues und der Giottos hinwies. Während Cimabues Figuren vor goldenem Grund stehen, der das himmlische Jenseits symbolisiert, und den Betrachter wie aus Ikonen heraus direkt anblicken, sind die Figuren Giottos in Kommunikation mit den übrigen Figuren engagiert und blicken einander an, während sich über ihnen ein blauer Himmel wölbt. Sätze vom gemeinten Typus stellen sich gleichsam in einem Bild von Giotto nach Art der Figuren Cimabues vorn an die Rampe. In ihnen wird weniger etwas gesagt, als daß sich in ihnen etwas unmittelbar offenbart. Die Art, wie sie vor dem Kontext der Erzählung stehen, schafft ihnen einen Hintergrund wie die Heiligen ihn besitzen vor dem Goldhintergrund der Transzendenz. Nur so kann die Botschaft den Banden des Konsens und des Common-sende entkommen und den Weg zu unseren Herzen finden.
Sonntag, 2. Januar 2011