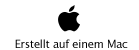Vertrauen
In der Finanzkrise war von offizieller Seite auffällig viel von Vertrauen die Rede. Um Vertrauen handelt es sich bei dem, was der Bankkunde seinem Berater entgegenbringt. Vertrauen ist hier notwendig, aus Gründen des unterschiedlichen Wissensstandes, das den Laien vom Profi trennt, und aus Gründen der Höflichkeit. Der Kunde kann und muß nicht wissen, was der Berater weiß, denn sonst bräuchte er keine Beratung und das Honorar für diese wäre nicht gerechtfertigt, und darum müßte eine mangelhafte Beratung auch justiziabel sein. Nach Auskunft der Juristen allerdings läßt sich der Schaden, der einem durch mangelhafte oder irreführende Beratung entstanden ist, nur dann einklagen, wenn man zu zweit zur Bank gegangen ist und ein Tonband hat mitlaufen lassen, dessen Transkription der Berater richtig befunden und unterschrieben hat. Wenn ich aber weiß oder befürchte, daß dies nötig sein könnte, hege ich Mißtrauen und kann mich dem Berater nicht anvertrauen. Ich hätte dann auch das Gefühl, gegen das Gesetz der Höflichkeit, ja gegen die guten Sitten zu verstoßen. Um eine Sittenwidrigkeit vor Gericht geltend machen zu können, hätte ich vorher selber gegen die guten Sitten verstoßen haben und dem Berater offen unterstellt haben müssen, unfähig oder kriminell zu sein. Die rechtliche Bedingung widerspricht also dem Vertrauen, zu dem ich mich aus Höflichkeit, gemäß den Umgangsformen und den Regeln des Anstandes verpflichtet fühle.
Nun ist in den letzten 20 Jahren in fast allen Beratungsfällen, wie nun ans Licht gekommen ist, nicht ordentlich beraten und nicht im vollen Umfang über die Risiken informiert worden. Im Gegenteil hat man Schuldverschreibungen als Wertpapiere verkauft, ohne darüber aufzuklären und oft sogar, ohne überprüft zu haben, was der Gegenwert der unkenntlich gemachten Papiere denn sein mag. Fast ohne Ausnahme ist das Vertrauen, auf das der Bankkunde angewiesen ist, mißbraucht worden. Es ist offenbar geworden, daß Vertrauen nirgendwo weniger am Platz ist als in einer Bankberatung. Die Berater wissen im besten Fall genauso wenig wie die Kunden über den Inhalt der Produkte, die sie verkaufen, und kennen die Risiken, über die sie aufklären müssen, genauso wenig wie der Kunde. Obwohl sie dazu verpflichtet wären, zu wissen, was sie verkaufen, da man als Kunde selbstverständlich davon ausgeht, zumal sie für jeden Verkauf hohe Erfolgsprämien erhalten und von der Direktion angehalten sind, ein Mindestmaß an verkauften Papieren vorzuweisen. Andernfalls würde ihnen gekündigt. Man hat also von den Bankberatern verlangt, den Kunden etwas aufzuschwatzen, von dessen Wertlosigkeit sie nichts wußten. Etwa so, wie wenn ein Autoverkäufer Kunden Autos verkaufen muß, von denen er nicht zu wissen braucht, ob sie einen Motor haben.
Wenn Politiker nun, da der Betrug offenbar geworden ist, von Vertrauen reden, wie das gegenwärtig inflationär geschieht, ist etwas anderes gemeint. Sie fordern die Bevölkerung dazu auf, Vertrauen in die Banken und das Finanzsystem zu haben, nachdem offenbar wurde, daß es für ein solches Vertrauen keinen Anlaß gibt, und sie wenden sich damit an Menschen, deren Vertrauen schamlos und mit ruinösen Folgen mißbraucht wurde.
Um aber zu verhindern, was 1929 geschah, als alle wissen wollten, ob ihr Geld noch existiert, und deshalb erfahren mußten, daß das Geld, das sie zur Bank getragen hatten, nicht mehr existiert, soll man heute Ruhe bewahren. Die vom Staat bewilligten dreistelligen Millardenbeträge zur Stützung „notleidender Banken“ sollen dazu dienen, diese Ruhe zu begünstigen. Erfolg kann diese Intervention nur haben, wenn diese Ruhe auch tatsächlich einkehrt: Wenn die Bankkunden darauf vertrauen, daß es allen zugute kommt, wenn alle Ruhe bewahren. Die Intervention, so viel ist durchgesickert, kann nicht den Schaden beheben, den die Bänker angerichtet haben, dazu ist er zu groß – der Rettungsschirm müßte ein mehrstelliger Billionenbetrag sein - sie kann lediglich dazu beitragen, das verloren gegangene oder verspielte Vertrauen der Bankkunden wieder zu wecken, damit in einem Zeitraum, dessen Größe noch niemand bestimmen kann, sich die Finanzwirtschaft erholen kann, weil die Masse der Anleger darauf verzcihet, das Geld bar abheben zu wollen. Die Banken vertrauen untereinander nicht mehr, deshalb leihen sie einander kein Geld mehr, aber die Kunden sollen den Banken vertrauen, daß sie wieder auf die Beine kommen, damit sie wieder auf die Beine kommen. Durchgesickert ist auch, daß die Bänker selber, als sie die Finanzkrise kommen sahen, mit ihren Streched Cars umgehend zu den Banken ihres Vertrauens gefahren sind, um ihre eigenen Einlagen abzuheben oder zu verkaufen und dafür Gold zu kaufen. Alle anderen konnten das deshalb nicht mehr rechtzeitig tun. Sie haben von der Krise zu spät erfahren, die durch den Alleingang der Bänker beschleunigt wurde. Und die Einlagen der Kunden bestehen im Unterschied zu denen der Bänker zum überwiegenden Teil in Zertifikaten, die an die Bonität der Banken gebunden sind, die bankrott gegangen wären, wenn die Staaten sie nicht gestützt oder gekauft hätten, und die man ohne weiteres und ohne große Verluste vor dem Termin gar nicht abheben oder verkaufen kann. Die Bänker haben den Schaden verursacht, und dem Bankkunden wird gedroht, der Schaden bestünde darin, nicht zu vertrauen. Nicht der Betrug der Bänker sei das Verbrechen, sondern das mangelnde Vertrauen der geprellten Kunden. Hier wird nicht Vertrauen gefordert, sondern Vertrauen ins Vertrauen, ein reflexiver Mechanismus mit magischer Kraft.
Die Bänker haben zwanzig Jahre lang darauf gesetzt, daß der Schaden, den sie anrichten, nicht ihnen zur Last gelegt werden wird, da er zu groß sein wird, um die Banken fallen zu lassen. Sie haben gehofft, daß ihr Unwesen so lange nicht auffliegen wird, bis der Schaden so groß geworden sein wird, daß die Staaten mit Steuergeldern die Banken retten müssen, um den Zusammenbruch der Realwirtschaft zu verhindern und den drohenden Staatsbankrott abzuwenden. Die Bankenaufsichtsgremien, die Vorstände, die Kontrolleure, die Politiker haben solange weggeschaut und haben emsig sämtliche gesetzlichen Barrieren für diesen Coup beseitigt. Wahrscheinlich da auch sie Angst hatten vor dem Offenbarungseid. Es blieb nur die Unterstützung der Erpressung übrig.
Das Spiel gleicht dem Spiel, das wir als Kinder Lügen nannten, bei dem sich in der geschlossenen Faust eine unbekannte Anzahl von Streichhölzern befindet, und man nicht verpflichtet ist, die Wahrheit über den Inhalt zu sagen, und der gewinnt, der mit seiner Schätzung der Wahrheit am nächsten kommt oder die anderen dazu bringt, auf ihr Recht zu verzichten, den Inhalt der Hand zu sehen zu bekommen. Bei der Variante, die in der Finanzwelt gespielt wird, kann die geschlossene Faust mit dem behaupteten Inhalt gegen ein Gebot verkauft und von dem Käufer wiederum weiterverkauft werden u.s.w., ohne daß jemals die Faust geöffnet werden muß oder darf. Alle diejenigen, denen es gelingt, die geschlossene Faust jemand anderem anzudrehen, bekommen Prämien. Am Ende dieser Reihe steht der Bankkunde, dem der Berater einredet, er kaufe ein relativ sicheres Produkt, es müßte schon mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht sicher sei, da müßte ja das ganze Bankenwesen zusammenbrechen. Und das ist ausgeschlossen.
Nun ist durchgesickert, inzwischen pfeifen es die Spatzen von den Dächern, daß die Faust, die mehrmals um die Welt ging, von Anfang an und 20 Jahre lang leer war. Während die Bänker bei jedem Weiterreichen des imaginären Geldes verdient haben, zwischen 25 und 35 % des angeblichen Werts, steht der Endverbraucher mit leeren Händen da. Und nicht nur das, die Differenz zwischen den behaupteten Gewinnen und den tatsächlichen Verlusten, deren Höhe nach vorsichtigen Schätzungen bei 250 Billionen liegen soll, muß von den geprellten Kunden ausgeglichen werden, indem sich die Staaten verschulden und diese Schulden durch Steuern wieder hereinholen müssen oder durch Inflation an die Bevölkerung weiterreichen. In dieser Situation nun soll der Bürger vertrauen.
Das Wort reichert sich immer mehr mit Wut und Grauen an. Es wird zur Drohung, zu einem Angebot, das man nicht ablehnen kann, wie es in Mario Puzos „Paten“ hieß. Wehe dir, wenn du nicht vertraust! Vom Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, wird Vertrauen abverlangt.
Ausgangspunkt des Spiels waren sogenannte Ninja-Kredite, Kredite an Personen ohne Vermögen und mit geringem Einkommen und ohne Sicherheiten. Sie sollten sich von dem Kredit ein Haus kaufen, und ihnen wurde eingeredet, daß sie von der unvermeidlichen Wertsteigerung der Immobilie Zinsen und Tilgung werden bezahlen können. Das, was sie von dem geliehenen Geld kaufen konnten, galt als Sicherheit. Bei dem Bankkunden landet der abstrakte Rechtsanspruch auf die Zurückzahlung von Krediten und Zinsen in der Form eines Wertpapiers, ohne daß irgendjemand von all denen, die diese Ansprüche gekauft und weiterverkauft haben, wüßte, worum es sich handelt. Die Spielregel bestand darin, niemals zu fordern, daß die Faust geöffnet wird, also dem jeweils vorherigen Besitzer zu vertrauen. Die Boni haben den Charakter von Schweigegeld oder Schutzgeld. Die aberwitzige Höhe dieser „Vergütungen“ erklärt sich, wenn man berücksichtigt, wie hoch mit der Zeit das Risiko wurde, das durch Schweigegeld verheimlicht werden mußte. Mit der wachsenden Zahl der Mitwisser, mußte auch die Zahl der Leute wachsen, die in den Genuß der aberwitzig hohen Boni gelangten. Dem angerichteten Schaden von 2,5 Billionen $ entspricht eine Gehalts-Boni- Abfindungs-Pensions-Summe von sagen wir 250 Milliarden.
Man wußte sich als Teilnehmer an diesem Lügen-Spiel als Teil der Gemeinschaft der normalen Menschen, der ausgeschlafenen „Leistungsträger“, um ein Lieblingswort Guido Westerwelles zu verwenden. Wenn nun plötzlich offenbar wurde, daß bei dem Spiel etwas faul ist, da, wenn alle ihre Einlagen und Ersparnisse zurückhaben wollten, sie sämtlich futsch wären, dann steht diese Grundüberzeugung in Frage. Auch der Glaube an den Fetisch Rendite ist erschüttert. Er wird nicht mehr als etwas geglaubt, das alle eint, sondern hat sich offenbart als etwas, bei dessen Ausübung einige wenige Gewinn machen, u.z. auf Kosten der großen Masse. Was als Vernunft galt, die Rolle des homo oeconomicus zu spielen, erweist sich nun als Dummheit. Den Menschen wurde auferlegt, für ihre Altersvorsorge selbst zu sorgen, und ihnen wurde eingeredet, daß die Wirtschaft darauf angewiesen sei, daß sie ihr Geld anlegen und auf Rendite setzen. Aber in dieser Situation hat die FDP regen Zulauf wie nie zuvor.
Was als Vertrauen verkauft wird, erfüllt in Wahrheit den Straftatbestand der Nötigung und der Erpressung. Zugleich ist die Forderung zu vertrauen ein Appell an die moralische Verantwortung jedes Einzelnen. Es ist, als befänden wir uns alle in einem Kino, hinter dessen Leinwand Feuer ausgebrochen ist, das jeden Moment den Zuschauersaal erfassen kann. Alles was getan wird, darf nicht nach Panik aussehen, denn Panik ist ansteckend. Sie ist eine Krankheit, die ausbricht, indem sie ausbricht, und die solange nicht existiert, wie man das Ausbrechen verheimlichen kann. Man entscheidet selbst, ob man panisch sein will oder nicht. Die einzige Unsicherheit dabei ist, daß alle anderen mitmachen müssen. Genau wie in einer Panik ja auch alle mitmachen müssen. Vertrauen ins Vertrauen ist die umgekehrte, die positive Panik.
Das geforderte Vertrauen hat auch eine erkenntnistheoretische Seite. Wenn alle begreifen, daß ihr Geld verschwunden ist, und sie es von der Bank zurückhaben wollen, dann ist es tatsächlich weg. Sie müssen also dazu gebracht werden, so zu tun, als sei es noch da und sich damit zufrieden geben. Sie müssen wider besseres Wissen vertrauen, und dieser vorsätzliche Verstoß gegen das bessere Wissen ist das noch bessere Wissen.
Wir sind alle wie Candide, der weiß, daß es sich, wenn man mit Leibniz die bestehende Welt als die beste aller möglichen auffaßt, um Idiotie handelt, der aber zugleich weiß, daß er dies nicht wissen darf: ein positiver Candide, einer, der die Lektion von Auguste Comte gelernt hat.
Das geforderte Vertrauen hat frappierende Ähnlichkeit mit dem christlichen Glauben, wie man feststellen kann, wenn man sich die Genese der kanonischen Kirche aus den apokalyptischen Bewegung vergegenwärtigt, die der Jude Jesus einst anführte. Angesichts des Ausbleibens des Weltuntergangs, auf den das Reich Gottes auf Erden folgen sollte, beschloß Augustinus, die gegebene Realität für das Reich Gottes zu erklären, das bereits auf Erden existiere und an dessen Vervollkommnung man arbeiten müsse. Die Christen sollten darauf vertrauen, daß das, an dessen baldigen Eintritt sie glaubten, bereits vorhanden sei. Augustinus verlangte von den Gläubigen, indem er das Christentum legalisierte und zur Staatsreligion erhob, sich dumm zu stellen, um klüger zu sein, als die anderen. Der Topos der verkehrten Welt, der ein eschatologisches Erkenntnisinstrument war, verkehrt sich zum Gegenteil, zu einem notwendigen Nichtwissen, zum Inbegriff einer für das Fortbestehen des Ganzen notwendigen Dummheit, als einzig mögliche Rettung vor der sicheren Enttäuschung.
Sonntag, 2. Januar 2011