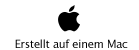Verwerfung
Sigmund Freud gebrauchte beiläufig den Begriff der Verwerfung, um eine „weit energischere und erfolgreichere Art der Abwehr“ zu kennzeichnen, als sie bei Neurosen in Kraft ist, die er darum den Psychosen zuordnet. Sie besteht darin, daß das Ich sich so benimmt, „als ob die unerträgliche Vorstellung mitsamt ihrem Affekt nie an das Ich herangetreten wäre“. (Freud, die Abwehr-Neuropsychosen, in: GW I., s. 72) Infolge der Verdrängung bildet das neurotische Subjekt zwar falsche Assoziationen, auf seine Weise aber glaubt der Neurotiker die Sprache zu besitzen. Die Verwerfung dagegen ist ohne Sprache. Es kommt in Lacans Worten nicht zu „falschen Assoziationen“ innerhalb einer im Prinzip intakten Kette von Signifikanten, sondern zu einer falschen Verknüpfung des Knotens, die zur Folge hat, daß der Psychotiker keinen Eingang ins „Haus der Sprache“ findet. „Wenn der Neurotiker die Sprache bewohnt“, schreibt Lacan, dann wird der Psychotiker bewohnt, besessen, von der Sprache.“ Ausgehend von Freuds Arbeit über die Verneinung postuliert er ein primordiales Stadium der Bejahung, von dem er die Verwerfung ableitet: „Im Verhältnis des Subjekts zum Symbol gibt es die Möglichkeit einer ursprünglichen Verwerfung, nämlich, daß etwas nicht symbolisiert ist, das sich im Realen manifestieren wird.“ (Lacan, das Seminar III, s. 296; Freud, die Verneinung, in GW XIV, S. 11.15)
Die Psychoanalyse folgt den Wegen, die das Wort einschlägt, bis an die Grenze des Realen, wo es zu zerbrechen droht und sich gleichzeitig daran wieder aufrichtet. So Widmer zu Lacan.
Lacan: „Die Funktion des Wortes ist die des Gründens. Das Wort gründet das Subjekt. Welches Subjekt aber? Das mit Entfremdung von sich selbst geschlagene Subjekt ... Wir bezeichnen schlagwortartig das Unbewußte als die Rede des Anderen (...) Unter der Rede des Anderen verstehen wir nicht die imaginäre Entfremdung in das alter ego, die narzißtische Spiegelung, die aber noch das Urbild des Ich ergibt, insofern das Ich sich in dieser Entfremdung allererst bildet.“ (Der Sinn einer Rückkehr zu Freud in der Psychoanalyse, in: Wo Es war 5-6 (1988) s. 5-9...“, S. 6f) „Das ,absolute‘ Andere ist das andere Subjekt, das durch die ursprüngliche Vermittlung des Wortes mit dem Subjekt-Ich zugleich in diesem gründet und entspringt (...) Das unbewußte Subjekt ist exzentrisch in Bezug auf das Ich“ (ebenda S. 8)
Ein Beispiel für die Verwerfung gibt der Künstler Franz Xaver Messerschmidt. Seine Charakterköpfe stellen Selbstbildnisse dar, deren Funktion in einer atropopäischen Wirkung liegt, in einer Abwehr und Bannwirkung der ihn verfolgenden Geister. Um Macht über die Geister der Verhältnisse zu gewinnen, kneift Messerschmidt sich in verschiedene Körperteile, meist in die rechte Seite der Rippen, und verbindet mit dieser Haltung eine Grimasse, er kniff sich, er schnitt Grimassen vor dem Spiegel, und glaubte, die bewunderungswürdigsten Wirkungen von seiner Herrschaft über die Geister zu erfahren... er sah dabei eine halbe Minute in den Spiegel und machte mit größter Genauigkeit die Grimasse, die er brauchte.
Gespiegelte Grimassen werden in der Lacan’schen Psychoanalyse als Spiegelzeichen der als Schizophrenie beschriebenen Symptome behandelt. Sie gelten als Ausdruck des Selbstfindungsversuchs eines Subjekts, das unter dem drohenden Zerfall seines Körperbildes in gestischen und mimischen Muskelspielen die Beherrschung über sich selbstständig machende Körperteile und Gesten zurückzugewinnen versucht. Er werde, gibt Messerschmidt zu Protokoll, besonders des Nachts, von Geistern heimgesucht. Ausgerechnet er, der beständig keusch gelebt habe, müsse die Peinigungen der Geister ertragen, obgleich man doch erwarten könne, daß sie mit ihm wegen des untadeligen Lebenswandels in gutem Einvernehmen stünden.
Vermöge seiner Bilder scheint es dem betroffenen Künstler gelungen zu sein, einen drohenden Absturz zu verhindern und sich gerade mit den Mitteln seiner schöpferischen Fähigkeiten aus den Zuständen geistig-seelischer Verwirrung wenigstens teilweise zu befreien. Es ist der Lacan-Schule geläufig, wie wie nach einem autistischen Rückzug eines Subjekts und seiner narzißtischen Selbstbesetzung, was den eigentlichen Kern einer Psychose ausmacht, bestimmte Mittel eingesetzt werden, um wieder Zugang zur äußeren Welt und zu zwischenmenschlichen Beziehungen zu erlangen. Zu einer solchen Restitution gehören nicht nur Wahnbildungen und Halluzinationen (die somit selbst bereits einen Selbstheilungsversuch gegenüber einem möglichen Persönlichkeitszerfall darstellen), sondern auch kreative Tätigkeiten als Ausdruck eines schöpferischen Dranges. Ein derartiges bildnerisches Schaffen, wie es Messerschmidt an den Tag legt, das nach Lacan neben anderen psychopathologischen Bildungen als restrukturierendes und psychosenspezifisches Sinthome dem konfliktlösenden neurotischen Symptom gegenüberzustellen ist, hat in systematisierter Form seit dem Beginnn des 20. Jh. als „Kunst der Geisteskranken“ oder, positiver formuliert, als „zustandsgebundene Kunst“ auch Eingang in die Kunstgeschichte gefunden und dabei auch das etablierte Kunstgeschehen wie etwa in der art brut nachdrücklich beeinflußt.“
Brüche und Einrisse im Lebenslauf, Zerwürfnisse in sozialen Beziehungen, die Zusammenkunft verschiedenartigster Einflüsse im Gefüge einer Person, sonderbare und merkwürdige bis skurrile und verrückte Eigenschaften und Verhaltensweisen in seinem sonst unauffälligen Dasein sowie Diskontinuitäten in seinem Werk können einem Künstler den Status eines psychopathologischen Falles eintragen. So kann ein Subjekt zu einem Objekt werden, zu einem Verhandlungsgegenstand, zu einem Fall also, in dem die Person negativ konnotiert ist, was mit Herabsetzung, Entwertung, Entwürdigung bis hin zur Entmündigung einhergehen kann. Dasselbe kann ihm aber auch den Ruf eines bahnbrechenden Genies verleihen.
(Ernst Kris, Vortrag in der Wiener psychoanalytischen Vereinigung 1932 über die „Charakterköpfe des Franz Xaver Messerschmidt“; ders. Bemerkungen zur spontanen Bildnerei der Geisteskranken (1936) in: ders. die ästhetische Illusion. Phänomene der Kunst in der Sicht der Psychoanalyse, Ffm. Suhrkamp 1977, S. 75-116)
Sonntag, 2. Januar 2011