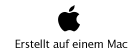Zomia
„Die Eroberer nehmen einem alles, aber von den Rüstungen der Eroberer fallen Wörter wie kleine Steinchen herab“, dichtete Pablo Neruda. Eignen sich diese Steinchen aber als Waffen? Haben also auch die Schwachen Waffen? Es scheint welche zu geben, auf die das zutrifft. Sie vermögen sogar, die Evolution umgekehrt verlaufen zu lassen. James C. Scott behauptet dies in seiner Studie über einige Bergvölker in Südostasien, vor allem in Vietnam und Tailand. In „The Art of not being governed“ spricht er von den weapons of the weak. Jene Bergvölker verfügten über Techniken, die dörfliche moral economy gegen den Staat zu verteidigen.
Wanderfeldbau und Nomadismus sind Staaten suspekt, weil sie die Ansprüche der Standardisierung und Vereinfachung nicht erfüllen, die Voraussetzung ist, um seine Projekte verwirklichen zu können. Der Reisanbau auf großen, bewässerten Feldern benötigt eine seßhafte Bevölkerung, die staatliche Aktivitäten wie Steuereintreibung, Frondienste oder Kriegsführung ermöglicht.
Seit jeher werden diejenigen, auf welche die Errungenschaften der Zivilisation nicht die erhoffte Anziehungskraft ausübten, die den hohen Preis für Zivilisation nicht zu zahlen bereit sind, Primitive oder Barbaren genannt.
Zomia wird nach einer Bezeichnung, die der niederländische Historiker Willem van Schendel einführte, das sich von Vietnam und Südchina über Laos, Thailand, Burma bis in den Osten Indiens erstreckende Hochland genannt. Entgegen der von Tourismusindustrie lancierten Behauptung, diese Region sei ein Museum überholter Lebensformen, behauptet Scott, sie sei eine Region, in der sich Gemeinschaften, die im Prozeß der Staatenbildung vertrieben wurden, anzusammeln vermochten. Außerhalb der Machtzentren in einigen hundert Metern überm Meeresspiegel schwand der staatliche Einfluß, da weder Soldaten noch Bürokratie effizient ausreichend versorgt werden konnten. Steile Berge machten die Transportkosten für Reis und andere Nahrungsmittel unfinanzierbar.
Wer genug hatte von Steuern, Militärdiensten und Enteignungen, konnte sich einfach in die Berge absetzen. Die Bedingungen in den Tälern und Küstenregionen führten den Bergen ständig neue Bewohner zu. Die Staaten hatten so genug damit zu tun, ihre Bevölkerung zu halten. Die Machtzentren waren auf den Handel mit den Bergvölkern angewiesen, versuchten zugleich, durch riskante Menschenraubzüge oder durch den Kauf von Sklaven ständig ihre Bevölkerung aufzufrischen. Bergvölker und Talbewohner stehen, auch wenn das Verhältnis nicht selten feindschaftlich ist, in einem symbiotischen Verhältnis zueinander.
Vermeintlich ethnische Merkmale wie Wanderfeldbau, ethnische Vielfalt, Mehrsprachigkeit, Schriftlosigkeit, flache Hierarchien, egalitäre Strukturen, Gleichstellung der Geschlechter, Selbstgenügsamkeit etc. hält Scott nicht für ursprüngliche Merkmale archaischer Bergvölker, sondern für das Resultat sekundärer Anpassungen. Er widersetzt sich damit dem klassischen Evolutionsschema, demzufolge Jagen, Sammeln und Wanderfeldbau als primitive Vorstufen der seßhaften Landwirtschaft betrachtet werden.
Evolution wird immer als Fortschritt in eine bestimmte Richtung gedacht. Sie verläuft von niedrigen zum höheren Lebens- und Wirtschaftsformen, vom Einfachen zum Komplexen. Auf das Entstehen des Lebens im Wasser folgt das Heraustreten der Tiere aus dem Wasser, die Umwandlung von Flossen in Beine. Wir stellen uns das Lernen der Natur immer nur als Lernen des Vorteilhaften vor. Mit der Unterstellung, Natur sei auf wachsenden Vorteil aus, fließt immer eine Bewertung ein, die der gegenwärtigen Wirtschaftsweise entlehnt ist, ein Bias. Sowohl die Urszene als auch die Richtung der Evolution werden konstruiert nach Maßgabe der gegenwärtig gültigen Gemeinplätze. Rückschritte sind nur als Folge von Katastrophen denkbar. Es könnte aber sein, daß der Rückschritt selbst der Fortschritt ist. Der Wal stammt von Landtieren ab, man hat als Ahnen das Nilpferd im Verdacht. Hilfreich wäre die methodische Indifferenz gegen die Bewertung des Unterschieds zwischen Land und Meer. Die Bewohner von Zomia haben sich sogar die Schriftkultur wieder abgewöhnt.
Montag, 3. Januar 2011