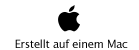Apfel der Zwietracht
Schuld an allem war zweimal ein Apfel. Das eine Mal ist es der, den sich Eva, alle Warnungen in den Wind schlagend, von der Schlange andrehen läßt. Das andere Mal ist es der Zankapfel, den Paris einer der drei Grazien verleihen muß. Alle Götter sind zur Hochzeit des Peleus und der Thetis eingeladen, ausgenommen Eris, die „Göttin der Zwietracht“. Beleidigt wirft sie von der Tür aus einen goldenen Apfel mit der Aufschrift „Für die Schönste“ unter die feiernden Götter des griechischen Olymps. Daraufhin kommt es zum Streit zwischen Aphrodite, Pallas Athene und Hera, wem dieser Apfel gebühre (Zankapfel). Zeus als höchste olympische Instanz zieht sich aus der Affäre, indem er das Urteil in die Hand eines Sterblichen legt: Er bestimmt den unschuldigen Jüngling Paris, den schönen, wenngleich verstoßenen Sohn des trojanischen Königs Priamos und seiner Ehefrau Hekabe, als Schiedsrichter. So trägt er Hermes auf, die Göttinnen zu Paris zu bringen, damit dieser entscheide.
Jede der Göttinnen bietet Paris einen Preis an, um ihn günstig zu stimmen. Hera verspricht dem Prinzen, um ihn für sich zu gewinnen, Macht. Athene verspricht ihm Weisheit, und Aphrodite vermag ihn erfolgreich zu bestechen, indem sie ihm die Liebe der schönsten Frau der Welt verspricht, als die unbestritten Helena gilt. Diese jedoch ist bereits mit Menelaos, dem König von Sparta, vermählt. Der aus diesem Konflikt resultierende Raub der Helena wird zum Auslöser des Trojanischen Krieges und kostet sowohl Paris als auch Menelaos das Leben.
Paris ist Bruder von Hektor und Kassandra. Hekabe träumte vor der Geburt des Paris, sie würde eine Fackel gebären, die Troja in Brand steckt. Nachdem sie Priamos von dem Traum erzählt hat, läßt dieser den Traumdeuter Aisakos zu sich kommen. Dieser bestätigt die Befürchtung, Hekabe werde einen Sohn gebären, der Trojas Verderben herbeiführen werde. Von dieser Weissagung erschreckt, beschließen Priamos und Hekabe, das Neugeborene auszusetzen. Der Auftrag wird Agelaos, einem Sklaven des Königs, übertragen, der das Kind auf dem Berg Ida aussetzt. Als er nach einiger Zeit reumütig an den Ort zurückkehrt, findet er zu seinem Erstaunen das Kind gesund und munter vor: eine Bärin hat es gesäugt. Agelaos nennt den Jungen Paris und zieht ihn bei sich auf dem Feld und bei den Hirten auf. Er wächst als Schäfer auf, ohne eine Ahnung von seiner tatsächlichen Abstammung und Bestimmung. Mit Erreichen des Mannesalters heiratet er die Nymphe Oinone, eine Tochter des Flußgottes Kebren.
Eines Tages erscheint also Hermes vor Paris und bittet ihn, das Urteil darüber zu fällen, welche der drei Göttinnen, Hera, Athene oder Aphrodite, die Schönste sei. Paris entscheidet sich für Aphrodite, wohlwissend, daß er nun die anderen beiden Göttinnen gegen sich haben würde. Hera schwört Paris und den Trojanern ewige Feindschaft. Ihr Haß wird zum Untergang Trojas beitragen und noch den Trojaner Aeneas auf seinen von Vergil kolportierten Irrfahrten verfolgen.
Damit Heras Fluch sich erfüllen kann, muß Paris nach Roja zurückgekehrt sein. Diesem Nachtrag zur Vorgeschichte dient folgende Episode. In Troja trauert Hekabe immer noch um den verlorenen Sohn. In ihrem Kummer wendet sie sich an Priamos; der verspricht ihr, Leichenspiele zu Ehren des verlorenen Prinzen zu veranstalten. Als Preis wird ein besonders kraftvoller Stier aus den Herden des Königs auf dem Berg Ida ausgesetzt. Dieser Stier ist jedoch das Lieblingstier des Paris, so daß dieser beschließt, an den Spielen in Troja teilzunehmen, um selbst den Stier zu gewinnen. Auf diese Weise kehrt er nach Troja zurück, ohne zu wissen, daß er ein Sohn des Priamos ist. Als einfacher Hirte, für den er sich weiterhin hält und für denn er auch von den anderen gehalten wird, gelingt es ihm, den Sieg über seine Brüder und die stärksten jungen Trojer zu erringen. Paris Bruder Deiphobos jedoch will sich mit seiner Niederlage gegen einen Hirten nicht abfinden und möchte ihm am liebsten die Kehle durchschneiden. Aus Furcht vor Deiphobos flieht Paris zum Altar des Zeus. Dort sieht ihn seine Schwester Kassandra, die mit der Fähigkeit zum Wahrsagen und Hellsehen begabt ist, und sie erkennt in ihm den lange für tot gehaltenen Bruder. Als die Eltern von ihr hören, daß der verloren Geglaubte wieder aufgetaucht sei, nehmen sie ihn in den Königspalast auf. Die Weissagung, Paris werde die Brandfackel Trojas sein, ist vergessen. Kassandra versucht verzweifelt, sie daran zu erinnern, doch vergeblich, denn Apollon hat sie mit dem Fluch belegt, daß niemand ihre Prophezeiungen und hellsichtigen Warnungen ernst nimmt.
Dem König Priamos ist vor langer Zeit von den Griechen die Schwester Hesione geraubt worden. Aphrodite redet Paris nun ein, im Rat der Troer vorzuschlagen, eine Gesandtschaft nach Sparta in Griechenland zu entsenden, die Hesione zunächst friedlich zurückverlangen, notfalls jedoch mit militärischer Gewalt zurückbringen soll. Bei dieser Gelegenheit berichtet Paris von seinem Urteil und davon, daß er fortan unter Aphrodites Schutz stehe. Priamos vertraut der Hilfe Aphrodites und willigt in den Plan ein. Zur Gesandtschaft gehört neben Paris auch Hektor. In Sparta begegnet Paris jener Helena, die Aphrodite ihm als Gattin versprach. Paris entführt sie, was ihm leichtgemacht wird, da Helena sich in ihn verliebt hat, und löst damit den Krieg aus.
In diesem Krieg wird Paris bei einem Duell mit Menelaos, dem rechtmäßigen Gemahl der Helena und König von Sparta, fast von seinem eigenen Helmriemen erdrosselt, bis sich Aphrodite selbst einmischt und ihn in einer Wolke verschwinden läßt und so in Sicherheit bringt. Es gelingt ihm dann, den gefürchteten Achill zu töten, der als unverwundbar galt. Doch Apollon führt Paris beim Bogenspannen die Hand, so daß sein Pfeil Achills Ferse trifft, seine einzige verwundbare Stelle.
Der griechische Bogenschütze Philoktet besitzt den Bogen und die Pfeile des Herakles, die mit dem tödlichen Gift der Lernäischen Schlange vergiftet sind. Mit zweien dieser Pfeile verwundet er Paris. Leidend schleppt dieser sich auf den Berg Ida zu Oinone, seiner ersten Ehefrau, und bittet sie, ihn mit dem Gegengift, das nur sie besitzt, zu retten. Aus Zorn darüber, daß er sie einst für Helena verlassen hat, verweigert sie ihm jedoch jegliche Hilfe. Qualvoll erliegt Paris seiner Verletzung. Oinone aber wird nun von Reue überwältigt; sie läßt für Paris einen Scheiterhaufen aufschichten und springt zu dem geliebten Toten in die Flammen. Helena fällt als Ehefrau an dessen nächst jüngeren Bruder, Deiphobos.
Auf Paris wird verwiesen, wenn sich ein Mann zwischen drei Frauen entscheiden muß. Wie oft mag es diese Situation schon gegeben haben. Der alltägliche Paris aber, der sich entscheiden muß, ist ein anderer als der mythische, er ist notwendig ein falscher Paris. Er kann sich nicht sicher sein, ob er die richtige Wahl treffen wird. Wenn er diejenige wählte, die ihm am begehrenswertesten und somit als die erste Wahl erscheint, dann wäre es keine freie Wahl, sondern etwas von der Natur Erzwungenes. Wenn er sich für eine der beiden anderen entschiede, wäre es zwar eine freie Wahl, doch nicht die der besten Kandidatin.
Vielleicht war sogar der richtige Paris ein falscher Paris. Indem sich Paris unbewußt für die entschied, die zum Auslöser des Krieges werden sollte, so daß sich sein Orakel erfüllte, entschied er sich für die falsche Venus oder Aphrodite, für ihren Schatten, ihre dunkle Seite. Die Venus, wie wir sie kennen, ist diejenige Botticellis. Unser Bild von der Liebesgöttin ist von jenem Gemälde (Fresco?) bestimmt. Wir nehmen dabei in kauf, daß sie in ihrer gipsernen Statuarik all dem so gar nicht entspricht, was wir assoziativ mit Liebe und Lust verknüpfen. Wir nehmen merkwürdigerweise keinen Anstoß daran, daß die Venus Botticellis statt die Herzen zu erwärmen, in ihrer Erstarrung alle Sinnlichkeit kaltstellt. Didi Hubermann stellte ihr darum eine andere zur Seite, die dargestellt sei in einem Bilderzyklus, den man bisher nicht mit diesem Mythos in Verbindung brachte.
Die beiden Verkörperungen der Venus regten Didi Hubermann an zu seinem Essay: „Venus öffnen“, in welchem er die etablierte Kunstauffassung als Ideologie kritisiert. Nicht trotz sondern gerade wegen der geleugneten Evidenz des Unsinnlichen sei Botticelelis Venus zum ikonographischen Paradebeispiel für die neuplatonische Malerei-Auffassung geworden: als vermeintlich wörtliche Umsetzung literarisch humantistischer Programme. Er konfrontiert diese enterotisierte Venus nun mit ihrem eigenen Mythos. Dem Befruchtungsakt, dem sie ihre Geburt verdankt, war eine wüste Tat der Kastration des Uranos vorangegangen, eine „Schönheit produzierende Katastophe“. Und ebendiesen gewaltsamen Ursprung des Mythos sieht Didi-Hubermann in dem Bilderzyklus „Das Gastmahl des Nastagio degli Onesti“ dargestellt. In ihm sieht man eine in schreckliche Unruhe vesetzte, gehetzte und schließlich abgeschlachtete Nacktheit. Hier rennt schreiend und mänadengleich eine nackte Frau durch die Bilder, „die in einer ewigen Ermordung vergeht“.
Die literarische Quelle, die Botticelli hier getreu umsetzte, ist die achte Episode aus Boccaccios „Decamerone“, für die sich die Bezeichnung „Höllenjagd“ eingebürgert hat. Die Geschichte erzählt von unerfüllter Begierde und von der Rache für Hartherzigkeit und weiblichen Hochmut. Der junge Nastagio aus Ravenna ist seiner unerwiderten Liebe zu der Tochter des Paolo Traversari derart erlegen, daß er mit Selbstmordgedanken spielt. Wohlmeinende Freunde raten zu einer Luftveränderung, die den Liebeskranken in die ländliche Region der terra ferma führt. Dort, in einem Pinienwald, hat er beim Spaziergang eine schreckliche Vision: Er sieht, wie eine junge Frau von Hunden und einem bewaffneten Reiter durch den Wald gejagt und niedergemetzelt wird. Als er rettend eingreifen will, erläutert ihm der Verfolger die Vergeblichkeit dieses Unterfangens und entpuppt sich damit als Nastagios bereits verstorbener Vor- und Doppelgänger auf dem Gebiet spröder Schönheiten und nicht erhörter Liebe und als abschreckendes Drohbild seiner selbst. Er sei nach seinem Selbstmord dazu verdammt, so berichtet der Fremde, seine grausame Geliebte jeden Freitag einer sich unentrinnbar wiederholenden Dauerpenetration zu unterwerfen. „Soft ich sie alsdann erreiche, so oft durchbohre ich sie mit diesem selben Degen, mit dem ich einst mich umgebracht, öffne ihr, wie du sogleich gewahren wirst, mit dem Messer die Seite, reiße das kalte Herz, in das weder Liebe noch Mitleid den Eingang zu finden wußten, samt den übrigen Eingeweiden aus ihrem Leibe und werfe es den Hunden hier zum Fraße vor. Dann vergehen nur wenige Augenblicke, und sie ersteht nach Gottes gerechtem Ratschluß durch seine Allmacht nicht anders vom Boden, als ob sie nie getötet worden wäre, und danach beginnen die klägliche Flucht und die Verfolgung durch mich und die Hunde von neuem“.
Nastagio erkennt das didaktisch-moralische Potenzial dieser Vision und beraumt am nächsten Freitag ein Bankett am Ort des zwanghaften Geschehens an, zu dem jener Fremde sowie auch seine sich zierende Geliebte als heimliche Hauptperson geladen werden. Die Gesellschaft wird Zeuge der als Theaterstück aufgeführten grausamen Szene, die der Fremde erneut fast wortgleich kommentiert. Das Geschehen führt in Nastagios Angebeteter einen wundersamen Sinneswandel herbei: Sie ist plötzlich bereit, ihn zu heiraten, wenn auch vielleicht mehr aus Angst vor einem vergleichbaren Schickal, denn aus wahrer Liebe, was immer das auch sein mag. Botticellis unsinnliche Venus ist nun erkannt als diejenige kaltherzige Frau, die nach der Hatz immer wieder neugeboren wird, um bis in alle Ewigkeit jeden Tag erneut zerfleischt zu werden.
Indem Didi-Hubermann Botticellis „Höllenjagd“ als verklausulierte Aphrodite-Darstellung entschlüsselt zu haben glaubt, teilt sich für ihn Venus/Aphrodite nun in zwei Wesen: die warme, aufreizende Exotin als Geraubte und Getötete und die als marmornkalte klassische Schönheit täglich Wiedergeborene. Die Vereinnahmung der entsinnlichten, aus dem Schaum des Meeres soeben wiedergeborenen Venus ist das Ablenkungsmanöver, das der Kunsttheoretiker vollführt, um sich unbeobachtet und folgenlos den sinnlichen Aspekten der Kunst widmen zu können.
Die offiziell geleugnete und heimlich gepflegte sinnliche Seite der Kunst kommt in manchen literarischen Zusammenhängen zur Sprache. Manfred Flügge vermutet, daß die Dramatik der Dreiecks-Beziehung, die Truffaults Film „Jules et Jim“ zugrundeliegt, zwischen Pierre Roché, Franz Hessel und Helen ... , nicht unwesentlich bestimmt wurde von der schockhaften Wahrnehmung einer antiken Skulptur eines von einem Satyr geraubten Mädchens. Dessen merkwürdig ambivalenter Gesichtsausdruck, das kaum angedeutete Lächeln auf ihrem Gesicht, regte die Phantasie der beiden Männer mehr an, als sie selber wußten und zum Ausdruck zu bringen und zu kommunizieren vermochten. „Erst Tage später kann er darüber reden“, heißt es von Franz Hessel. „Die archaischen Mundwinkel des jungen Mädchens, kaum ein Lächeln... haben sich tief eingeprägt“. Er registriert bei sich den in tiefen Schichten des Unbewußten auf ein kaum wahrnehmbares Signal reagierenden Impuls, die Frau vor sich selbst retten und sie gerade darum haben zu müssen.
Dienstag, 4. Januar 2011