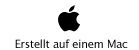Intermundien
Wenn Karl Marx von den Intermundien der alten Welt sprach, in denen er die Geburtsstätten des Kapitalismus lokalisierte, von wo aus dessen frühe Agenten auf den Weltmeeren die Peripherie fanden, die zur universalen Mitte werden sollte, so lassen sich zugleich Prozesse des Ausgrenzens von einst integralen Bestandteilen der sozialen Aggregate durch die Zeiten hindurch verfolgen. Dem Kapital als merkwürdig undurchschaute Form einer Subjekt-Objekt-Relation steht der Irre als nicht weniger merkwürdig undurchschaute Subjekt-Objekt-Relation gegenüber. Mehr noch als die Figuren des ewigen Wanderers und des Pilgers ist der Irre Inbegriff derjenigen, die ihre Identität nicht im Kontext der gesellschaftlich angebotenen Rollen und Plätze gewinnen können. Die Irren sind die Passagiere par excellence. Wie Foucault in einer Passage seiner Geschichte des Wahnsinns über den Topos des Narrenschiffes schreibt, leben sie gleichsam permanent auf der Schwelle. Die Schwelle ist ihr Gefängnis. Sie sind sozusagen im Außen eingeschlossen.
Die große Symbolkraft, das Bild des Narrenschiffes besitzt, ist „ihm gewiß bis heute geblieben, wenn wir bereit sind zuzugeben, daß das, was einst sichtbare Festung der Ordnung war, inzwischen ein Schloß in unserem Bewußtsein geworden ist. Eben diese Rolle spielen Wasser und Schiffahrt. Eingeschlossen in das Boot, aus dem es kein Entrinnen gibt, ist der Irre dem tausendarmigen Fluß, dem Meer mit tausend Wegen und jener großen Unsicherheit, die außerhalb alles anderen liegt, ausgeliefert. Er ist Gefangener inmitten der freiesten und offensten aller Straßen, fest angekettet auf der unendlichen Kreuzung...“
Nachfolger des Narrenschiffes gibt es zuhauf. Die Romane Dostojewskijs sind voller Grenzorte, Zwischenräume, Lücken, Ränder, an denen die Ordnung ausfranst. Raskolnikow beispielsweise lebt an einem solchen Nicht-Ort. „Sein enges Zimmer, der sogenannte ‘Sarg’ geht direkt auf den Treppenabsatz hinaus. Seine Tür pflegt er, selbst wenn er fortgeht, niemals abzuschließen; der Innenraum, den er bewohnt, ist also von der Außenwelt nicht eigentlich abgegrenzt. In diesem ‘Sarg’ kann man kein biographisches Leben führen. Hier kann man nur Krisen durchleben, letzte Entscheidungen treffen, sterben oder wiedergeboren werden. Auf der Schwelle, in einem Durchgangszimmer, das direkt auf die Treppe hinausgeht, lebt auch die Familie Marmeladow... Die Schwelle, die Diele, der Korridor, der Treppenabsatz, die Treppe, die Treppenstufen, die zur Treppe hin geöffneten Türen, die Hoftore, die öffentlichen Plätze, die Straßen, die Fassaden, die Brücken, die Wassergräben: das ist der Raum dieses Romans. Dagegen fehlt fast ganz das Intérieur der Salons, Eßzimmer, Säle, Arbeitsräume, Schlafzimmer, in denen das biographische Leben abläuft, in denen sich die Ereignisse der Romane von Turgenew, Tolstoj und Gontscharow entwickeln.“
Dostojewskijs Räume sind Krisenräume, in denen aller privater Schutz schwindet und die Zeit still zu stehen scheint. Es handelt sich um Orte, an denen sich Katastrophen ereignen oder anbahnen, Wechsel vollziehen, das Unerwartete und Unerhörte eintritt, wo Grenzen überschritten, Verbote übertreten werden, an denen Anfang und Ende, Geburt und Tod einander begegnen, an denen in allem auch das Gegenteil enthalten scheint. Es sind weniger positiv fixierte Orte, als vielmehr Löcher im Raum-Sinn-Kontinuum, Lücken, Risse in der Ordnung der Dinge.
Gegenbild und zugleich Kehrseite des Nicht-Ortes ist das Gasthaus. Tavernen an den Überlandstraßen, die Herbergen der Städte, Spelunken sowie die Badehäuser sind ausgezeichnete Orte der Begegnung und des Kontakts verschiedenartigster Menschen, die ob ihres Standes, ihrer Schicht- oder Klassenzugehörigkeit sich sonst nie begegnen, geschweige denn miteinander in Kontakt treten würden, vielleicht nicht einmal voneinander wüßten. Nicht zufällig sind sie privilegierte Schauplätze von Romanen und Theaterstücken. Weil hier auch die Ansprüche der „hohen“ Kultur und die krude Sinnlichkeit der „niederen“ Volkskultur aufeinandertreffen, begegnen sich hier auch die verschiedenen Literaturgattungen. Hafenspelunken, Überlandgasthöfe, Vorstadtkneipen werden nicht nur zum Schauplatz der Begegnung sonst räumlich separierter sozialer Klassen, sondern auch des Hineinragens niederer Literaturgattungen in die höhere. Hier treffen Schelmenroman und Staatsroman zusammen, höfisches Theater und derber Volksschwank. Das „Decamerone“ wie die „Canterbury Tales“ oder „Tom Jones“ von Henry Fielding profitieren von beiden Ebenen der Begegnung.
Das Wirtshaus ist die Nahtstelle zwischen der Welt der Seßhaften und Etablierten und der Welt der Räuber, Vagabunden, Gaukler, Dirnen und Quacksalber. Hier bleibt unklar, ob Falstaff wirklich so ein Taugenichts ist, und ob der spätere König ein besserer Charakter. Hier entpuppt sich, wie im „Jamaica Inn“ von Daphne du Maurier der Graf selbst als Gauner. An diesem Ort offenbart aber auch mancher Lump seinen guten Kern und seine heroische Natur. Hier begegnet man dem Snobismus und Hochmut der Scheiternden, wie im „Rotkehlchen“ (Marcel Carné, Kinder des Olymp). Hier verzechen die professionellen Konspirateure die Streikkasse, wie in Jacques Beckers „Goldhelm“. Das Wirtshaus ist, in der Terminologie Bachtins, ein karnevalesker Ort. Der Nicht-Ort auf der Sinngrenze ist bei Dostojewski der Spelunke unmittelbar benachbart. Auch in Bachtins Welt des Karnevalesken erfüllen beide dieselbe Funktion. Zu klären wäre die Beziehung beider Seiten einunddesselben karnevalesken Symbolkomplexes. Bei dem Changieren und Schillern dieses Topos geht es schließlich um Sein oder Nichtsein.
Dienstag, 4. Januar 2011