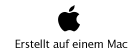Joseph K.
Joseph K. ist ein soziologischer Testfall. Er unternimmt ein Erschütterungsexperiment im Garfinkel’schen Sinne. Anders als Till Eulenspiegel sucht er nach jedem seiner lustigen Streiche nicht das Weite, sondern bleibt da, obgleich auch er diffuse Aggressionen provoziert. Ähnlich wie Don Quijote bemüht er sich, alles richtig zu machen, und er macht auch alles richtig. Genau dies aber wird ihm zum Verhängnis. Don Quijote nimmt die Werte und Normen seiner Gesellschaft beim Wort nimmt und die Ideale für gegeben. Er macht sich zum Narren und setzt chronisch sein Leben aufs Spiel, weil er der soziologischen Grundannahme gehorcht, daß Normen gelten, weil sie befolgt werden. Luhmann wußte es besser, wenn er sagte, daß Normen eben nicht gelten, weil wir sie befolgen, sondern weil wir glauben, daß sich die anderen dran halten. Das erlaubt uns, andere zu verurteilen und zugleich selbst gegen Normen zu verstoßen, ohne uns als Verbrecher betrachten zu müssen. Ohne diesen Spielraum könnten wir nicht normal sein. Don Quijotes Fehler ist nicht, daß er gegen Normen verstößt, sondern daß sich an sie hält, als würden sie gelten. Michael Koolhaas begeht denselben Fehler. Sie fallen als anormal auf, weil sie alles richtig machen. Dies gilt auch für den Protagonisten von Kafkas „Prozeß“. Damit wissen wir zunächst aber nur, daß die Soziologie, Garfinkel mit seiner Ethnomethodologie ausgenommen, einem fundamentalen Irrtum aufsitzt, den ihre Vertreter erkennen könnten, wenn sie Romane lesen würden. Die Frage bleibt unbeantwortet, was Joseph K. allgemein und im Einzelnen falsch macht. Um dies zu erkennen, muß man den „Prozeß“ lesen. Dabei kommt es auf jeden Satz an. Beim Lesen darf man nie vergessen: Normalität und abweichendes Verhalten, sei es kriminologisch relevant oder oder psychopathologischer Natur, müssen in der Interaktion hergestellt werden. Eine Person allein reicht nicht, um zu erklären, wie normative Regelhaftigkeit im Verhalten der Gesellschaftsmitglieder entsteht, auch wenn die Soziologie in Übereinstimmung mit dem Alltagsbewußtsein suggeriert, daß es so sei, wenn sie annimmt, daß die Einzelnen sich an Normen halten. Es müssen mindestens zwei sein, um sowohl Normalität herzustellen als auch Anormalität zu konstituieren. „Jemand mußte K. verleumdet haben“. Der erste Satz des Romans ist also von besonderer Bedeutung.
Was genau geschieht im Prozeß der Konstituierung von Normalität und den Anormalen. Eine jeweils momentane, situationsbedingte Glaubwürdigkeit im Verhalten fungiert als normativer und normalisierender Referenzpunkt. Daraus folgt: Die Aktivitäten, in denen Mitglieder einer Gesellschaft Alltagsangelegenheiten situativ produzieren und managen, sind identisch mit den Prozeduren, in denen diese solche Situationen legitimieren. Soziale Fakten sind deshalb als Rechtfertigungen und Rationalisierungen zu betrachten. Der impliziten Logik dieser Produktion zufolge schafft sie sich in der die ablaufenden Interaktion ihre eigenen, durchaus als situationsenthobene Idealitäten erscheinenden Kriterien. Der Konstitutionsprozeß hat zirkulären Charakter. Bestimmte im Umkreis des bekannten Handlungkontextes auftretende Erscheinungen werden als Anzeichen für das bisher nicht Erkannte Bestehen eines tieferliegenden Sachverhalts aufgefaßt, wobei umgekehrt dieser Sachverhalt vorausgesetzt wird, damit die gemeinten Erscheinungen überhaupt wahrnehmbar werden und einen aufeinander bezogenen Sinn aufzeigen können (...) Auf diese Weise stellt sich ein äußerst feines Gewebe von Erklärungs- und Überzeugungspraktiken her, in dem durch wechselseitige Einladung und Zustimmung gemeinsame Realitäten jeweils neu entstehen, sich bilden und umbilden. Die konkreten Personen sowie die zeitlichen und räumlichen Verhältnisse bilden die stillschweigend vorausgesetzten Verankerungspunkte der Sinnmomente. In der Bindung der praktizierten Sinnstrukturen an das Hier und Jetzt sind sie einerseits nur für den Einzelnen verfügbar, zum anderen ist in dieser Bindung zugleich eine idealisierende Tendenz am Werk, die diesen Sinnstrukturen eine Selbstverständlichkeit und unantastbare Gültigkeit verleiht und sie zum Boden weiterführender Wirklichkeitsmomente werden läßt.
Wer als abweichend auffällt, wer als anormal wahrgenommen wird und diese Wahrnehmung erfährt, muß im Verlauf dieses interaktiven Normalisierungsprozesses etwas falsch machen. Aber was? Was macht K. falsch?
Um herauszufinden, was tatsächlich geschieht, wenn ein Individuum für anormal erklärt und aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird, muß man die Regeln erforschen und anwenden, wie man in einer Gesellschaft anormal wird, indem man überzeugend genug anormal spielt. Joseph K. ersinnt ein Erschütterungsexperiment, mit dem er die Selbstverständlichkeitsstrukturen spontan außer Kraft setzt und die Strukturen der für solche Fälle bereitgehaltenen Heilungsrituale augenblicklich erkennbar werden läßt. Um herauszufinden, was tatsächlich geschieht, wenn ein Individuum für sozial untragbar, für kriminell oder für verrückt erklärt wird und zu etwas wird, gegen das sich die Gesellschaft verteidigen zu müssen glaubt, muß man sich zu den Regeln vortasten, die einem erlauben, überzeugend genug anormal zu spielen. Man muß sich durch Learning-by-doing in die Lage versetzen, Anormalität zu programmieren, d.h. die Informationen auf ein Minimum zu reduzieren, die man einem experimentellen Subjekt geben würde, um es fähig zu machen, sozusagen aus sich selbst heraus perfekt anormal zu handeln. Auf diese Weise bringen wir die anderen dazu, uns zu verraten, gegen welche moralischen Regeln unser Verhalten verstößt. Der Roman protokolliert ein solches Experiment der Selbstsabotage.
Der Roman mag mit jüdischer Identität zu tun haben, mit Antisemitismus und den gesellschaftspolitischen Ereignissen zu Beginn des Ersten Weltkriegs, doch liegt ihm mit Sicherheit nicht die Überlegung zugrunde, wie man hieraus einen Roman machen könnte. Franz Kafka hat auch nicht, wie Neumann wohlweislich vorsichtig formuliert, sich durch sie zum Schreiben „anstoßen“ lassen, Man würde die Tücken des Subjekts übergehen und diverse Vermittlungsschritte zwischen Subjektivität und Wirklichkeit überspringen. Man würde vor allem versäumen, bevor man Theorien und Hypothesen auf den Roman anwendet, anzuerkennen, daß dieser Roman selbst eine Theorie ist.
Mittwoch, 5. Januar 2011