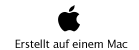Joseph K. 2
Alle Diskurse, die sich dem Einzelnen anbieten, wenn er sich selbst nicht mehr kennt, machen aus dem Subjekt ein Objekt. Wo ein Subjekt sprechen will, findet es sich immer in einer Sprache wieder, die von ihm verlangt, die Perspektive von außen auf es als Objekt zu übernehmen. Luhmann kann zu recht sagen, in der Wissenschaft habe das Subjekt nichts zu suchen. Wo das Subjekt es sich aber nicht nehmen lassen will und kann, im eigenen Namen zu reden, gerät es unweigerlich in einen Sog der Entfremdung. Sobald ich mir selber zum Problem werde und signalisiere, daß ich es nicht alleine schaffe, soll ich es zulassen, daß ich Untersuchungs-Gegenstand oder Erkenntnis-Objekt werde. Wo ich darauf bestehe, als Subjekt meiner selbst wieder herr zu werden, spricht man von Unbelehrbarkeit, Untherapierbarkeit, Abwehr. Während die Wissenschaften, die Kirche, die Psychologie, die Psychoanalyse entweder von dem Drang des Subjekts, an sich festzuhalten, schweigen oder es enteignen, bietet die Belletristik dem Subjekt das einzige Medium, auf seinem Stammeln zu bestehen. Einzig im Medium der Poesie, der Erzählung, des Romans kann ich die Erfahrung machen, daß ich es selber tue, wenn ich mir fremd werde, und daß ich in der Sprache reden muß, in der ich reden würde, wenn ich eine Sprache hätte. Die Belletristik ist das Medium, in dem das doppelte Paradox eine Heimat hat, selbst zu tun, was ich erleide, und zu sprechen, da ich schweige. Lacan findet für diesen Widerspruch in sich das Bild der Sonnenfinsternis, bei der das Subjekt sich selbst verfinstert. Daß dies vorkommt, liegt für ihn in der Natur des Subjekts selbst. Dieses Vorkommenkönnen zu thematisieren, dies ist eben das Projekt des Romans, am Leitfaden des eigenen Leibes herauszufinden, daß das Subjekt sich selbst abhanden kommt, indem es dies selber tut, und wie es dies tut, und wie sich darüber nicht reden läßt. Die Erforschung dieses Vorgangs bei konsequentem Durchhalten der Subjekt-Perspektive deutet sich an bei Flaubert und Stendhal, und sie gipfelt in Kafkas „Prozeß“. Dieser Roman, der das ist, wohin der Roman von sich aus will, liefert die ausgearbeitete Theorie seiner selbst. Jede Interpretation dieses Romans muß diese Denkrichtung von Subjekt zu sich selbst und zur Welt beibehalten. Jede Anwendung einer Theorie auf diesen Roman von außen ist zum Scheitern verurteilt. Die Sprache des Subjekts ist notwendig fragmentarisch und rätselhaft. Die Versuche des Subjekts, sich auf das, was mit ihm geschieht, indem er es selber tut, einen Reim zu machen, bleiben notwendig erfolglos. Ihr Erfolg liegt in ihrer spezifischen Erfolglosigkeit. Das Sich-Orientieren-wollen-müssen führt zwangsläufig ins Labyrinth hinein. Die Selbstsuche führt in den Selbstverlust, und sie tut dies nicht, weil sich etwas in den Weg stellt oder die Intention schwächt, sondern weil der Weg, weil die Intention selbst in die Irre führen. Lacan spricht vom Sich-selbst-abhanden-Kommen des Subjekts als Fading. An demselben Projekt, in einer Parallelaktion, arbeiteten Canetti und Musil sowie Rousseau. Hilfe bei der Begriffsbildung leisten Deleuze und Foucault.
Samstag, 8. Januar 2011