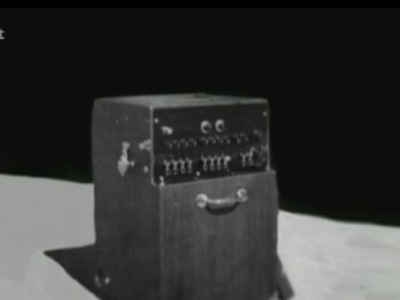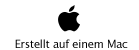unerklärlich
Der Krimi kennt den Topos eines Raumes, der plötzlich seine Unschuld verloren hat. Jemand kommt wie an jedem Abend nach der Arbeit nach Hause und, ohne daß er sagen könnte warum, kommt ihm seine Wohnung irgendwie verändert und fremd vor. Nichts als das unbestimmte Gefühl einer Veränderung. „Es ist so, als ob in einem vertrauten Bild ein kleiner Ausschnitt verschoben wäre und damit das ganze Bild rätselhaft und sonderbar.“ (Mignon G. Eberhart, Five Passengers from Lisbon. Zitiert nach Richard Alewyn, Probleme und Gestalten S. 379) Von einem solchen Augenblick an erscheinen auch die allergewöhnlichsten Vorkommnisse des Lebens aufgeladen mit Möglichkeiten, das Knarren der Treppe, das Klingeln des Telefons... ein Element tritt aus seiner Umgebung heraus und tritt in Beziehung zu anderen Dingen jenseits dieses Raumes, nimmt Bezug auf zu einer anderen Welt, einem anderen Zusammenhang. Ein ähnliches Gefühl überfällt einem manchmal auf einem Weg, den man tausend Mal gegangen ist, den man plötzlich dennoch nicht wiedererkennt. Auf einer Autobahn hat man plötzlich das Gefühl, auf der falschen Straße zu sein oder eine Ausfahrt oder Gabelung verpaßt zu haben. Alles sieht so aus, als sähe man es zum ersten Mal. Die Szene oder etwas in ihr wird zum Clue, zur Spur, zum Indiz. Der Clue ist ein Kryptogramm, etwas, das eine Frage provoziert und zugleich eine Antwort verbirgt. Normalerweise folgt man naturgemäß zunächst einer falschen Spur. Die Spur führt ins Labyrinth hinein anstatt heraus. Die ganze Welt ist in einen Ausnahmezustand versetzt. Das alles fremd machende Ereignis, so als wäre jemand aus dem Haus gegangen, um Zigaretten zu holen und nie wieder aufgetaucht, ist ein Angriff auf die Trivialität. Doch kann das Unmögliche nicht geschehen sein, da Unmögliches nicht geschieht. Also muß das Unmögliche möglich sein. Wenn etwas tatsächlich geschehen ist, gibt es auch eine Erklärung. Also muß es trivial sein. (vgl. Alewyn ebenda).
Ein Krankheitssymptom ist auch ein solcher Clue. Ich weiß davon, ohne zu wissen, was es bedeutet. Mein Körper weiß mehr als ich. Ich benötige jemand anderen, den Arzt, damit er mir sagt, was mein Körper schon weiß, weil der es mir nicht direkt sagen will oder kann. Im Krimi weiß die Welt mehr als der Detektiv und der Leser, und sie kann oder will es ihnen direkt nicht mitteilen. Ein psychopathologisches Phänomen, wie etwa unerträgliche Angstzustände, findet nicht sogleich eine triviale Erklärung. Man fühlt, die eigentliche Erklärung würde mit Trivialisierungen nur verdeckt und verraten werden. Der gute Detektiv muß einen Sinn oder einen Zugang zum Nichttrivialen haben. Die Romantiker nannten solche Menschen Künstler, weniger weil sie eine Kunst ausüben oder beherrschen, als vielmehr weil sie das Exzentrische sehen, die minimale Veränderung, weil Menschen dieses Schlages aus der Gesellschaft der normalen, gewöhnlichen Menschen ausgeschlossen sind, weil an ihnen etwas ist, das sie für das alltägliche Leben untauglich macht. Sie vermögen es, das Exzentrische wahrzunehmen, sollen aber in der Gesellschaft die Funktion erfüllen, das Unerklärliche ins Erklärliche, das Nicht-Triviale für uns ins Triviale zu überführen, da es das Unerklärliche nicht geben darf. Die soziale Rolle des Detektivs und die Prozedur der Rückgängigmachung des Unmöglichen verraten freilich, daß es sehr wohl existiert: als Unmögliches, Nicht-Triviales, Jenseitiges. Mit dem Krimi versucht die Gesellschaft oder Kultur zu beweisen, daß es das Nicht-Triviale nicht gibt, und jeder spielt wider besseres Wissen mit, ohne doch gänzlich beruhigt werden zu können.
Montag, 10. Oktober 2011