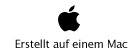Bilderverbot
Du sollst Dir kein Bildnis machen! Das Judentum kennt das Gebot, sich kein Bild von Gott machen. Nach Maimonides beraubt Menschenähnlichkeit Gott seiner Würde. Das geht soweit, daß auch kein Abbild vom Menschen mehr erlaubt ist. Man darf nicht einmal seinen Namen nennen. Man sagt stattdessen Pseudonamen. Beim Beten geht das freilich nicht, denn man darf nicht zu jedem Beliebigen beten. Mein Herr zu sagen, wäre zu allgemein. Da muß man schon Flagge bekennen. Ein Trick, das Gebot zu unterlaufen, ist die vokalfreie Schrift. Das Problem verschärft sich mit Jesus als Mensch gewordenem Gott, wenn Gott in der Gestalt eines Menschen auf die Erde kommt, der am Ende auch noch stirbt und in das Reich des Todes fährt, aus dem inzwischen die Hölle geworden ist. Die Rettung suchte man in der Idee, daß Gott überall sei, auch in der Hölle, also grenzenlos, aber auch da gibt es Zweifel, ob er doch nicht nur ohne Grenze ist, weshalb man diejenigen, die dieser Idee anhingen, lieber verbrannt hat. Das Gebot, sich kein Bild von Gott machen, führt in die Labyrinthe der Erkenntnistheorie, die theologische Reflexe haben oder theologisch vorgedacht wurden. Erkennen eröffnet mir Welt, hindert mich aber zugleich zu sehen. Welt ist immer Konstruktion, deren Konstruktcharakter im Ergebnis verschluckt ist. Der Mensch erschafft Gott nach seinem Bilde und kehrt diesen Schöpfungsakt im selben Moment um derart, daß Gott die Welt und den Menschen erschaffen hat, naturgemäß nach seinem Bilde. Das spontane Anthromorphisieren steht von Anfang an in Verbindung mit dem Bilderverbot.
Für Zizek ist das Bilderverbot Ausdruck des Problems, wie man jemandem Respekt erweist. Doch verhält es sich nicht so, wie Maimonides es sich dachte. Jemanden respektvoll behandeln, bedeutet, den angemessenen Abstand zu ihm zu wahren und Handlungen zu vermeiden, die seine Position als Hochstapelei entlarven würden. Wenn etwa ein Vater seinem Sohn gegenüber damit prahlt, wie schnell er laufen könne, besteht respektvolles Handeln darin, ihn nicht herauszufordern, dies unter Beweis zu stellen, da dies das Unvermögen des Vaters offenbaren könnte. Wohin das führen kann, sieht man in Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenen“. Zizek deutet den jüdischen Ikonoklasmus in diesem Sinne. Die Vorstellung, daß man Gott durch die Herstellung von Bildern den nötigen Respekt verweigere, ist zu einfach gedacht, da Respekt letztlich nicht Zurückscheuen vor Größe ist, sondern Respekt vor der Schwäche des anderen. Nicht weil ein Bild Gott humanisieren und damit klein machen würde, ist dies verboten, sondern weil es die spirituelle Wesenheit Gottes allzu getreu wiedergeben würde. Man möchte ihn Mensch sein lassen. Man möchte das Thema seiner möglichen Ohnmacht nicht anschneiden, seine Ohnmacht diskret dahingestellt sein lassen. Die Macht Gottes liegt in seiner Ohnmacht.
Entsprechend ist der wahre Sinn des Opfers der einer Geste, welche die Leugnung der Ohnmacht Gottes in Szene setzt. Zizek verlagert das religiöse Thema in den Bereich der Psychoanalyse und in den Sprachgebrauch Lacans, indem er Gott durch den Großen Anderen ersetzt. Das Subjekt bietet sein Opfer nicht deswegen an, um selbst davon zu profitieren, sondern um den Mangel im Anderen zu füllen, um den Schein der Allmacht, oder zumindest der Konsistenz des Anderen zu wahren. Zizeks Beispiel ist der Film „Beau Geste“ (Drei Fremdenlegionäre). Der älteste von 3 Brüdern (Gary Cooper), die bei ihrer gutherzigen Tante leben, stiehlt ihr das wertvolle Diamantenhalsband, der Stolz der Familie, und verschwindet damit. Er tut es, obwohl er weiß, daß damit sein Ruf ruiniert ist und er für immer als der undankbare Veruntreuer des Vermögens seiner Wohltäterin gelten wird. Am Ende des Films erfahren wir die Lösung: Er tat es, um der peinlichen Enthüllung vorzubeugen, daß das Halsband ein Imitat war. Im Gegensatz zu allen anderen wußte er, daß die Tante das Halsband vor einiger Zeit einem reichen Maharadscha verkaufen mußte, um die Familie vor dem Bankrott zu bewahren, und es durch eine wertlose Nachbildung ersetzt hatte. Er hatte erfahren, daß ein Onkel, der Mitbesitzer des Halsbands war, es aus finanziellen Interessen veräußern wollte. Dabei hätte man entdeckt, daß es sich um eine Attrappe handelte. Die einzige Möglichkeit, die Ehre der Tante und damit auch die der Familie zu retten, bestand darin, den Diebstahl zu inszenieren. Beim Stehlen wird die Tatsache verschleiert, daß es eigentlich nichts zu stehlen gibt. Auf diese Weise wird der konstitutive Mangel des Anderen verheimlicht. Man erhält die Illusion aufrecht, daß der Andere das, was ihm gestohlen wurde, einmal besaß. Das Opfer besteht hier darin, sich selbst zu opfern, die eigene Ehre und Zukunft in der ehrenwerten Gesellschaft, um den Schein der Ehre des Anderen zu wahren, um den geliebten Anderen vor der Schande zu bewahren, daß man ihn möglicherweise nie geliebt hat, und damit sich selbst vor der Einsicht, den Fehler des Lebens begangen zu haben und nicht autonom, nicht man selbst gewesen zu sein, sein eigens Ich in Frage zu stellen, was nicht möglich ist, sich in einen Ichzwang zu begeben, um ihm zu entkommen.
Es gibt keinen Großen Anderen. Dieser ist lediglich eine virtuelle Ordnung, eine gemeinsame Fiktion, wobei sie nur darum gemeinsam ist, weil man sie mit niemandem teilen kann. Wir müssen nicht an sie glauben, um sie für wahr zu halten, um uns durch eine symbolische Verpflichtung gebunden zu fühlen. Diese Verpflichtung hat aber jeder nur für sich, ohne sie jemandem mitteilen oder mit jemandem teilen zu können. Auch wenn wir nicht an Gott glauben, glauben wir dennoch an ihn. Dies ist wiederum zu generalisieren in der Weise, daß wir Dinge tun, die wir tun, obwohl wir wissen, daß sie uns schaden oder zu nichts oder gar ins Verderben und ins Abseits führen. Die Formel dieses hartnäckig und aggressiv geleugneten Phänomens ist: Ich weiß wohl, aber.
Sokrates steht für denjenigen, der sich ins Abseits bringt und nicht anders kann. Er war laut Heidegger der einzige, der das Fehlen des Großen Anderen aushielt und in dieser zugigen Lücke ausharrte, ohne sich wie alle anderen in den Windschatten zu flüchten, der als Platzhalter dieser Lücke agierte, der für seinen Gesprächspartner dieser Lücke Gestalt verlieh, bzw. ihre Stelle einnahm. Lacan bezeichnete in seinem Seminar über die Übertragung die Position des Sokrates als diejenige des Analytikers, der Position des Analytikers, der den Platz des Objekts a einnimmt, als den Platz des Mangels, der Inkonsistenz, der Abwesenheit, der Kleinheit, der obszönen Mickrigkeit des Großen Anderen.
Isabel Archer in Henry James „Portrait of a Lady“ – ein weiteres Veranschaulichungsbeispiel von Zizek - verläßt Osmond nicht, obwohl sie ihn definitiv nicht liebt und sich seiner Machenschaften vollauf bewußt ist. Sie bleibt, weil sie an dem einmal gegebenen Wort festhält, weil sie nicht bereit ist, eine Entscheidung zu revidieren, die sie aus ihrem Sinn für Unabhängigkeit heraus getroffen hat. Osmond zu verlassen, hätte bedeutet, sich selbst ihrer Autonomie zu berauben. (Siehe: Der Verlassende) Menschen opfern sich normalerweise für eine Sache. Sie sind aber auch fähig, sich für nichts zu opfern, wie Sygne. Sygne ist auch Geisel des Worts. (Vgl. Zizek, Die gnadenlose Liebe)
Samstag, 1. Oktober 2011