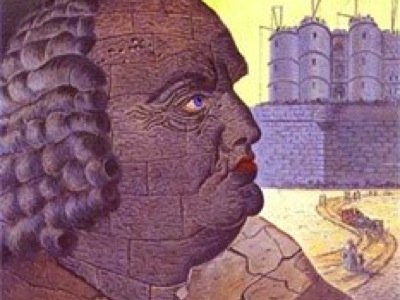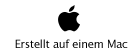Depression
Mit Emil Durkheims Begriff des fait social ist der soziale Konstruktionscharakter einer Krankheit bezeichnet. Krankheiten sagen demnach weniger darüber aus, worunter eine gewisse Anzahl von Individuen leidet, als vielmehr darüber, wie eine Gesellschaft Normalität definiert und wie sie sich gegen die Anormalen selbst schützen zu müssen glaubt. Depression wird heute synonym gebraucht für seelisches Leiden, psychischen Defekt oder psychische Krise überhaupt. Begriff und Phänomen haben die gleiche Bedeutung, wie sie hundert Jahre zuvor die Hysterie besaß. Die Depression hat die Hysterie als politisch korrekte Störung abgelöst. “Die Depressiven scheinen von einem Leiden befallen zu sein, das ebenso wenig greifbar ist wie ein Jahrhundert zuvor die Hysterie”.
Die Depression mußte erfunden werden, um das Interpersonal enactment als dominanten Modus der Vergesellschaftung zu etablieren. Die Konstruktion der Depression ist heute die einzige erlaubte, politisch korrekte Krise oder Seelenkrankheit. Trotz ihrer allgemeinen Anerkennung oder gerade deswegen ist der Depressive Gegenstand von Spott und Verachtung und Anlaß zur Selbstüberhebung der anderen. Der vom Common-sense gedeckte Standardspruch lautet: Ich könnte mir gar keine Depression leisten. In der Diskriminierung des Einzelnen kommt der dialogische Charakter dessen ans Licht, was mit Depression auf eine Weise benannt wird, die den Sachverhalt unsichtbar macht. Dieses Konstrukt erlaubt, den Umgang mit psychischen Krisen zum Exklusionsinstrument zu machen. Die scheinbare Lösung ist selbst das Problem.
Die Definition und die Merkmale der Depression und die Fraglosigkeit dieser sich eindeutig gebenden Charakterisierung von in Wahrheit breit gestreuten und schillernden Phänomenen verdanken sich nicht der geduldigen Diagnosearbeit, sondern der überraschenden Wirkung eines Medikaments. Daß heute jeder zu wissen glaubt, was der Begriff Depression bedeutet. verdanken wir einem „außerordentlich berühmten Medikament: Prozac.” Man fand heraus, daß durch Verabreichung dieses Medikaments bestimmte Symptome psychischen Unwohlseins in siginifikant vielen Fällen gemindert werden zugunsten einer Gemütsaufhellung. Daß sich später herausstellte, daß in vielen Fällen derselbe Effekt durch Placebos erzielt werden konnte, vermochte den Ruf jenes Medikaments nicht mehr zu beeinträchtigen. Es genießt bis heute ein unvergleichliches Renommee. Das unübersichtliche Set an Symptomen führte allein wegen des Anscheins der Behandelbarkeit durch Prozac zu dem Krankheitsbild der Depression. So, als wenn man sagen würde: Wenn ich Wasser mit einem Lappen aufwischen kann, dann ist Wasser im Wesen etwas, das mit dem Lappen aufwischbar ist, so gilt: Depression besteht in der anscheinenden Minderbarkeit der fraglichen Beschwerden durch Prozac. Die zahlreichen und heterogenen Merkmale des jeweiligen Krankheitsbefundes, von denen jedes einzelne eine eigenes Krankheitsbild hätte genieren können und die von Individuum zu Individuum stark differieren, sind auf eine den Störungen selbst äußerlich bleibende Weise kombiniert und normiert worden.
Nun könnte man einwenden, daß es ja das subjektive Empfinden der Depression gibt. Millionen von Depressiven können nicht irren. Dabei würde man aber verkennen, daß die Betroffenen ja auf eine Definition ihrer Störung angewiesen sind und den aufgesuchten Helfern die Kompetenz übertragen, dazu in der Lage zu sein. Daß sie nicht anders können, als die Zuschreibung zu akzeptieren, schließt nicht aus, daß man die zu einem Komplex zusammengefaßten einzelnen Symptome auch separat hätte betrachten und mit anderen hätte zusammenfassen und ganz anders hätte benennen können. Das Empfinden selbst ist nicht angeleitet durch Wissen über die einzelnen Symptome und ihre möglichen Ursachen, sondern bestimmt von der unvermeidbaren Erwartung des Betroffenen, vom Arzt gesagt zu bekommen, was mit ihm ist.
Die Behandelbarkeit oder die Illusion der Behandelbarkeit von etwas, das wir nicht genau kennen, wird in einem nicht reflektierten Schritt zur Feststellung, daß es eine Krankheit gibt, die zunächst nur als hypothetische “durch Prozac wahrscheinlich behandelbar” heißen dürfte und die Erforschung ihrer Natur allererst initiieren müßte. Der vermeintliche Erfolg eines Medikaments bemißt sich nicht an den Heilungserfolgen bei der Therapie einer bestimmten zweifelsfrei diagnostizierten Krankheit, sondern hat zur Erfindung eines Krankheitsbildes geführt, nämlich der Krankheit, die durch Prozac linderbar sei.
Die Erfindung der Depression bewirkte, daß aus einer körperlichen Begleiterscheinungen unterschiedlicher Beschwerden und Phänomene wie Angst, Unruhe, Irritation eine Krankheit werden konnte. Zugleich wird psychische Krankheit zu etwas, das in der Herabsetzung der Funktionstüchtigkeit und Arbeitsfähigkeit besteht und unter dem Aspekt der Verkürzung der Ausfallszeit gesehen werden müsse. Prozac hat nicht nur zur Definition eines künstlichen Krankheitsbildes geführt, es hat auch eine bestimmte Weise, mit einer Krise umzugehen und darauf zu reagieren, etabliert und stabilisiert, die wiederum in einem größeren soziologischen und ideologisch-epistemologischen Kontext steht.
Die Pharmaindustrie habe das Denken der Menschheit gravierender verändert als jede wissenschaftliche Erkenntnis, einschließlich der Hirnforschung, behauptet John Virapen (Nebenwirkung Tod. Korruption in der Pharma-Industrie, neuer Europa Vlg Leipzig 08) Daß das Konsumverhalten manipuliert werde, sei nichts neues, heikel werde es jedoch, wenn die Manipulationen, aufbauend auf Ängsten und Sorgen, auf Stimmungen und Verstimmungen, einem pharmazeutischen Mittel den Boden bereitet, das seinerseits zur Behandlung ebendieser Ängste und Verstimmungen eingesetzt wird. Er bezeichnet den Geschäftserfolg mit Prozac ein wohlkalkuliertes spiel mit der Angst um die Gesundheit. Die Pharma-Industrie entwickelt und produziert nicht nur ein neues Mittel, sondern einen ganzen Markt, der das Gefühl vermittelt bekommt, krank und behandlungsbedürftig zu sein. Disease mongering nennt man inzwischen das Erfinden einer Krankheit durch Erweiterung der Krankheitskriterien. Bereits 1994 war Elisabeth Wurtzels Autobiographie mit dem Titel „The Prozac Nation“ erschienen, die primär ein Erfahrungsbericht einer Depressionskarriere und des Prozac-Konsums ist. Das Buch ist bis heute unübersetzt. Die Natur des fraglichen Leidens wäre duch Ursachenforschung und solche Untersuchungen zu ergründen, die die subjektive Perspektive der Betroffenen einbezieht und dabei die subjektive Seite nicht auf die Angst davor beschränkt, den Job zu verlieren, und die Sorge, möglichst schnell wieder zu funktionieren, um so verinnerlichten Erwartungen der Gemeinschaft gerecht zu werden. Die Erfindung der Depression macht es möglich, diesen Aspekt als den alleinigen anzusehen, als gäbe es keine andere Sichtweise. Ebendazu trägt das zum Blockbuster avancierten Antidepressivum bei, das nicht nur vergleichbare Arzneien aus den Regalen verdrängt, sondern auch alternative Behandlungsmethoden derart massiv verdrängt und in Frage stellt, daß jeder Betroffene überzeugt ist, allein dieses Mittel sei zur Linderung der Leiden tauglich.
Wegen des Leidensdrucks muß jeder Betroffene ein Interesse daran haben, daß ihm geholfen wird, daß er sich besser fühlt, und zwar so schnell wie möglich, da der Zustand unerträglich ist. Wer nun eine andere Sichtweise geltend macht, der setzt sich dem Verdacht aus, die Krankheit bagatellisieren zu wollen und sich nur an die zu richten, denen es nicht so schlecht gehen kann, wenn sich derartige kulturkritischen Spirenzchen leisten können. Wer sich intellektuell mit seinem Problem beschäftigen kann, der hat keines, das ihn zum Krankfeiern berechtigt. Tatsächlich jedoch wird die Krankheit dann bagatellisiert, wenn sie nur unter dem Aspekt der Linderbarkeit und der Leistungsminderung betrachtet wird. Eine Symptomatik, welche die Scheindiagnose Depression nach sich zieht, ist Zeugnis einer Krise, die, als Funktions-Störung betrachtet, unterschätzt wird und auf diese Weise nicht wirklich gelindert und schon gar nicht geheilt werden kann, da sowohl die Erkrankung in ihrem dialogischen Charakter, als auch der dialogische Charakter des Heilungsprozesses verkannt wird.
In dem vor einigen Jahren erschienenen und von der Fachwelt einhellig blind gerühmten und hir mehrfach zitierten Buch von Alain Ehrenberg mit dem Titel “Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart”, mit einem Vorwort von Axel Honneth, wird freimütig eingeräumt, daß das, was wir unter Depression verstehen, davon bestimmt sei, daß ein versuchsweise eingesetztes Medikament anscheinend Erfolge zeitigte bei der Stimmungs-Aufhellung der Patienten. Depression ist per definitionem das, was jenes Medikament minderte. Die Depression genannte Krankheit wird als das Produkt einer Zuschreibung bezeichnet. Der Erfolg des Heilmittels definiert die Krankheit. Dann jedoch wird über diesen bizarren Umstand hinweggegangen, wie man zuweilen von einer Unterstellung nahtlos dazu übergeht, eine Anklage für bewiesen zu halten. Aus der Depression ist dann von einem Satz auf den nächsten eine Krankheit geworden, die fraglos tatsächlich existiert, da ja zahllose Menschen unter diesem Zustand leiden. Depression gilt nun als der Name einer Krankheit, die an unterschiedlichen Symptomen erkennbar sei, von deren Charakter und Art des Zusammenwirkens man nichts weiß, aber nun auch nichts mehr zu wissen braucht. Wozu soll ich wissen wollen, was diffuse Angstzustände, Antriebslosigkeit, vermindertes Selbstwertgefühl, Selbstzweifel, Melancholie verursacht hat, wenn sie doch dank der Einnahme eines Medikaments einer positiven Stimmung gewichen sind.
Genau betrachtet wird allerdings lediglich ein diffuses, nagendes Gefühl der Wertlosigkeit und Lebensunfähigkeit gedämpft und mag so bewirken, daß suizidale Neigungen eingeschläfert werden und so die Auslöser der Krise und die möglichen Ursachen verschleiert werden, da sie ihre Dringlichkeit verlieren, die in ihrer Unbegreifbarkeit liegt. Man interessiert sich vorerst wieder weniger dafür. Wenn zusätzliche Endorphyne dem Organismus zugeführt werden, erreicht man eine gewisse Aufhellung, die aber jeder nachhaltigen Grundlage entbehrt und bei Absetzen denn auch zu umso heftigeren Rückfällen führen kann. Die Neigung zum Suizid ist bei Konsumenten von Antidepressiva extrem hoch. Gleichwohl steigt die Zahl derer, die jenes Medikament einnehmen, beständig. Verordnungen von SSRI Antidepressiva stiegen in Deutschland zwischen 1997 und 2006 um fast 700%. Es scheint also so zu sein, daß die Verbreitung der Depression dramatisch zunimmt. Dieser Anschein wird nicht in Frage gestellt.
Mit der Zusammenfassung eines umfangreichen Symptomsets zu einer einzigen griffigen, lesbaren Krankheit und mit der Suggestion einer einfach handbaren Therapie wird einer vorgefaßten Meinung entsprochen. “Damit ein Medikament so gut den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen kann, mußte die Depression einen zentralen Ort in unserer Gesellschaft erringen”, heißt es hellsichtig in dem genannten Buch. Der Autor fällt dann jedoch hinter sein Reflexionsniveau zurück, wenn im nächsten Schritt gefragt wird nach einer sozialen Entwicklung, die als gesellschaftliche Grundlage dafür angesehen werden könne, daß diese Krankheit in der Gegenwart so häufig anzutreffen ist, weshalb ihr massenhaftes Auftreten also nicht verwunderlich sei. Als Ursache wird der Umstand ausgemacht, daß “das disziplinarische Modell der Verhaltenssteuerung, das autoritär und verbietend den sozialen Klassen und den beiden Geschlechtern ihre Rollen zuwies, zugunsten einer Norm aufgegeben wird, die jeden zu persönlicher Initiative auffordert, ihn dazu verpflichtet, er selbst zu werden.”
in diese Kerbe schlägt auch der Herausgeber. Die Gesellschaft, so wird von beiden Autoren konstatiert, räume den Individuen heute mehr Freiheiten ein als früher, und seltsamerweise sind viele Individuen nicht in der Lage, diese Angebote zu nutzen. Der Krankheitsgewinn dieser Diagnose für die Anderen: Man kann nun die Kranken so hinstellen, daß sie daran selber Schuld tragen. Das Buch soll nun “zeigen, daß die Depression die genaue Umkehrung dieser Konstellation ist. Sie ist eine Krankheit der Verantwortlichkeit, in der ein Gefühl der Minderwertigkeit vorherrscht. Der Depressive ist nicht voll auf der Höhe, er ist erschöpft von der Anstrengung, er selbst werden zu müssen.” Jetzt ist es raus: Die vermeintlich durch jene Krankheit Benachteiligten strengen sich nicht genügend an, sie lassen sich gehen. Endlich könnten sie, wie sie wollen, wenn sie nur wollten, aber sie wollen ja nicht. Man bietet ihnen Freiheit, aber sie wollen nicht frei sein. Sie sehnen sich nach den alten autoritären Zeiten zurück, in denen ihnen gesagt wurde, was sie zu tun haben und wo es langgeht, mit Prügel und Knute, mit Zucht und Ordnung. Das war ihnen lieber. Und es wäre am besten, wenn man sie dahin zurück brächte. Aber das geht ja leider nicht. Darunter leiden sie, daß das nicht geht.
Wir Soziologen und Psychologen jedoch, wir Nicht-Depressiven, die diese Analyse wagen und uns über die Benachteiligten Gedanken machen, wir genügen dem modernen politischen “Ideal, das aus dem gefügigen Untertan des Fürsten einen autonomen Bürger gemacht hat”. “Das souveräne Individuum, das nur sich selbst gleich ist”. Freilich wird uns nichts geschenkt. Man muß sich schon ein bißchen anstrengen. An denen, die dabei depressiv werden, kann man ablesen, wie toll, wie heroisch wir sind, die dabei nicht depressiv werden. Wir haben es ja nicht leichter, wir machen es uns sogar schwerer. Aber wir stellen uns nicht so jämmerlich an. Diese Attitüde wird auch gern von Politikern angenommen, stereotyp vor allem in öffentlichen Auftritten in Talk-Shows oder Interviews.
So möchten sich diejenigen gern sehen, die zufällig auf der richtigen Seite standen, als der Strich gezogen wurde zwischen uns und denen, drinnen und draußen. Es soll so aussehen, daß Normalität und Gesundheit einem heute nicht mehr geschenkt werden, sondern besonderer Kraft und Anstrengung bedürfen, die offenbar nicht jeder aufbringen mag, weil das mit Entbehrungen, Verzicht, Askese, Disziplin, Investitionen verbunden ist. Wer so viel Energie und Disziplin nicht aufzubringen bereit ist, der lebt lieber von der Hand in den Mund und frönt lieber dem Lustprinzip als dem Realitätsprinzip. Es ist mit der Gesundheit genau wie mit der Wirtschaft und dem Geldverdienen. Wer will, der hat auch Arbeit und der hat auch sein Auskommen. Die Depression ist also die “Krankheit” der “Sozialschmarotzer”. Sie ist das Erkennungszeichen derer, die nicht wollen.
Da es trotz der in dem All-inclusive-Modell der modernen Demokratie verankerten Chance für alle einen gewissen Prozentsatz von Ausgeschlossenen und Verlierern dennoch gibt, den es nicht geben dürfte, müssen wir unterstellen, daß alle diejenigen, die es nicht schaffen, es gar nicht schaffen wollen. Und weil wir glauben sollen, daß, wer nur will, auch kann, und daß alle diejenigen, die nicht zu können meinen, deshalb nicht können, weil sie nicht wollen, darum mußte neben manchen anderen Strategien die Krankheit mit dem Namen Depression erfunden werden. Deshalb kam diese Erfindung gerade recht, wir hatten sie bereits erwartet.
Alle diejenigen, die depressiv werden, müssen als solche erscheinen, die zu schwach sind, um frei zu sein. Die Freiheit macht sie müde, sie erschöpft sie. Sie haben ein erschöpftes Selbst. “Die Person wird nicht länger durch eine äußere Ordnung (oder die Konformität mit einem Gesetz) bewegt, sie muß sich auf ihre inneren Antriebe stützen, auf ihre geistigen Fähigkeiten zurückgreifen.” Und eben das schaffen die in die Freiheit Entlassenen nicht. Die Depression “ist die Krankheit einer Gesellschaft, deren Verhaltensnorm nicht mehr auf Schuld und Disziplin gründet, sondern auf Verantwortung und Initiative. Gestern verlangten die sozialen Regeln Konformismen im Denken, wenn nicht Automatismen im Verhalten; heute fordern sie Initiative und mentale Fähigkeiten. Die Depression ist eher eine Krankheit der Unzulänglichkeit als ein schuldhaftes Fehlverhalten, sie gehört mehr ins Reich der Dysfunktion als in das des Gesetzes”. Weiter unten wird die D. als “die Geschichte eines unauffindbaren Subjekts” bezeichnet. Die Depression ist die Krankheit derer, die den Sprung vom abhängigen Arbeiter oder Angestellten zum Aktionär nicht geschafft haben und nun in dem Prozeß der Aktieneigentümer gegen die Lohnabhängigen auf der falschen Seite stehen, weil sie es nicht anders gewollt haben.
“Die Depression ist die Krankheit des Individuums, das sich scheinbar von den Verboten emanzipiert hat, das aber durch die Spannung zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen zerrissen wird. Wenn die Neurose das Drama der Schuld ist, so ist die Depression die Tragödie der Unzulänglichkeit. Sie ist der vertraute Schatten des führungslosen Menschen, der des Projekts, er selbst zu werden, müde ist und der versucht ist, sich bis zum Zwanghaften Produkten oder Verhaltensweisen zu unterwerfen.” Die Depression ist das Verzagen angesichts des Preises der inneren Unsicherheit, den das Individuum für seine “Befreiung” zu zahlen hat, und die es krank macht, sofern es nicht bereit und in der Lage ist, sich mit dieser Unsicherheit zu behaupten.
In diese Konstruktion einer notwendigen Krankheit gehen die zentralen Gemeinplätze unseres Gemeinwesens, die Kernsätze des Common-sense ein. Wir, die wir uns zusammenreißen, wir sind diejenigen, die gefährdet sind, und mit uns sollte man Mitleid haben, aber wir trotzen dieser Krankheit. Wir sind nicht nicht depressiv, weil wir nicht depressiv werden können, weil wir uns erfolgreich gegen diese Gefahr behaupten, indem wir uns diese Schwäche nicht leisten. Wir haben gar keine Zeit, depressiv zu werden. Wir, die wir die Konditionen der modernen Welt heroisch aushalten, müßten eigentlich diejenigen sein, die depressiv sind; wir sind es, die ein Recht hätten, depressiv zu sein. Die anderen aber, die über Depression klagen, sind nur weinerlich, sie simulieren nur und glauben an ihr eigenes Theater. Diejenigen, die diese Krankheit haben dürften, haben sie nicht, weil sie sich ja zusammenreißen, und, weil sie viel zuviel zu tun haben, sich eine Krankheit gar nicht leisten könnten, selbst wenn sie wollten. Wer arbeitet, wird nicht krank. Statt die Depressiven krankzuschreiben, sollte man sie anhalten, mehr zu arbeiten, dann hätten sie nicht solche Flausen im Kopf. Mit Zwang, denn das wollen sie ja. Unter Zwang fühlen sie sich wohl. Ihre Krankheit ist der Hunger nach Zwang. Sie wären uns dankbar dafür. Depression ist die folgerichtige Krankheit derer, denen man zu Unrecht und voreilig Freiheiten eingeräumt und Selbstbestimmungs-Rechte zuerkannt hat.
Diese Einstellung begleitet das offizielle Interesse an Psychopathologie von Anbeginn. Foucault hat das passende Dokument gefunden: “Eine solche Person, die zur Arbeit gezwungen werden muß, ist in einen Verschlag zu sperren, der von Kanälen derart unter Wasser gesetzt wird, daß sie darin ertrinkt, wenn sie nicht ständig die Pumpe bedient. Die Wassermenge und Übungsstunden richten sich danach, wie die Person in den ersten Tagen bei Kräften ist; aber beide werden stufenweise erhöht. … es ist ganz natürlich, daß sie es bald leid sind, ständig die Pumpe bedienen zu müssen, und allein solch mühevoller Arbeit nachzugehen, aber da sie wissen, daß sie auf dem Felde der Anstalt die Erde in Gemeinschaft mit den anderen umgraben könnten, haben sie bald den Wunsch, wie die anderen arbeiten zu dürfen. Das ist eine Gnade, die ihnen früher oder später zuteil wird…” (Histoire de la Folie)
„Portrait imaginaire de Sade“ von Man Ray 1938
Freitag, 21. Oktober 2011