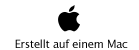Rezension zum Ichzwang
Wenn‘s keiner macht, mach ich‘s halt selber: Im Zentrum der Beobachtungen und Überlegungen, die der Autor hier ausbreitet, zu denen die Kritik am Optimierungswahn und den Boom der Coaching- und Lebenskunst-Literatur zählt, die Kritik am Wahn der Erfolgreichen und Reichen, ihren Erfolg oder ihr Vermögen verdient zu haben, sowie eine Charakterisierung dessen, was das negative Heldentum des Film-noir ausmacht, steht die Suche nach der wahren Natur des Ich, jenseits des für die Sache selbst gehaltenen Konstrukts, mit dem Psychologie und Psychotherapie arbeiten und das zum Fundament der bürgerlichen Gesellschaft und all ihrer Institutionen und Selbstgewißheiten geworden ist. Es geht der Gesellschaft dabei wie dem Irren in dem dem bekannten Witz, der seinen verlorenen Schlüssel unter einer Straßenlaterne sucht, statt in der dunklen Ecke, wo er ihn tatsächlich verloren hat. Hier werden freilich Konturen eines Ich sichtbar, das so gar nicht dem Idealbild entspricht, das wir uns von ihm machen. Es präsentiert sich als Kippfigur, als etwas, das vom Inbegriff der Souveränität sich unvermittelt in etwas verwandeln kann, das dem Träger in den Rücken fällt und hinter dessen Rücken an dessen Untergang arbeitet.
Daß wir uns über die Natur des Ich überhaupt täuschen können, das liegt an der Unhintergehbarkeit des Ich, als der sich selbst transparente Teil der Seele, der sich für die Seele insgesamt hält. Wir können uns nicht ausstreichen und sind dazu verdammt, unsere Selbstachtung auch gegen objektive Ohnmacht durchzuhalten, und sei es auf eigene Kosten und auf Kosten der Realität.
Das in einem letzten Not-Modus der Psyche zutagetretende Wesen des Ich nennt Confurius Ichzwang. Aufgrund ebendieses Ichzwangs ist man nie nur Täter oder nur Opfer, sondern stets beides zugleich. Als Opfer ist man zugleich Täter und umgekehrt. Und die anderen, die Mit- und Nebenmenschen sind in diese Täterschaft verwickelt, wie das die merkwürdige Formulierung Artauds über van Gogh als „Selbstmörder durch die Gesellschaft“ illustriert.
Der Autor macht auf die aufwendig verdeckte Sonderbarkeit aufmerksam, daß alle als abweichendes oder pathologisches Verhalten registrierten Phänomene als Schwächung des Ich gewertet werden. Wann immer von „Psychopathen“ oder „Anormalen“ die Rede ist, wimmelt es von selbstunsicheren, fanatischen, stimmungslabilen, explosiven, gemütlosen oder ähnlichen schwachen und verdächtigen Charakteren. (Am Fall Kachelmann, der in dem Buch noch nicht berücksichtigt werden konnte, konnte man den Amoklauf der Normalität und das Reflexsyndrom der Gesellschaft in den Medien kürzlich gut verfolgen). Das Buch handelt von dem Machtverhältnis, das sich im therapeutischen oder analytischen Dialog konstituiert, und davon, was aus der umgangssprachlichen, ideologiegetränkten Sphäre des Alltags unreflektiert in die Bedeutungsebene analytischer Begriffe und Theoriekonzepte der Psychotherapie eingeflossen ist.
Wenn allzu gern und systematisch dem anderen Schwäche unterstellt wird, dann fragt man sich, wer profitiert davon? Die Therapeuten von ihren Patienten, die Eltern von den Kindern, die Lehrer von den Schülern, die Verlassenden von den Klammernden, die Kuratoren von den Künstlern und Kunstbeflissenen, die Zauberer von den Sich-Bezaubern-Lassenden. Die Welt zerfällt in ungleiche Paare und asymmetrische Interaktions-Konstellationen. Sie wären als der eigentliche Gegenstand von Psychologie anzuerkennen. Das abgegrenzte autonome Individuum dagegen erweist sich als Fiktion, als eine allerdings, die überaus mächtig ist und auf welcher der gesamte Überbau der Gesellschaft aufruht. Der Autor legt den Gedanken nahe, daß der Generalverdacht der Charakterschwäche, jenes verbreitete Profitieren von der dem anderen unterstellten Willensschwäche, dieser entsolidarisierende, füreinander blind machende Reflex paradoxerweise das sei, was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Der Ichzwang scheut nicht die Nähe der Marschen Begriffe Konkurrenz und Antagonismus und macht kein Hehl aus der Sympathie zu der Terminologie der Anti-Psychiatrie-Bewegung, vor allem zu dem Mechanismus, den Laing „interpersonal enactment“ nannte, und der Chicago-Schule der amerikanischen Soziologie, etwa der von Irving Goffman, der sein Betätigungsfeld da suchte, „where the action is“.
Daß diese unterschwellige Bedeutungsschwängerung der analytischen Instrumente weder im Konzept der Gegenübertragung noch auf metatheoretischer Ebene reflektierbar ist, legt den Gedanken nahe, daß sie eine gesellschaftliche Funktion erfüllen muß. Welche Funktion das sein könnte und welchen Preis die Menschen hierfür zahlen müssen, das wäre zu fragen. Der Autor vermutet, daß die entscheidende epistemische Weiche, die für diese Entwicklung historisch gestellt werden mußte, die Erfindung des Individuums ist, das ein allgemeines Verständnis für das Dialogische aller psychosozialen Prozesse und Phänomene verdrängt und verkümmern lassen hat. Einzig in der belletristischen Literatur habe sich ein Rest dessen erhalten, was in früheren Zeiten in den Narrativen der Mythen und Märchen kodiert war.
Wenn von Ich-Schwäche die Rede ist, als Einschränkung der Synthetisierungsfähigkeit, dann ist auch immer Charakterschwäche mitgemeint. Dies ist nur möglich geworden durch die Erfindung des Individuums als Einheit aller alltagsweltlichen wie der wissenschaftlichen analytischen Konzepte. Dabei wird grundsätzlich nicht unterschieden zwischen dem Individuum im philosophischen Sinne der bedingungslosen Behauptung der abstrakten absoluten Negativität, wie es bei Hegel heißt, und dem bei Hobbes durchschimmernden Aggregatzustand des Menschen, in dem er am leichtesten zu bescheißen ist und zu beherrschen ist. Man glaubt, mit dem Negieren des bescheißungsfähigen Einzelnen sei auch die Freiheit des Menschen überhaupt bedroht. Um der Arbeitsweise der Psyche in allen Übertragungssituationen Rechnung zu tragen, muß man die Grenzen des Individuums verlassen und in interaktiven Konstellationen denken, die in der etablierten Psychotherapie nur als dyadische Verhältnisse in früher Kindheit oder in pathologischen Regressions-Phänomen vorkommen. Wenn dort von primitiven oder archaischen Abwehrstrukturen die Rede ist, dann wäre die Blickrichtung umzukehren, um die Rationalität der diskriminierten Regressionsphänomene als das eigentlich Rationale und die vermeintlich rationalen zivilisierten Abwehrstrukturen als Fiktion und Idealisierung und Deformation zu erkennen.
Zum einen gehen alle Verengungen pathologischen Bewußtseins nicht auf das Versagen eines anthropologisch verankerten Inventars natürlicher Verhaltensnormen zurück, sondern auf die Art und Weise, wie die jeweilige Persönlichkeit ihre Erfahrungen mit sich und der Welt zu ordnen versucht. Die Persönlichkeit ist das Element, in dem sich die Krankheit entwickelt. So tiefgreifend der Zerfall auch sein mag, so kann doch die Persönlichkeit niemals verschwinden. Der Patient mag noch so krank sein, dieser Kohärenzpunkt bleibt unfehlbar vorhanden. An diesem Punkt zeigt sich die innere Inkonsistenz der etablierten Denkmuster: Entweder wird der Kranke als ein an den Randlagen der Normalität angesiedeltes Subjekt, also als grundsätzlich eigenverantwortliche Person betrachtet, wobei er dann jedoch nicht eigentlich krank ist, sondern allenfalls kriminell oder juristisch abnorm, oder er wird tatsächlich für psychisch krank erklärt, um damit zugleich den Status der Persönlichkeit einzubüßen und nur noch als seelenloser Körper und Objekt wissenschaftlich zugerüsteten Zugriffs zu fungieren.
In Mythen und Märchen und im antiken Drama müsse sich, so des Autors Vermutung, der Punkt ausmachen lassen, an dem kollektive Denkformen in individualistische Formen umkippen und die dialogische Natur der menschlichen Existenz in Vergessenheit gerät, wobei der Sinn für die Bedeutung der Katharsis wie auch der das Arzt-Patient-Verhältnis bestimmenden Symptomsprache verloren zu gehen beginnt. Die Figur der Antigone könnte diesen kritischen Punkt markieren.
Wertvolle Bundesgenossen bei der Erforschung des Unbewußten seien aber die Dichter, hatte Sigmund Freud betont. Dieser Empfehlung ist aber keiner der Psychotherapie-Theoretiker gefolgt. In einer Art von Nachsitzen bietet Confurius einige Parallelen zu seiner Konzeption des Ichzwangs bei Texten ausgesuchter literarischer Autoren wie Dostojewskij oder Joseph Conrad und Franz Kafka. Namentlich Rousseau wäre als der Autor zu entdecken, der dem Ichzwang die genuine literarische Form gegeben hat.
Der Terminus Ichzwang scheint eine originäre Erfindung zu sein. Eine Parallele könnte man suchen wollen in Zizeks Rede vom Über-Ich-Zwang oder in der vom Selbstzwang, doch führen solche scheinbaren Übereinstimmungen in die Irre. Eine Nähe ließe sich eher konstatieren zu Deleuzes Wunschmaschinen. Denkbar, daß eine Verwandschaft besteht mit Freuds Todestrieb, ja daß das, was Freud Todestrieb nennt, als Ichzwang womöglich besser beschrieben wäre. Es ist ein häretisches Buch. Bislang hat sich kein Rezensent dazu geäußert, und ich könnte mir vorstellen, daß sich niemals einer äußern wird. Es ist ein verdammtes Buch, mehr verheimlicht als veröffentlicht. Man hält alles für einen Schmarrn, will sich aber nicht blamieren, oder man bringt nicht genügend Kenntnisse mit und ist „noch dabei, es zu lesen“. Immerhin greift der Autor Thesen so unterschiedlicher Leute auf wie Irving Goffman, Harold Garfinkel, Ronald Laing, Michel Foucault, Jean Paul Sartre, Sigmund Freud, Donald Winnicott, Jacques Lacan, Judith Butler, die zudem nicht gerade leichte und nicht unumstrittene Lektüre sind, und die zueinander ins Verhältnis zu setzen das freihändige Navigieren auf einer Reflexionsebene erfordert, auf der sie einander begegnen können. Auf literarischer Ebene geht es um schwerste Kaliber der Geschichte. Gleich zu Anfang werden Elias Canetti und Stanley Kubrick miteinander ins Gespräch gebracht. Wenn das Ich seiner Maskeraden entkleidet wird, kommt etwas zum Vorschein, das schwer zu denken ist, auch weil die Sprache sich dagegen sträubt, es zu benennen. Dem trägt dieses Buch Rechnung, ohne dadurch an Lesbarkeit zu verlieren.
Donnerstag, 27. Oktober 2011