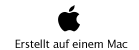Scheitern
Kann man dem Scheitern einen Platz in der Gesellschaft zuweisen, zu einer Zeit, da die Politik die Leistungsgesellschaft propagiert? Kann es fürs Scheitern gute Gründe geben?
Manfred Modaschl (Prof. für Innovationsforschung in Chemnitz) schlägt vor, eine wissenschaft des Scheiterns zu etablieren. Es gibt bislang keine Theorie des Scheiterns. Theorien selbst wissen nicht von der Möglichkeit des Scheiterns. Sie sind entweder noch nicht erfolgreich oder werden darwinistisch durch andere abgelöst. Wer entscheidet über Erfolg und Scheitern? Organisationen, das Gefühl, der Common-sense, die Realität? Man müsse zwischen Mißerfolg und Scheitern unterscheiden: Mißerfolg zwingt dazu, Mittel und Strategien zu überprüfen, Scheitern dagegen negiert Ziele und führt in die Therapie. Psychotherapie sei Arbeit am Scheitern“. Aber auch eine Therapie kann scheitern. (über eine soziologische Tagung über das Scheitern an der Uni Hannover FAZ 21.9.11) Es ist die Frage, was vor dem Regime der Leistungsgesellschaft das Scheitern als Normalität einräumte. Vor nicht zu langer Zeit war der Kommunismus eine Möglichkeit, das Scheitern in eine Voraussetzung für Fortschritt zu deuten. In Fortführung eschatologischer Modelle gab es die Perspektive: die Letzten werden die Ersten sein. In der Antike war der Mythos die Erzählung des Scheiternkönnens, auch wenn es so aussieht, als erzählten sie von Heldentaten. „Wir meinen, den Errungenschaften der Griechen zu folgen und sie darin noch zu überbieten, und übersehen dabei, daß der humane Luxus der Griechen womöglich gerade in der Begrenztheit der eigenen Einflußnahme bestand, in dem überaus kostbaren Besitz von Symbolisierungen des Unberechenbaren und Unkontrollierbaren im Menschen und in der Natur, in den Artefakten und Institutionen.“ (Ichzwang)
Dienstag, 4. Oktober 2011