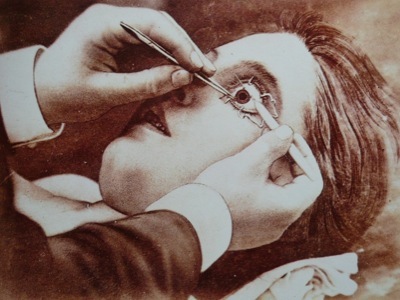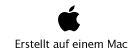Subjekt und Unterwerfung
In Übereinstimmung mit Nietzsche (Genealogie der Moral) verstand Foucault die Subjektwerdung als Unterwerfung. Louis Althusser näherte sich dieser Auffassung mit seinem Versuch, Ideologien als eine Form von Religion zu begreifen und beider Geltungsmacht mit dem Konzept der„Anrufung“ zu erklären. Das paradigmatische Beispiel für die religiöse Anrufung ist die Taufe. Durch die Taufe erhält z.B. ”Petrus” seinen Namen und seinen Ort, seine Identität ist gewährleistet durch Gott. Doch die Taufe setzt eine Bereitschaft des Individuums zur Annahme des Rufs voraus. ”Soweit die Benennung eine Anrede ist, gibt es schon vor der Anrede einen Angeredeten; ist die Anrede jedoch ein Name, der erst erschafft, was er benennt, dann scheint es ’Petrus’ ohne den Namen ’Petrus’ nicht zu geben.” (Judith Butler 2001, S. 106)
Zur Subjektwerdung gehört demnach eine der Subjektivierung vorausgehende Bereitschaft, sich anrufen zu lassen, d.h. es gibt eine Beziehung zwischen dem Individuum und der Autorität vor der Subjektivierung. Diese vorgängige Beziehung entzieht sich der narrativen Darstellung, da diese, gebunden an die Grammatik, das Subjekt als grammatisches, bereits voraussetzen muss, um seine Genese aufzuzeigen. Die vorgängige Unterwerfung unter die Autorität ist die ”nicht narrativierbare Vorgeschichte des Subjekts” (S. 106). Butler folgert, daß ”man perverserweise vielleicht (immer schon) dem Gesetz” nachgegeben hat, um die ”eigene Fortexistenz zu sichern” (S. 106f.)
Althusser verfängt sich Butler zufolge in einem Zirkel. Für die Vorgeschichte des Subjekts steht bei Althusser das Individuum. Dieses Individuum geht dem Subjekt voraus und alle Versuche, seine Genese zu erläutern, setzen es notwendig bereits als Subjekt voraus. Für Butler steht diese Voraussetzung in enger Verbindung mit der Reproduktion der gesellschaftlichen Beziehungen (der Produktionsverhältnisse) und damit mit der Reproduktion der Subjektivität selbst. Die Reproduktion der Arbeitskraft ist für sie zentral, da das Subjekt hier lernt, seine Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen und sich damit ihrer zu entledigen. Nach Freud soll der Patient arbeiten.
Judith Butler versteht Althussers Anrufung primär als die Übernahme einer Schuld und den damit verbundenen ”Eintritt in die Sprache der Selbstzuschreibung” (S. 101). Die Anrufung verlangt, sich dem Gesetz anzuschließen, sich ihm zu unterwerfen. Butler wirft die Frage auf, warum die Subjektwerdung abhängig ist von der Übernahme einer Schuld. ”Wie und weshalb wendet sich das Subjekt in Erwartung der Verleihung einer Identität durch die Selbstzuschreibung von Schuld um? Welche Art von Beziehung bindet diese beiden bereits, so daß das Subjekt weiß, wie es sich umzuwenden hat, weiß, daß es etwas dabei gewinnen kann?” (S. 102) Der Angerufene hat in Althussers Perspektive keine Chance, sich die Frage zu stellen, wer spricht/anruft und warum er auf den Anruf reagieren soll. Butler schlägt vor, von einer ”leidenschaftlichen Komplizenschaft” des Individuums mit dem Gesetz auszugehen. Das Ich muß, um sich dem Gesetz gegenüber kritisch verhalten zu können, akzeptieren, daß sein Begehren des Gesetzes die Grundlage seiner eigenen Existenz ist. Diese ”leidenschaftliche Komplizenschaft” geht der Übernahme einer konkreten Schuld im Prozess der Anrufung voraus. Die ”Hinwendung” ist die Bedingung der Subjektivation und entgeht ihr zugleich. Die Interpellation setzt für Butler ein Gewissen in der Form einer allgemeinen Bereitschaft, ”Schuld zu akzeptieren, um Identität zu gewinnen” (S. 103), voraus. Während Althusser mit seinem Konzept der Anrufung die Möglichkeit zur Kritik begründen möchte, sieht Butler die Möglichkeit von Kritik in ihr zu stark eingeschränkt. Butler setzt auf das Beherrschen von Fähigkeiten als Entschuldigung/Verteidigung des Subjekts gegenüber den Forderungen/Anschuldigungen (Anrufungen) der herrschenden Ideologie. Die Unterwerfung, der sich das Subjekt unterzieht, läßt sich als Versuch verstehen, einen Unschuldsbeweis zu erbringen.
Ein ”Subjekt” zu werden heißt somit, für schuldig gehalten, vor Gericht gestellt und für unschuldig erklärt worden zu sein. Da dieser Spruch nun kein Einzelakt ist, sondern ein unaufhörlich reproduzierter Status, heißt ”Subjekt” werden, permanent damit beschäftigt zu sein, sich eines Schuldvorwurfs zu entledigen. (S. 112)
Bei Kafka geht dieser Prozeß ungünstiger aus. Nach der „Anrufung“ Josef K.s im Dom durch einen Priester ist seine Vernichtung nur noch eine Frage der Zeit.:
K. fühlte sich ein wenig verlassen, als er dort, vom Geistlichen vielleicht beobachtet, zwischen den leeren Bänken allein hindurchging, auch schien ihm die Größe des Doms gerade an der Grenze des für Menschen noch Erträglichen zu liegen. Als er zu seinem früheren Platz kam, haschte er förmlich, ohne weiteren Aufenthalt, nach dem dort liegengelassenen Album und nahm es an sich. Fast hatte er schon das Gebiet der Bänke verlassen und näherte sich dem freien Raum, der zwischen ihnen und dem Ausgang lag, als er zum erstenmal die Stimme des Geistlichen hörte. Eine mächtige, geübte Stimme. Wie durchdrang sie den zu ihrer Aufnahme bereiten Dom! Es war aber nicht die Gemeinde, die der Geistliche anrief, es war ganz eindeutig, und es gab keine Ausflüchte, er rief: »Josef K.!«
K. stockte und sah vor sich auf den Boden. Vorläufig war er noch frei, er konnte noch weitergehen und durch eine der drei kleinen, dunklen Holztüren, die nicht weit vor ihm waren, sich davonmachen. Es würde eben bedeuten, daß er nicht verstanden hatte, oder daß er zwar verstanden hatte, sich aber darum nicht kümmern wollte. Falls er sich aber umdrehte, war er festgehalten, denn dann hatte er das Geständnis gemacht, daß er gut verstanden hatte, daß er wirklich der Angerufene war und daß er auch folgen wollte. Hätte der Geistliche nochmals gerufen, wäre K. gewiß fortgegangen, aber da alles still blieb, solange K. auch wartete, drehte er doch ein wenig den Kopf, denn er wollte sehen, was der Geistliche jetzt mache. Er stand ruhig auf der Kanzel wie früher, es war aber deutlich zu sehen, daß er K.s Kopfwendung bemerkt hatte. Es wäre ein kindliches Versteckenspiel gewesen, wenn sich jetzt K. nicht vollständig umgedreht hätte. Er tat es und wurde vom Geistlichen durch ein Winken des Fingers näher gerufen. Da jetzt alles offen geschehen konnte, lief er – er tat es auch aus Neugierde und um die Angelegenheit abzukürzen – mit langen, fliegenden Schritten der Kanzel entgegen. Bei den ersten Bänken machte er halt, aber dem Geistlichen schien die Entfernung noch zu groß, er streckte die Hand aus und zeigte mit dem scharf gesenkten Zeigefinger auf eine Stelle knapp vor der Kanzel. K. folgte auch darin, er mußte auf diesem Platz den Kopf schon weit zurückbeugen, um den Geistlichen noch zu sehen. »Du bist Josef K.«, sagte der Geistliche und erhob eine Hand auf der Brüstung in einer unbestimmten Bewegung. »Ja«, sagte K., er dachte daran, wie offen er früher immer seinen Namen genannt hatte, seit einiger Zeit war er ihm eine Last, auch kannten jetzt seinen Namen Leute, mit denen er zum erstenmal zusammenkam, wie schön war es, sich zuerst vorzustellen und dann erst gekannt zu werden. »Du bist angeklagt«, sagte der Geistliche besonders leise. »Ja«, sagte K., »man hat mich davon verständigt.« »Dann bist du der, den ich suche«, sagte der Geistliche. »Ich bin der Gefängniskaplan.« »Ach so«, sagte K. »Ich habe dich hierher rufen lassen«, sagte der Geistliche, »um mit dir zu sprechen.« »Ich wußte es nicht«, sagte K. »Ich bin hierhergekommen, um einem Italiener den Dom zu zeigen.« »Laß das Nebensächliche«, sagte der Geistliche. »Was hältst du in der Hand? Ist es ein Gebetbuch?« »Nein«, antwortete K., »es ist ein Album der städtischen Sehenswürdigkeiten.« »Leg es aus der Hand«, sagte der Geistliche. K. warf es so heftig weg, daß es aufklappte und mit zerdrückten Blättern ein Stück über den Boden schleifte. »Weißt du, daß dein Prozeß schlecht steht?« fragte der Geistliche. »Es scheint mir auch so«, sagte K. »Ich habe mir alle Mühe gegeben, bisher aber ohne Erfolg. Allerdings habe ich die Eingabe noch nicht fertig.« »Wie stellst du dir das Ende vor?« fragte der Geistliche. »Früher dachte ich, es müsse gut enden«, sagte K., »jetzt zweifle ich daran manchmal selbst. Ich weiß nicht, wie es enden wird. Weißt du es?« »Nein«, sagte der Geistliche, »aber ich fürchte, es wird schlecht enden. Man hält dich für schuldig. Dein Prozeß wird vielleicht über ein niedriges Gericht gar nicht hinauskommen. Man hält wenigstens vorläufig deine Schuld für erwiesen.« »Ich bin aber nicht schuldig«, sagte K., »es ist ein Irrtum. Wie kann denn ein Mensch überhaupt schuldig sein. Wir sind hier doch alle Menschen, einer wie der andere.« »Das ist richtig«, sagte der Geistliche, »aber so pflegen die Schuldigen zu reden.« »Hast auch du ein Vorurteil gegen mich?« fragte K. »Ich habe kein Vorurteil gegen dich«, sagte der Geistliche. »Ich danke dir«, sagte K., »alle anderen aber, die an dem Verfahren beteiligt sind, haben ein Vorurteil gegen mich. Sie flößen es auch den Unbeteiligten ein. Meine Stellung wird immer schwieriger.« »Du mißverstehst die Tatsachen«, sagte der Geistliche, »das Urteil kommt nicht mit einemmal, das Verfahren geht allmählich ins Urteil über.« »So ist es also«, sagte K. und senkte den Kopf. »Was willst du nächstens in deiner Sache tun?« fragte der Geistliche. »Ich will noch Hilfe suchen«, sagte K. und hob den Kopf, um zu sehen, wie der Geistliche es beurteile. »Es gibt noch gewisse Möglichkeiten, die ich nicht ausgenutzt habe.« »Du suchst zuviel fremde Hilfe«, sagte der Geistliche mißbilligend, »und besonders bei Frauen. Merkst du denn nicht, daß es nicht die wahre Hilfe ist?« »Manchmal und sogar oft könnte ich dir recht geben«, sagte K., »aber nicht immer. Die Frauen haben eine große Macht. Wenn ich einige Frauen, die ich kenne, dazu bewegen könnte, gemeinschaftlich für mich zu arbeiten, müßte ich durchdringen. Besonders bei diesem Gericht, das fast nur aus Frauenjägern besteht. Zeig dem Untersuchungsrichter eine Frau aus der Ferne, und er überrennt, um nur rechtzeitig hinzukommen, den Gerichtstisch und den Angeklagten.« Der Geistliche neigte den Kopf zur Brüstung, jetzt erst schien die Überdachung der Kanzel ihn niederzudrücken. Was für ein Unwetter mochte draußen sein? Das war kein trüber Tag mehr, das war schon tiefe Nacht. Keine Glasmalerei der großen Fenster war imstande, die dunkle Wand auch nur mit einem Schimmer zu unterbrechen. Und gerade jetzt begann der Kirchendiener, die Kerzen auf dem Hauptaltar, eine nach der anderen, auszulöschen. »Bist du mir böse?« fragte K. den Geistlichen. »Du weißt vielleicht nicht, was für einem Gericht du dienst.« Er bekam keine Antwort. »Es sind doch nur meine Erfahrungen«, sagte K. Oben blieb es noch immer still. »Ich wollte dich nicht beleidigen«, sagte K. Da schrie der Geistliche zu K. hinunter: »Siehst du denn nicht zwei Schritte weit?« Es war im Zorn geschrien, aber gleichzeitig wie von einem, der jemanden fallen sieht und, weil er selbst erschrocken ist, unvorsichtig, ohne Willen schreit.
Freitag, 18. Februar 2011