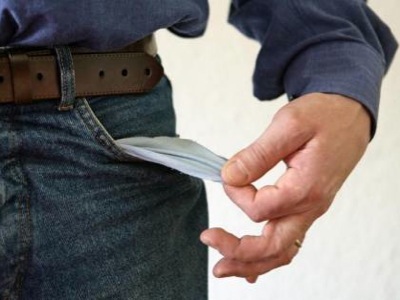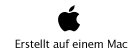Veblen und de Sade
Thorstein Veblen wurde in seiner nach dem Modell des “cultural lag” von Ogburn (der Rückständigkeit des Kulturellen gegenüber der Produktion) aufgebauten und im Geist der Technokratie-Bewegung verfaßten Kulturkritik nicht müde, retardierende Momente im Prozeß der Demokratisierung anzuprangern. Er übte sich darin, Symptome einer Kraft aufzuspüren, die der fortschreitenden Egalisierung und Transparenz entgegenliefen. Vor allem in den Erscheinungsformen des Ornamentalen identifizierte er gespensterhaft Rückstände der Feudalgesellschaft inmitten der nur scheinbar verwirklichten Demokratie. Das Ornament war ihm nicht nur unerkannter Ausdruck der Retardierung, sondern zugleich auch Instrument zum Zwecke der Absicherung des Betrugs gegen seine Entdeckung. Es verwandelt den Skandal in Normalität. Kunsthandwerk wird so zum Komplizen des sozialen Verbrechens. Veblen liefert den theoretischen Rahmen für Adolf Loos’ ohne diesen Rahmen dandyhaft spleenig anmutende Parole. Etwas in der Kultur sorgt dafür, daß der Feudalismus in der Maske der Demokratie weiterlebt, ohne daß es jemand bemerkt. Das Ornament ist für Veblen Inbegriff dieses Moments, das sich aus der Betrugsabsicht und der Bereitschaft, betrogen zu werden, zusammensetzt. Man kann dieses Phänomen herunterspielen und verharmlosen zu der Allerweltsweisheit, daß es immer schon Arme und Reiche gegeben habe. Man kann es aber auch zuspitzen zur Empörung darüber, daß die Reichen und Mächtigen sich erlauben, mit ihrem auf Kosten anderer erworbenen Reichtum ebendiese anderen zu brüskieren, sie ihrer Dummheit wegen, sich ausbeuten zu lassen, auch noch zu verhöhnen. Die prunkvolle Ausstattung einer Villa demonstriert so gesehen die Frechheit des Eigentümers, sich mit seiner geraubten Beute vor den Opfern zu brüsten. Es handelt sich um eine Provokation, die nicht erwidert wird und die so die hämische Schadenfreude des Siegers noch steigert um den Genuß der Ohnmacht und der freiwilligen Unterwerfung und Selbsterniedrigung der Unterlegenen. In dieser Zuspitzung hat das von Veblen aufs Korn genommene Syndrom Züge des Universums des Marquis de Sade, in welchem der Reichtum den Libertins ermöglicht, das Schauspiel der Ohnmacht derer, die beraubt wurden, in Szene zu setzen und sich daran zu ergötzen. Der Umstand, daß es Arme gibt, weil es Reiche gibt, ist für Veblen der Skandal. Die Provokation de Sades liegt darin, daß die Reichen sich benehmen, als müsse es sie geben, damit es Arme gibt. Das Ornament ist nicht nur Ausdruck von Ungerechtigkeit, sondern von Infamie. Wenn Veblen einst darauf hoffte, daß sich die feudalen Reste auflösen werden, muß man heute feststellen, daß sich die Situation zu der bei de Sade beschriebenen hin verschärft hat. „Arme und Reiche hat es immer gegeben. Nie wurde aber bisher die private Bereicherung mit solcher Schamlosigkeit in der Öffentlichkeit zur Schau getragen, und nie wußten die Armen so genau, wie reich die Reichen sind. Das kann nicht gutgehen.“ (Stephane Hessel, der Autor von „Indignéz vous“ in einem Gespräch mit Joseph Hanimann FAZ vom 20.1. 2011)
Freitag, 18. Februar 2011