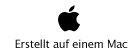Trauma erzählen
Läßt sich das Trauma erzählen? Die Frage, die ein Thema für die junge Wissenschaft der Narratologie wäre, offenbart die tiefe Kluft, die sich zwischen der Psychologie und der Literaturwissenschaft auftut. Am unversöhnlichsten ist der Zwist der Literaturwissenschaft mit der Psychiatrie, aber auch mit der Psychoanalyse ist keine wirkliche Übereinstimmung zu erzielen. Von der Psychologie wird der Literaturwissenschaft vorgeworfen, jedem Bestreben nach Artikulation und narrativem Erschließen von traumatischen Erfahrungen Widerstand entgegensetzten. Die philosophischen Einwände gegen das Verfahren der Trauma-Therapie werden verständnislos gewertet als Versuche, die Umwandlung von traumatischer Erfahrung in „narrative Strukturen“ im täglichen Geschäft der Therapeuten als eine Form der Vergewaltigung zu verurteilen. Jedes „bewußte Erinnern“ komme einer „inadäquaten Repräsentation“ gleich. Das Trauma müsse dem Gedächtnis unverfügbar bleiben.
Von Seiten der Literaturwissenschaft waren die von der Psychotherapie zitierten Äußerungen freilich anders gemeint. Sie verlangt nicht vom Traumatisierten, das Trauma zu vergessen und auf Versprachlichung zu verzichten, sondern sie wirft der Psychotherapie vor, bei ihren Prozeduren der Reintegration und Überführung in eine allgemeinverständliche Sprache vom Traumatisierten zu verlangen, das Wesen seines Traums zu verraten und zu vergessen. Im Wort „vergessen“ konzentriert sich das Mißverständnis als gegenseitige Blindheit und Verblendung.
Der aufgebrachte Psychotherapeut beklagt sich: Es ist nicht nur der Akt der Verbalisierung sondern tatsächlich auch der mentale Prozess der „Integration des Traumas“, der diskreditiert und zurückgewiesen wird: Die psychische „Integration des Traumas“ wird – während man mitunter einräumt, dass sie für Belange der Therapie unverzichtbar sei – als etwas sehr „Bedrohliches“ angesehen, was die "Aura (des Traumas) zerstört“ und es „seiner Einzigartigkeit beraubt“, (Michael Roth, Trauma, Repräsentation und historisches Bewusstsein, in: Jörn Rüsen & Jürgen Straub (Hrsg.), S. 167). Caruth (in Braese, 2003, S. 969) und Ulrich Baer, (Hrsg. "Niemand zeugt für den Zeugen". Erinnerungskultur und historische Verantwortung nach der Shoah, Frankfurt a/M., 2000, S.27) legen nahe, dass die Verbalisierung und "Integration" traumatischer Erfahrung kein Gewinn sondern ein Verlust der "wesentlichen Genauigkeit und starken Wirkung" des Traumas wäre und letztlich ein "Sakrileg an der Integrität [des Traumas]" bedeutete.
Und Caruth (Caruth, Cathy (1995b), Recapturing the Past: Introduction, in: dies. (1995), Trauma. Explorations in Memory, Baltimore, S. 151−57) fürchtet, daß die "wesentliche Unfaßbarkeit" des Traumas sowie sein aggressiv-destruktives Potenzial, einen "massiven Anschlag auf das Verstehen" auszuführen, verloren gehe. Dem angesichts einer derartigen Begriffsstutzigkeit, wie sie etwa Harald Weilnböck (article from eurozine.com 2008) an den Tag legt, verzweifelte Literaturwissenschaftler liegt es fern, einem Patienten die Therapie zu verwehren oder auch nur auszureden. Ein bizarres Aneinander-Vorbeireden, das sich so wenig auflösen läßt wie die tragische Konstellation von Antigone und Kreon.
Die Psychotherapie beklagt sich darüber, daß die Literaturwissenschaft vom Traumatisierten verlange, das Vorhaben, wieder gesund zu werden zu vergessen und daß sie sich nicht für die Not der Betroffenen interessiere. Die Literaturwissenschaft ihrerseits wirft der Psychotherapie vor, daß sie bei der Reintegrationshilfe des Traumatisierten und bei der Überführung des Traumas in allgemeine Sprache vom Traumatisierten verlange, sein Trauma zu vergessen. Die Positionen scheinen unvereinbar, weil die jeweiligen Denkrahmen nicht kompatibel sind.
Die Literaturwissenschaft macht sich zum Anwalt des Traumatisierten, indem sie ihm ein Interesse daran zubilligt, so sprechen zu lernen, wie er gesprochen hätte, wenn er eine Sprache gehabt hätte, während der Diskurs der Psychotherapie von ihm verlange, sich einem Unterwerfungsritual zu beugen, in dem er seinem falschen Glauben abschwören soll. Kristeva spricht von den Mühen, sich gegen die allgemeine, generische Sprache zur Wehr zu setzen und seine eigene Sprache zu behaupten. Für Lacan kann es diese eigene Sprache prinzipiell nicht geben, weil Sprache immer die des Subjekts ist, das zwar immer erst im Werden begriffen ist, das aber auch nicht hintergehbar ist, weil es das, was vor einem Subjekt wäre, immer nur nachträglich geben kann. Der metatheoretische Kern von Traumaforschung wäre die Einsicht, daß sich im Trauma die Subjektwerdung, die man mit dem Abschluß der Kindheit abgeschlossen glaubt, erneut vollzieht. Dem Psychotherapeuten ist nicht klar, daß seine Hilfe eine Enteignung ist, wobei seine Helfer-Ideologie verdeckt, daß er ein unmögliches Opfer verlangt. Was er vom Traumatisierten aufzuheben und zu verraten verlangt, und was bei Lacan im Begriff der Jouissance gefaßt ist, das ist seine traumatische Erfahrung, die eine Erfahrung auf der Ebene des Eingebettetseins in interaktive Konstellationen ist, und daß diese Erfahrung sein Ich ist. Das Opfer besteht darin, anerkennen zu sollen, daß Ich-Sagen-Dürfen den Preis hat, dieses Interaktive, das Übertragungsgeschehen und damit das Beteiligtsein der anderen zu vergessen. Als Ohnmächtiger, Rasender, Stammelnder darf ich nicht Ich sagen. Wer das trotzdem tut wie Artaud, der muß die Folgen tragen. Deleuze und Guattari haben das Universum der Jouissance ausgelotet und kartographiert. Barthes hat das Sich-Verlieben als Traumatisierung analysiert und darauf bestanden, die Sprache des Sich-Verliebenden als unmögliche dennoch zur Sprache zu bringen, als Alphabet von Fragmenten.
Die Psychotherapie kann bei all dem nur denken, man interessiere sich nicht für die Not der betroffenen, und der betroffene selbst will nicht gesund werden, er will sich nicht helfen lassen, er will nicht mitarbeiten. Sie nennt das Abwehr. Sie hat keinen Zugang zu der Dimension, die von der Literaturwissenschaft thematisiert wird, wobei man nicht übersehen darf, daß es sich um eine noch sehr junge Fraktion innerhalb der Literaturwissenschaft handelt, die keineswegs allgemein anerkannt und etabliert ist. Es handelt sich bei dieser unzugänglichen Dimension um die metatheoretischen Ebene der Psychotherapie und der Literaturwissenschaft gleichermaßen. Die Abwehrkräfte der Psychotherapie gegen Selbstreflexion sind stärker ausgeprägt als die der Literaturwissenschaft, und sie hat dieser voraus, daß sie den Patienten in Geiselhaft nehmen und ihm das Messer an die Gurgel halten kann. Sie glaubt, die besseren Argumente zu haben, weil sie im Namen der notleidenden Patienten die Literaturwissenschaft zwingen kann, ihre Waffen niederzulegen. Sie weiß nichts von dem Ritual der Unterwerfung, das sich in ihrem theoretischen Rücken abspielt. Von diesem Opfer-Ritual weiß nur der Traumatisierte, der aber davon nicht berichten kann, weil er keine Sprache hat und weil das, was er zu sagen hätte, niemand hören will und ihm niemand glaubt. Das ist ja das Trauma. Während die Psychotherapie nicht anders kann, als das Problem des Traumatisierten als Abwehr zu registrieren und auf pädagogische Tricks und Maßnahmen sinnt, um dem Patienten zu seiner Gesundheit zu verhelfen, wobei diese Maßnahmen von Strafmaßnahmen genau besehen nicht zu unterscheiden sind, hat sich die Literaturwissenschaft zu der narratologischen Frage vorgearbeitet, ob und wie sich vom Trauma erzählen läßt, und dabei an die philosophische Frage gerührt, was das Subjekt ist. Psychotherapie und Narratologie können einander so wenig verstehen, wie Detektiv und Geiselnehmer. Das Drama dieses Mißverständnisses hat Kafka in seinem „Prozeß“ beschrieben, dessen heißer Kern die unabschließbare und zugleich unabdingbare Subjektwerdung ist, die sich zwischen einer Vergangenheit, die erst noch zu kreieren ist, und einem Futur 2 als permanenter Prozeß vollzieht.
Samstag, 19. Februar 2011