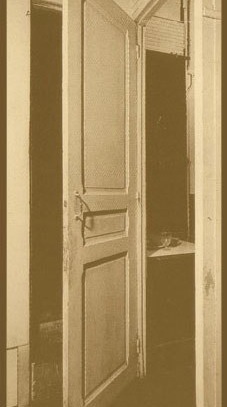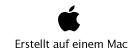Ödipus
Ödipus am Tag der Enthüllungen
An eben jenem Tage nämlich, da
das Herz mir wild aufbrauste und als größtes Glück
das Sterben mir erschien, der Tod durch Steinigung,
da war nicht einer da, der dieser Sehnsucht half;
doch später, als schon alles Leid gemildert war
und ich begriff, daß schlimm entgleist war mir mein Zorn
und mehr mich hatt’ gestraft, als ich zuvor gefehlt,
da erst verstieß die Stadt mich mit Gewalt
von ihrem Grund nach langer Zeit, doch sie, imstand,
des Vaters Söhne, ihrem Vater beizustehn,
sie taten’s nicht - ein Wörtchen nur aus ihrem Mund:
ich irrte nicht als flüchtger Bettler stets umher.
Was sich Ödipus vorwirft, ist sein rasender Zorn darüber, in seiner Not unverstanden und allein gelassen worden zu sein. Die Selbstbesinnung betrifft die Maßlosigkeit dieses Zorns. Von einem Schuldbewußtsein in Bezug auf Vater und Mutter keine Rede. Den Vater erschlug er, als er sich gegen dessen Angriff zur Wehr setzen mußte. Am Tod seiner Mutter, die ihn als Kind aussetzte und auf seinen Tod hoffte, und die ihn später zu ihrem geliebten machte, ist er und fühlt er sich ebensowenig schuldig.
Wenn Sigmund Freud die Geschichte ins theoretische Zentrum der Psychoanalyse stellt, muß er Ödipus eine Schuld und ein Schuldgefühl andichten. Ein Prozess rückwärtsgewandter „Selbsterkenntnis" unter dem Motto des delphischen Apollo „Erkenne dich selbst" wird als notwendige Voraussetzung der Überwindung der „Pest" Hysterie bezeichnet. Die heilsame Wirkung eines kathartischen Verstehens war schon Sophokles geläufig. Doch kann die Selbsterkenntnis in den beiden Ödipus-Dramen nur den nachträglichen Zorn betreffen.
Die Mutter Jokaste kommt bei Sophokles am schlechtesten weg. Ein Nachhall der Verurteilung findet sich bei Ranke-Graves, für den diese Tragödie im Kontext des Konfliktes zwischen matriarchalischen und patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen stand. Iokastes Verhalten hat in dieser Interpretation die Bedeutung einer infamen und hocheffektiven Intrige, mit der sie sich an den ihr nahestehenden Vertretern des männlichen Geschlechts für die erlebte Entwertung und Unterdrückung durch das Patriarchat (bewußt oder unbewußt) zu rächen sucht: indem sie Vater und Sohn von klein auf einander entfremdet - so können Vater und Sohn aneinandergeraten, wobei die Aggression vom Vater ausgeht, auf die der Sohn entsprechend reagiert – und in der als Mutter ihren eigenen sSohn zum Partnerersatz macht. Als solcher wird er daran gehindert, ein eigenständiges Leben zu entwickeln. Auf diese Weise übt die Mutter doppelte Rache am männlichen Geschlecht.
Bei Sophokles trifft Ödipus keine Schuld. Die Befürchtung des Publikums und des Chors, er möchte ohne eigenes Wissen Schuld auf sich geladen haben, wird mehrfach zurückgewiesen. Schon in der ersten Szene, als er sich einigen anwesenden Bewohnern von Kolonos vorstellt, sieht er sich genötigt und nutzt er die Gelegenheit, das Entsetzen seiner Zuhörer über seine Identität zu mildern, indem er zu seiner Vergangenheit Stellung bezieht (V. 258 ff). Dabei sagt er klar, daß er seine Taten „mehr erlitten als verübt" hatte: „Wie wäre wesenhaft ich schlecht, der ich vergalt, was ich erlitt?... Nun kam ich ahnungslos, wohin ich kam, doch sie, durch die ich litt, sie suchten meinen Tod bewußt." Wenn in den zwei Stücken überhaupt von Schuld die Rede sein kann, dann trifft sie seine Eltern, vor allem die Mutter, die mit der Aussetzung seinen Tod gewollt hatte, und den Vater, der ihn – ohne ihn zu erkennen - viele Jahre später beinahe am Dreiweg getötet hätte. Sowohl Kreon und Eteokles - als gegenwärtige Herrscher Thebens -, als auch Polyneikes - als der aus seiner Herrschaft Vertriebene - wollen Ödipus nun wieder bei sich aufnehmen, denn das Orakel habe demjenigen Heil prophezeit, der Ödipus eine letzte Zuflucht gewähre (V. 385 ff).
Kreon hatte geplant, so weiß Ismene, Ödipus nur in der Nähe Thebens eine Unterkunft zu gewähren, da er eine offizielle Rehabilitation scheute. Der Makel des Verwandtenmordes, der an ihm hafte, machte dies erforderlich. Ödipus ist entsetzt über diese Heuchelei Kreons, der ihm die Bestattung in Theben versagen will, aber zugleich von der prophezeiten Gunst profitieren möchte. Kreon versuchte, Ödipus durch Vortäuschen einer Anteilnahme an seinem Elend für die Heimkunft zu gewinnen. Da Ödipus bereits über die Hintergründe informiert ist, läßt er sich darauf nicht ein. Nun offenbart Kreon sein wahres Gesicht und setzt kurzerhand die Verschleppung von Antigone und Ismene ins Werk, womit er den so völlig hilflos gemachten Ödipus nun gewaltsam zur Rückkehr erpressen möchte.
Die Selbstblendung und der Wunsch nach Verbannung werden von Ödipus später als übereilte Kurzschlußreaktionen dargestellt („Ödipus auf Kolonos", V.425-444). Er war wohl zunächst überwältigt von der Tragik der Vorfälle, so daß er die Situation nicht vollständig durchschaute. Es wird deutlich gezeigt, wie eine Frau ihren Sohn zum Spielball ihrer Intrige macht. Der Text legt sogar die Vermutung nahe, daß Jokaste sich des Inzests bewußt ist.
In Iokastes Verhalten liegt das Hauptproblem des Ödipus-Dramas. Es zeigt, wie die Situation des Ödipus gerade vor den Göttern in gutem Licht erscheint: Ihm ist offenbar besondere göttliche Gnade zuteil geworden, weil das Gewähren von Zuflucht dem Beschützenden besondere Macht verleiht. Und mehr noch: das Stück endet damit, daß Ödipus leibhaftig in die Unterwelt aufgenommen wird. Ödipus erweist sich am Ende als „Heilsbringer", als ein „Heiliger". Er steht in göttlicher Gunst und wird leibhaftig in die Unterwelt entrückt.
Ödipus wird mehrfach als ein Mann vorgestellt, der in selbstloser, mutiger Offenheit - gegen die erheblichen Widerstände von Teiresias, Kreon, Jokaste und dem Hirten - die Aufklärung forciert, damit die Wahrheit ans Licht käme. Diese Tendenz, der Wahrheit schonungslos auf den Grund zu gehen, ist der wesentliche Zug in seinem Charakter. Wohl wegen seiner mutigen Aufrichtigkeit hat sich der weise König vor der Rehabilitierung durch das Volk die Achtung der Götter erworben (V.40, V.46).
Freud setzt die Tendenz fort, die Seneca in seiner Bearbeitung des Stoffes begründete, indem er die Rolle der Mutter vollkommen in den Hintergrund rückte und systematisch ausblendete, um dem Vorurteil des Volkes Raum zu geben, Ödipus selbst sei der eigentlich Schuldige. Auch Apollodor in seiner „Mythologische Bibliothek" (ca. 100-200 n. Chr.) unterstreicht kurze Zeit später Senecas Uminterpretation, indem die bei Sophokles entlarvte Lüge der Jokaste als Wahrheit ausgegeben, also sowohl die Aussetzung des Kindes als Tat des Vaters hingestellt wird als auch Ödipus als Schuldbeladener erscheint.
Samstag, 26. Februar 2011