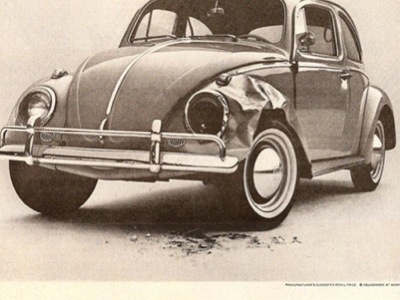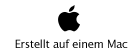Entlastung
Es war einmal von der Idee die Rede, daß mit zunehmender Mechanisierung und Automatisierung, erst recht der Computerisierung der Mensch von entfremdeter Arbeit entlastet werde und Zeit habe für selbstbestimmtes Leben und für kreative Beschäftigungen. Geblieben ist davon nichts. Tatsächlich sehen wir gestiegene Sorge um den Verlust von Arbeitsplätzen, so entfremdet die Arbeit, die man dort verrichtet, auch sein möge, oder das Begehren, einen solchen Arbeitsplatz zu ergattern. Die Not der Industrialisierung („Die Weber“) ist sogar noch verschärft durch Fortschritte bei der Entwicklung von intelligence augmentation (erweiterte Intelligenz) und artificial intelligence (künstliche Intelligenz). Wenn in jüngster Zeit Callcenter zumindest noch in Indien Arbeitsplätze schufen, die aus Europa ausgelagert wurden, dann werden demnächst diese Jobs von Computern mit Spracherkennung gemacht. Neue Software-Anwendungen verdrängen Arbeitskräfte auch aus höheren Angestelltentätigkeiten und drängen die Beschäftigten in niedere Dienstleistungsjobs ab. Die Verfechter dieser jüngsten Fortschritts-Runde versuchen die Leute damit zu beruhigen, daß die Reduzierung der Arbeitskräfte im Agrarsektor seit der industriellen Revolution bis heute auf 1% auch nicht zu Massenarmut geführt habe. Andere wie Martin Ford („The Lights in the Tunnel, vgl. John Markoff in der FAZ vom 23.2.11) warnen, der Verdrängungsprozeß werde erbarmungslos.
Warum hat sich die Utopie der Entlastung der Menschen durch die Folgen des beschleunigten technischen Wandels nicht erfüllt? Computerwissenschaftler wie Douglas Engelbart oder John Mcarthy scheren sich nicht um solche Fragen. Wer ist für diese Frage zuständig?
Freitag, 4. März 2011