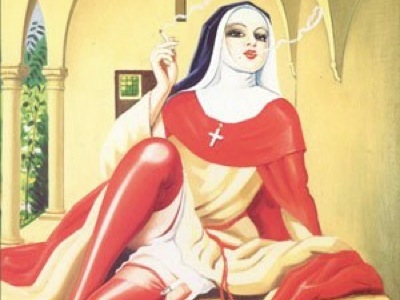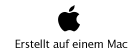Zeichenangst
Der Mensch hat früh gelernt, als Menschheit wie als Kind, Zeichen zu bilden und so die Dinge zu verdoppeln, zu lernen zu unterscheiden zwischen der Sache selbst und etwas, das sie repräsentiert. Wie es dazu kam, das läßt sich auf unterschiedliche Weise erzählen. Eco nennt die Höhle, die Schutz bot vor Unwetter und wilden Tieren und die erlaubte, Lebensmittel und Werkzeuge aufzubewahren, als Ursprung. Das Zeichen der Höhle erlaubte, sich an sie zu erinnern, sie wiederzufinden und anderen zu beschreiben, wie sie sie finden, ohne selbst mitgehen zu müssen. Vico nennt eine andere Ursprungslegende der Zeichen, wenn er die ersten Menschen, „noch ganz Staunen und Wildheit“, in ein Unwetter geraten läßt. Da sie die Blitze und den Donner als etwas übermenschlich Gewaltiges erfahren, verspüren sie ein unabweisbares Bedürfnis, sie sich als Ausdrucksweisen eines übermächtigen Wesens zu imaginieren. Sie sehen sich genötigt, ihm einen Namen zu geben und es sich bildlich vorzustellen, als blitzeschleudernden Riesen. Im Moment, da sie diesen Gott produzieren, haben sie vergessen, daß sie es waren, die ihn in ihren Gedanken erzeugt haben und sinnen darauf, wie sie seinen Zorn besänftigen, wie sie ihn gnädig stimmen und mit Opfergaben magisch manipulieren können. Die Frage, warum sie die Produktion dieser Phantasie vergessen mußten, ob es daran lag, daß sie sich ihrer Angst im Kollektiv schämten, diese Frage wird der Mensch erst viel später sich zu stellen in der Lage sein.
Gewöhnt, mit Zeichen zu hantieren, arbeiten wir mit der Trennbarkeit von Zeichen und den Dingen selbst. Wir haben gelernt, bloße Zeichen nicht für die Realität selbst zu nehmen. Wenn doch einmal etwas durchs offene Fenster hereinfliegt, was kein Vogel sondern eine Fledermaus ist, die sich dann auch noch als Vampir entpuppt, dann wissen wir, daß wir ihm nur das Kreuz entgegenstrecken müssen. Daß wir in der Welt der Zeichen vor Realitätsspuk nicht sicher sein können, ist Thema als Bedrohung und Genuß gleichermaßen. Wir dürfen uns in einem Film zwar gruseln, aber letztlich können wir uns sagen, es ist ja nur ein Film.
Wir haben aber auch gelernt, daß auf die Trennbarkeit von Realiät und bloßem Zeichen und auf den abklärenden und bannenden Effekt der Zeichen kein Verlaß ist und daß es Bereiche gibt, wo er wirkungslos sein soll. Roland Barthes hat Beispiele für „Mythen des Alltags“ vorgeführt, die uns veranlassen, vor einer Fahne zu grüßen oder ein Auto wie eine Göttin anzubeten. Den Fahnengruß zu verweigern, kann mit dem Tode bestraft werden, und sich den Aufforderungen der Werbung zu verweigern, kann zum Ausschluß aus der Gemeinschaft führen. Die Gefahren liegen nicht nur, wo die Phantasie mit uns durchzugehen droht, sondern auch da, wo die Gesellschaft von uns die Anerkennung von Zeichen als Realität verlangt. Für die gesellschaftlich verordnete Mythologisierung haben wir im Karneval und anderen Riten und Techniken der Lächerlichmachung zugleich eine Strategie der Distanzierung. In der schaurigen Bewunderung für Zauberkräfte und Verführungskünste sind wir in der Lage, diese Distanzierungsfähigkeit wieder außer Kraft zu setzen. Auch die Pornographie stellt diese Fähigkeit unter beweis. Nun scheinen wir in jüngster Zeit das Vertrauen in diese unsere Fähigkeiten verloren zu haben, da eine Angst vor den Zeichen grassiert. Vielleicht ist Harry Potter schuld. Als Indiz mag gelten, daß das Wort „dasselbe“ aus dem allgemeinen Sprachschatz verschwunden ist. Es ist ausnahmslos durch „das gleiche“ ersetzt worden. Wir sitzen alle im gleichen Boot.
Freitag, 4. März 2011