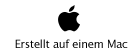van Gogh und Artaud
Meyer-Shapiro beschrieb das Bild „Weizenfeld mit Raben“, ausgestellt auf der Van Gogh Ausstellung in Paris 1946: Er erkannte darin ein Kalkül, ausgedrückt in zwei gegensätzlichen Instanzen: einer gewalttätigen desintegrerierenden Kraft und einer Gegenmaßnahme, die auf dem Höhepunkt der Angst und Trostlosigkeit ein plastisches und chromatisches Dispositiv erzeugt als Zeichen und Träger einer „guten Gesundheit“. Das niedrige Format, breit und langgezogen, und die perspektivische Ungewißheit werfen den Betrachter in einen konfusen und beunruhigenden Zustand. Die Linien der drei auseinanderstrebenden Wege, die sich vom Vordergrund aus im Weizenfeld verlieren oder seitlich aus dem Bild hinausführen, laufen zusammen „wie reißende Ströme vom Horizont in Richtung Vordergrund, als ob der Raum plötzlich den eigenen Fluchtpunkt verloren hätte und sich das Ganze aggressiv gegen den Betrachter wendet“. Während die Zentralperspektive von einem objektiv vollendeten Raum ausgeht, der vom Betrachter getrennt ist, ist es hier anders: „Der Raum strömt von seinem Auge aus und entlädt sich gewaltig in einer unablässigen Bewegung von betont zusammenlaufenden Linien“. (zitiert nach Fabbri S. 204)
Die Erde scheint dem Zwang der Perspektive zu widerstehen, die Zentren sind aufgelöst – selbst die Sonne ist eine dunkle, undeutliche Masse ohne Zentralität – die perspektivischen Divergenzen verhindern die Bewegung in Richtung Fluchtpunkt. Der linke Schwarm der Raben, zickzackartige Figuren des Todes, kommt hingegen vom entfernten Horizont und „wird größer, indem er sich nähert, während die dreieckigen Felder ohne perspektivische Verzerrung breiter werden und sich schnell entfernen.“ Die Kommata dieser hieroglyphischen Vögel fliegen vom Horizont aus in Richtung Vordergrund, sie nähern sich dem Betrachter und kehren seinen Weg in Richtung Fluchtpunkt um. Der Betrachter wird zu ihrem Fluchtpunkt. Die auseinanderstrebende Wellenbewegung der Wege und die bewegte Reihe der Raben „ruft eine zeitliche Perspektive hervor, das Näherrücken eines bevorstehenden Moments“. (204)
Der Betrachter scheint gelähmt zu sein durch die Vorahnung eines bedrohlichen und widrigen Schicksals, ebenso wie „der Wille des Künstlers gefesselt zu sein scheint: Die Welt bewegt sich auf ihn zu, und er kann nicht auf die Welt zugehen“. (205)
Der grenzenlose Himmel der Raben wird etwas absolut Unfaßbares, das über die Tragweite des Blicks des Individuums hinausgeht und ihn am Ende einschließt. Es ist „das stürmische Verlangen, verschlungen zu werden und die eigene Individualität im Unendlichen zu verlieren“. Hier vibriert, selbst in der Lähmung und Auflösung der Welt und der Subjektivität, die andere als Symptome einer geistigen Störung deuten – eine ermunternde Gegenkraft, ein Dispositiv des Widerstands.
Shapiro erfaßt die Gefühle der Trauer, Vergeblichkeit und Trostlosigkeit, aber auch die Gesundheit und Kraft, erkennt auch den im Entstehen begriffenen „Aufruhr der Gesundheit“. Der „König van Gogh“, wie Artaud ihn nennt, „hat nie Angst vor dem Krieg gehabt, um leben zu können, also davor, der Idee der Existenz die Tatsache zu entreißen, daß man lebt“.
Meyer-Shapiros Beschreibung erinnert an Artauds „halluzinierende Lektüre“. Dessen eigene Beschreibung des Bildes in „Van Gogh, der Selbstmörder durch die Gesellschaft, erschien 1947. Der Verrückte von von Rodez liest den Irren von Saint-Rémy.
Artauds Würdigung steht im Kontext seiner Gedanken über das Theater der Grausamkeit. Das Theater erschien ihm als Ort, an dem die gewöhnlichen Gegenstände und der menschliche Körper „zur Würde von Zeichen erhoben“ werden. (Artaud) Die sprachlichen Formen genügen der „physischen Sprache“ der Bühne nicht. Der Schauspieler verkörpert einen Vorrat an Zeichen, Stigmata und Tätowierungen. Er rezitiert einen synkretistischen Text, geschrieben in Hieroglyphen. „Für Artaud sind die tieferen Charakterzüge der menschlichen Person in einen lebendigen geometrischen Raum eingeschrieben, skizziert in den elementaren Zeichen, deren Alphabet und sichtbare Nomenklatur sich im ursprünglichen Land der Tarahumaras erhalten hat. Es sind Zahlen, Buchstaben, geometrische Figuen – Dreiecke, Kreise, Kreuze – und Farben, die überall versprengt sind auf jeder Art von Untergrund: auf Felsen und Schatten, Kleidern und rituellen Gegenständen.“ (Fabbri S. 196)
Artauds Quellen sind die Schluchten in E. A. Poes „Edward Gordon Pym“: „ein gigantisches System aus Wegen, Löchern und Abgründen in Form von Dreiecken und Kreuzungen; Buchstaben von uralten Alphabeten, die den Staub und den schwarzen Granitstein der imaginären Insel Tsalal verstreuen“. für Artaud ist dies das Mexiko der Tarahumaras, ein konstruiertes Land, wie Länder in der Malerei.
Artauds synkretistisches Zeichen ist Manifestation einer universalen Energie, die danach strebt, eine neue kommunikative Beziehung zu weben, ein Prinzip der Ansprache. Sein Anliegen, „das Auseinanderklaffen von Kraft und Form“ (Derrida) zu verringern, „die Trennlinie zwischen einem intelligenten Zeichen und einem intensiven Zeichen“ (Lyotard) nachzuzeichnen, und in den verschiedenen Ausdrucksmitteln Kräfte der Transformation und Metamorphose hervorzurufen. (Deleuze/Guattari).
Das Theater der Grausamkeit besteht wie ein „überhitztes Kraftwerk“ in der „Übertragung von Kräften vom Körper auf den Körper“. Es ist eine wahnsinnige Anspannung, die danach strebt, eine „apokryphe Schrift“ zu löschen, „die mich von der versteckten Kraft fernhielt, indem sie mir das Sein entzog“. (Artaud)
Deleuze hat den unerbittlichen Krieg erkannt, den Artaud dem organischen Körper und seinen Sprachen erklärt hat, und die Forderung nach einer anderen Form von Signifikanz und Inter-Subjektivierung.
Was Artaud von van Gogh sagt, gilt auch für ihn selbst, für das, was Derrida 1967
die „wilde Eigenheit“ nannte. Das Wort genügt nicht. Für Lyotard ist eine „Semiotik der Intensität“ vonnöten, die nach „Schrei und Labyrinth“ verlangt, „jedenfalls ein Zeichen“, ergänzt Deleuze. Die Kritik muß klinisch werden, um die fortscheitende kreative Unordnung des Geistes zu erkennen, und die Klinik kritisch, um im scheinbaren Unsinn die Differenzen von Sprache zu entdecken, die ihre Gestalt verändern. Was van Gogh mit malerischen Mitteln versuchte, das beabsichtigte Artaud mit Worten zu erreichen, indem er mit Glossolalien und Koffer-Sätzen den Worten ein neues Verhalten beizubringen versuchte. Mit den Lautgedichten „vollziehe ich alle Wege meines Denkens in meinem Fleisch nach“.
Mittwoch, 9. März 2011