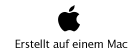Erfindung der Perspektive und des Subjekts
Die Erfindung der Zentralperspektive geht mit der Erfindung des Subjekts einher. Die zwischen Kunst und Wissenschaft schwankende Methode, mit deren Hilfe der von einem Blickpunkt erfasste Wirklichkeitsausschnitt zu einem geschlossenen Systemraum geordnet wird, ist geschaffen für den Illusionismus des Subjekts, das sich im Blick durch das „offene Fenster“ als Herr des eigenen Hauses und der es umgebenden Landschaft fühlt. Dieser Illusionismus ist Anzeichen für kosmologische Spaltungen und Fragmentierungen und Kränkungen abgerungen, die den Menschen, in den Worten Nietzsches, zum “Eckensteher der Weltgeschichte” werden ließen, und die Sigmund Freud durch die Enteignung der Psyche vervollständigte.
Die Zentralperspektive, die als Methode zur Darstellung räumlicher Gebilde in einer ebenen Zeichenfläche bezeichnet werden kann, so daß der Gegenstand auf der Bildfläche unter den gleichen Sehbedingungen erscheint wie der Körper im Raum, ist als ein Versuch der Vereinheitlichung selbst die Folge von Spaltungen, welche die Moderne charakterisieren: Die göttliche Schöpfung zerfällt in objektivierte Natur und subjektiven Eingriff des Menschen, der Mensch zerfällt in Gattungswesen und Individuum sowie in Trieb und Ratio. Die Zentralperspektive ist sowohl als Ausdruck fundamentaler Spaltungen als auch als Bewältigungsversuch der durch die Spaltungen erzeugten Lage zu werten. Sie ist Anerkennung jener Spaltungen und deren Camouflage zugleich. In ihrer Funktion als symbolische Form trägt sie jene Spaltungen als unaufhebbar in sich, deren Synthese ihre Anstrengungen gelten.
Wenn diese nicht sichtbar werden, so liegt dies nicht zuletzt an einer Verleugnung der grundlegenden Diskrepanz von Wirklichkeit und Konstruktion. Denn als Konstruktion ist die Linearperspektive von bestimmten Voraussetzungen abhängig: erstens von der Annahme, der Betrachter hätte nur eine Auge; zweitens, daß dieses Auge sich nicht von der Stelle bewegt und drittens, daß sich der Betrachter vor dem Bild genau an derselben Stelle und in der gleichen Entfernung befindet wie der Maler vor seinem Sujet.
Leonardos Ausführungen in seinem „Traktat über die Malerei“ zu diesem Thema kreisen um dieses Dilemma: Entweder wird das mimetische Bild erreicht, indem der Betrachter gezwungen wird, den Platz einzunehmen, den die Konstruktion ihm zuweist, oder aber die Darstellung erweckt den Anschein, als ob das wirkliche Bild keinerlei perspektivischer Veränderung unterworfen wäre, seine „Wahrheit“ in sich selbst hätte; die Folge davon ist, daß sich der Betrachter frei vor dem Bild bewegen kann, seine subjektiven „Verzerrungen“ jedoch unterdrücken oder gedanklich einklammern muß.
Leonardo sieht in der Linearperspektive nicht bloß ein technisches Mittel zur Herstellung von Bildern, sondern ein Modell, das mit der räumlichen Orientierung in der Welt der Erscheinungen auch die Wahrnehmung selbst bestimmt. Mit anderen Worten: der Einfluß der Zentralperspektive beschränkt sich nicht als Konstruktion von Bildern auf den Bereich des Imaginären, sondern bezieht sich vor allem auf ihre symbolische und kognitive Rolle. Als Ordnung der Repräsentation bringt die Perspektive die Spaltung zwischen dem verkörperten Subjekt, welches durch sie festgelegt und bezeichnet wird und dem Subjekt, das diese Bezeichnung verifiziert, zum Ausdruck. Sie tut dies aber auf eine Weise, die die Tatsache, daß es sich um eine Konstruktierte handelt, vergessen läßt.
Die Perspektive suggeriert eine Einheit von Wirklichkeitstreue und subjektiver Wahrnehmung. Solange der Anspruch des getreu Gegenständlichen und der Anspruch des Subjektiven in der Anwendung der Methode der Perspektive als identisch angenommen werden kann, ist das Verfahren wie auch die entsprechende Weltanschaung unproblematisch.
Panofsky jubelte, daß „sich die Geschichte der Perspektive mit gleichem Recht als ein Triumph des distanzierenden und objektivierenden Wirklichkeitssinns, und als ein Triumph des distanzverneinenden menschlichen Machtstrebens, ebensowohl als Befestigung und Systematisierung der Außenwelt, wie als Erweiterung der Ichsphäre begreifen (läßt)“. (Panofsky, 1985, 123) Er folgt damit Descartes, der in seiner Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs (1637) Heilung von den Spaltungen des Subjekts verspricht, indem die Erkenntnis ihren unzweifelhaften Fundamenten nachspürt. Descartes findet das einzige unbezweifelbare Wissen in der Selbstgewißheit des Denkens: cogito ergo sum.
Dieser Jubel könnte freilich verfrüht und verfehlt sein. Bereits GiambattistaVico bezeichnete in seinen Prinzipien einer Neuen Wissenschaft (1744) Descartes Rückzug vom Buch der Welt als erkenntnistheoretischer Topos der Antike und dessen gereinigte, abstrakte Subjektivität als „Fabel“. Einzige Wahrheit sei nicht das cogito ergo sum, sondern die Feststellung, daß der Mensch nur das erkennen könne, was er selbst erschaffen habe. Vico konstatiert, daß „der unwissende Mensch sich selbst zur Regel des Weltalls macht“. Die erste „Prägung“ besteht darin, daß der Mensch sich selbst in die natürlichen Gegenstände projiziert, indem er diese Gegenstände „beseelt“ und zu „beseelten Substanzen“ macht. „Jupiter“ ist der erste phantasiegeschaffene Allgemeinbegriff (universale fantastico), den der Mensch in Analogiebildung schafft:
Hundert Jahre nach der Sintflut in Mesopotamien und zweihundert nach der Sintflut in der übrigen Welt (. . .) – denn so lange Zeit war nötig, damit die Welt nach der weltweiten Überschwemmung genügend getrocknet war, um heiße Dünste oder brennende Materie in die Luft zu schicken, daß dort Blitze sich entzünden konnten – (geschah es daß) der Himmel schließlich zuckte und dröhnte vor schreckerregenden Blitzen und Donner (. . .) Einige wenige Giganten (. . .) erhoben daraufhin erschrocken und entsetzt von der ungeheuren Wirkung, deren Ursache sie nicht kannten, die Augen und erblickten den Himmel. Da nun in solchem Fall die Natur des Menschengeistes es mit sich bringt (. . .), daß der menschliche Geist einer derartigen Wirkung seine eigene Natur zuschreibt, die Natur der Giganten aber die von Menschen war, die nur aus ungeheuren Körperkräften bestehen und heulend und brüllend sich gegenseitig ihre heftigsten Leidenschaften kundtun, so erdichteten sie den Himmel als einen großen belebten Körper, den sie demzufolge Jupiter nannten (. . .), der ihnen durch das Schleudern der Blitze und das Krachen des Donners etwas mitteilen wollte. (. . .) diese Menschen glaubten, daß alles, was sie sahen, imaginierten und auch selbst machten, Jupiter sei; und der ganzen Welt, die sie erfassen konnten, und allen Teilen der Welt gaben sie das Sein beseelter Substanz. (Vico, 1990, 377ff.)
Vico zieht aus den Erfahrungen der Zentralperspektive andere Schlüsse als Descartes. Vorgestellt wird beiden zufolge mit dieser Technik ein Aneignungsprozeß, in dem das bezeichnende Subjekt – der Spaltung in Subjekt und Objekt Rechnung tragend – sich in der von ihm geschaffenen Welt, in der es als Bild erscheint, wiedererkennt. Vicos Ziel ist aber im Unterschied zu Descartes, die Gesetzmäßigkeiten der mentalen Operationen aufzudecken, die zu dem Selbstbewußtsein des cogito ergo sum führen und die im Ergebnis untergehen. Die Zentralperspektive ist demnach Selbstreflexion menschlichen Konstruierens und die Unsichtbarmachung des Konstitutionsprozesses in einem. Vico kritisiert an Descartes in den Worten Blumenbergs die „unverstandene Anamnesis ihres Ursprungs“. (Blumenberg, 1998, 86, s. Heinz, 1995)
Haben wir es bei Vicos Analyse mit etwas zu tun, das sich mit Freuds Kritik und seinem begriff des Unbewußten vergleichen läßt? Die Frage ließe sich mit ja beantworten, wenn wir annähmen, daß es vor der artikulierten, begrifflichen Sprache eine stumme Sprache gibt, die durch eine vorbegriffliche Identität von Denken und anthropomorphistischer Symbolisierung charakterisiert ist, und daß diese erste Sprache von poetischen Charakteren dem Material der Freud’schen Traumdeutung verwandt ist. Wir hätten es bei Vico mit einer Präfiguration des Freudschen Begriffs des Primärvorganges zu tun. Der Primärvorgang, die „Sprache“ des „Unbewußten“, die in rhetorischen Figuren ihren Ausdruck findet, entspricht dann der poetischen Sprache des Anfangs bei Vico, der Sekundärvorgang, der das System „Vorbewußt-Bewußt“ kennzeichnet, entspricht der artikulierten Sprache der Begriffe. Diese Annahme wird durch den Umstand nahegelegt, daß Freud zur Veranschaulichung seines Begriffs des Traumgeschehens auf die Malerei der Renaissance, insbesondere auf Leonardo und Signorelli rekurriert.
Eine mögliche Korrespondenz zwischen Vico und Freud liegt auch in der positiven Bewertung der Illusion als Trägerin einer Funktion als ein „für die Erfahrung konstitutives Feld. (s. Pontalis, 1998, 93) So wie in Vicos Memoria-Begriff die Phantasie und die Erfindungskraft der ersten „poetischen“ illusionistisch-projektiven Sprache unabdingbar für die Erinnerung ist, so würde nicht nur die Rekonstruktion der individuellen Vergangenheit in der psychoanalytischen Kur ohne das konstruktive Moment der „Erinnerungsphantasie“ unergiebig bleiben, sondern ebenso die Gesetze des Traums, der Fehlleistungen, des Symptoms, der Halluzinationen dem Denken unzugänglich bleiben. Ohne der Existenz eines Bereichs der Illusion könnte das Subjekt sich nicht erkennen. Es würde sich verhärten in der Unmöglichkeit, die Abwesenheit bildlich darzustellen. Das Erkennen ist nur durch das Verkennen hindurch möglich.
Mit dem Vergleich Vicos mit Freud wird abr zugleich der Argwohn gegen jene Künstler nur zu begreiflich, die mit Hilfe der Gesetze der Perspektive Illusionen erzeugen; denn die Täuschereien stehen mit dem Trieb im Bund. Nach Vico besteht das Ingenium, das dem Vermögen der bildlichen Redefiguren zugrundeliegt, darin, Sachen ohne Empfindungen Sinn und Leidenschaften zu geben. Diese Urprojektion – und dies bringt uns zurück zur mimetischen Funktion der Zentralperspektive – zeigt, daß die Tropen nicht bloß eine subjektive, durch Analyse abziehbare Zutat ihnen korrespondierender Objekte sind, sondern schon bei deren Herstellung wirken. Als Selbstprojektionen des Ichs wäre der Metapherngebrauch der Objekte triebgesteuert und vom Lustprinzip bestimmt.
Wenn Freud zur Veranschaulichung des Traumgeschehens auf die Malerei der Renaissance rekurriert, dann drängt sich die Frage auf, ob dies nicht im krassen Widerspruch zu der Aussage steht, daß die Psychoanalyse den Menschen nach der kosmologischen und biologischen die empfindlichste narzißtische Kränkung zugefügt hat, nämlich die Dezentrierung des Bewußtseins, und ob er darum nicht stattdessen besser auf die moderne Malerei hätte rekurrieren sollen, die die Zentralperspektve auflöst, auf den Kubismus beispielsweise. Die Frage ist also, warum sich Freud, der das bewußte Subjekt dezentralisierte, sich an Malern der Zentralperspektive wie Leonardo oder Signorelli orientierte. Man darf dabei nicht verkennen, daß in der mimetischen Funktion der Zentralperspektive zusammen mit dem nachgeahmten Objekt auch das Verhältnis des Subjekts zu seinem Begehren präsentiert wird, so daß wir es bei der Zentralperspektive hier nicht nur mit einer Wirklichkeitsnachahmung zu tun haben, sondern auch mit einem erotischen Modell.
Demgemäß wird durch die Zentralperspektive in einem dialektischen Wechselspiel von Sichtbarem und Unsichtbarem eine Bildrealität hergestellt, die mit dem repräsentierten Objekt auch die Triebwirklichkeit des Betrachters zur Darstellung bringt und damit die Dialektik von Bewußten und Unbewußten als den zwei Modi der Erfahrung, die das Subjekt konstituieren.
Wenn Freud die paradoxen Phänomene der Übertragung, also den Schauplatz, auf dem sich die psychoanalytische Behandlung abspielt, nicht mehr, wie noch zur Zeit der Studien über Hysterie als Mésalliance, als „falsche Verknüpfung“ auffasst, sondern sie als Verkörperung der psychischen Realität anerkennt, dann bewegt er sich ohnehin im Rahmen der Kunst-Moderne, in der die Hervorbringung der Illusion jenen Erfahrungsraum bildet, der dem gespaltenen Subjekt ein Bewußtsein seiner selbst vermittelt. Dann aber drängt sich die Frage auf, inwieweit wir es bei dem perspektivisch konstruierten Raum mit einem durch die Stärke des Imaginären errichteten narzißtischen Raum zu tun haben. Die Identifikation mit dem Bild des anderen – Entstehungsbedingung des Subjekts – bekommt durch den unhintergehbaren Rahmen der Perspektive eine narzißtische Struktur verliehen. Man erkennt dann, daß Leonardos Warnung an den Maler, sich nicht unwillkürlich selbst in seinen Gestalten abzubilden und seiner Empfehlung, dies durch Übung zu kontrollieren, Bedeutung nicht nur im Sinne eines technischen Ratschlags besitzt.
Stockreiter argwöhnt, Freuds Vernachlässigung der Gegenübertragung des Analytikers als Erkenntnisinstrumentarium zum Verständnis des Analysanden lasse sich auf seine Bindung an die apriorischen Voraussetzungen der Zentralperspektive zurückführen. Um die Dialektik von Unbewußtem und Bewußtem in der Entstehung des Subjekts als intersubjektive Erfahrung begreifen zu können, wäre seiner meinung nach die Orientierung Freuds an der zeitgenössischen Kunst, welche zur Zeit der Anfänge der Psychoanalyse die Zersetzung der Zentralperspektive betrieb und die Bildstruktur gegenüber der perspektivischen Erscheinung aufwertete, geeigneter gewesen als der Bezug auf jene Kunstwerke, die ihre Wirkungsintensität der perspektivischen Richtigkeit verdankten. Eine adäquate Bezugnahme auf die Erschütterung des subjektiven Standpunktes durch die Abkehr von der Zentralperspektive und der Auflösung des visuellen Projektionsraums zugunsten der Bildebene und taktiler Raumwahrnehmung in der Kunst am Endes des 19. Jahrhunderts lasse sich auch in der psychoanalytischen Konzeption der projektiven Identifizierung, die erst nach Freud von Melanie Klein und Wilfred Bion entwickelt wurde, feststellen.
Diese beschreibt einen Vorgang, nach dem der Säugling seiner inneren Welt nur dadurch Bedeutung verleihen kann, indem er seine Gefühlszustände, die für ihn selbst nicht erfahrbar sind, in seinem Gegenüber induziert. Das Objekt nimmt dabei die Stelle einer externalisierten Version des unbewußten psychischen Zustands des Säuglings ein, der in einem metabolischen Prozeß durch den anderen die Erfahrung des Eigenen macht. (s. Ogden, 1986, 35) In diesem Vorgang wird die Vorrangstellung des Anderen bei der dialektischen Entstehung des Subjekts erkennbar, die bei der Auffassung des primär narzißtischen Subjekts, das dem zentralperspektivischen Illusionsraum zugrundeliegt, ausgeblendet wird. Lacan nimmt hierauf in seinem Konzept des Spiegelstadiums explizit Bezug. Im eigenen Spiegelbild erfährt sich das Kind erstmals als ganzer Körper und nicht mehr nur als an die Mutter angeschlossenes Partialorgan, aber verkehrt herum. Die Aporie der zentralperspektivischen Methode liegt entsprechend darin, daß sich der geometrische Punkt als Bedingung des durch ihn eröffneten Erfahrungsraums seiner Aufhebung widersetzt; daher bleibt ihm die Einsicht in die Radikalität der Dialektik bei der Entstehung des Subjekts verstellt.
Auf literarischer Ebene hielt es Freud merkwürdigerweise durchaus eher mit den zeitgenössischen Formen. Auf der Suche nach der geeigneten narrativen Form für seine Falldarstellungen stößt Freud auf ein Gebiet vor, das seine eigene ästhetische Ideologie untergräbt und – in Anlehnung an die Unendlichkeit der Analyse – mehr mit dem Schreiben Svevos oder Prousts zu tun hat, als mit den klassischen geschlossenen Formen der Literatur des 19. Jahrhunderts,
Die Bedeutsamkeit der bildenden Kunst – vor allem der der Renaissance – für die Untersuchung unbewußter Vorgänge wird schon in Freuds Arbeit „Zum psychischen Mechanismus der Vergeßlichkeit“ (1898), die sein Vergessen des Namens „Signorelli“ thematisiert, sichtbar. Stockreiters These lautet, daß Freuds Entdeckung des Unbewußten als einer besonderen Denkform in Zusammenhang mit den wissenschaftlich-künstlerischen Errungenschaften der Zentralperspektive einer bestimmten Tradition der Moderne steht und darin auch ihre Grenzen hat. Während die symbolische Funktion des visuellen Projektionsraums Freuds Erforschung des Unbewußten begünstigt, verwehrt ihm seine Ablehnung zeitgenössischer Kunstströmungen, welche die Geltung der linearperspektivischen Gesetze bestritten, die Grenzen der Zentralperspektive in seiner Konzeption des Subjekts zu überschreiten.
(Karl Stockreiter, Der Einfluss der Zentralperspektive auf die Psychoanalyse)
Dienstag, 17. Mai 2011