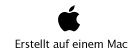stereotypes Unbewußtes
Michael C. Hall spielt den Detektiv, der heutzutage Forensiker sein muß, in der TV-Serie „Dexter“. Der freundliche Blutspurenanalytiker mußte als kleines Kind mit ansehen, wie seine Mutter umgebracht wurden. Daß er als Erwachsener Leute umbringen muß, wird hierauf zurückgeführt. Der Schauspieler findet die Idee interessant, „daß wir Ereignisse in einem präverbalen, vorbewußten Stadium absorbieren, mit denen wir nie rational umgehen können“. Die Serie wird einhellig gelobt, weil sie die verstörendste Figur des amerikanischen Serienfernsehens vorstelle.
Man staunt darüber, daß man zu dem grausamen Racheengel, der „mit seiner grausigen Selbstjustiz einem dunklen Trieb aus der ebenso dunklen Kindheit folgt“. (Nina Rehfeld in der FAZ vom 19.5.2011). Hall erklärt sich dies so: „Wir leben doch in einer Welt, in der wir uns immer machtloser fühlen, und Figuren, die die Dinge in die eigene Hand nehmen, ziehen uns an. Ihre Methoden mögen ethisch fragwürdig sein, aber wir bewundern Leute, die ihren eigenen Regeln folgen, weil das ein Stück Kontrolle suggeriert“. Auch bei der Lektüre von Kerstin Ekmans „Tagebuch eines Mörders“ fühlen wir uns angesprochen, wenn der Held nach seiner Tat bekennt, er fühle sich gut, weil er etwas bewirken konnte.
Allerdings ist sowohl dieser Protagonist kein wirklicher Held, mit dem wir uns identifizieren wollten, sondern ein Psychopath, und auch Dexter ist ein Mann, den seine eigene Emotionslosigkeit und die Leichtigkeit, mit der anderen Gefühle vorspiegeln kann, zutiefst verwirren.
Die eigentliche Qualität der Filmserie mag darin liegen, daß sie uns mit einem synthetischen Unbewußten versorgt. Daß dies geschehen kann, mag darauf zurückzuführen sein, daß das Unbewußte mittlerweile zu etwas geworden ist, das man nicht mehr dem Einzelnen überlassen darf, und mit dem die Menschen nichts zu tun haben wollen. Sie sind heilfroh, wenn ihnen Stereotypen präsentiert werden.
Mittwoch, 25. Mai 2011