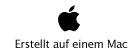Trickster
Die Anthropologen bezeichnen mit dem Trickster einen Typus, wie er z.B. bei manchen nordamerikanischen Indianerstämmen im Kojoten gefürchtet und verehrt wird. Die Figur findet sich in fast allen Kulturen der Welt. In der Mehrzahl der mythologischen Traditionen ist er für das Eindringen des Todes in die Welt verantwortlich. Er hat aber auch die Ungeheuer, die die Erde einst verwüsteten, vernichtet. Indessen bewahrt er auch als prometheischer Kulturheros die spezifischen Züge eines Betrügers. Wenn er das Feuer oder ein anderes dem Menschen unbedingt notwendiges Gut stiehlt, das ein göttliches Wesen eifersüchtig hütet (Sonne, Wasser, Wild, Fische), so gelingt ihm das nicht im heldenhaften Kampf, in dem er totsicher unterliegen würde, sondern mittels Schlauheit und Betrug. Nur mit List oder Täuschung konnte es ihm auch gelingen, die Menschen von den kannibalischen Ungeheuern zu befreien. Er triumphiert über Monstren, ohne sich als Heros zu gebärden. Der Erfolg seiner Bemühungen wird oft durch seine Ungeschicklichkeit in Frage gestellt. Wenn Phaeton durch seinen Leichtsinn die Erde in Brand setzt, dann zeigt er Züge jenes Trickster, wie sich Spuren seines ingeniös-listigen Wirkens auch bei Dädalus und Ikarus finden. Die Ingeniösität ist mit dem Scheitern verwoben, Kühnheit und Mut sind mit Niederlage und Ruin unlösbar verknüpft.
Ein charakteristischer Zug des Tricksters ist seine ambivalente Haltung gegenüber dem Heiligen. Er karikiert und parodiert schamanistische Erfahrungen oder priesterliche Rituale durch seine respektlose Nachahmung, die damit selber schon als Parodien erscheinen, die unwillkürlich in tödlichen Ernst umschlagen können. Die Schutzgeister des Schamanen werden von ihm auf groteske Weise mit seinen Exkrementen identifiziert, und er parodiert den ekstatischen Flug des Schamanen, wobei er selbst am Ende immer abstürzt. Der Trickster macht sich über das Heilige, die Priester und die Schamanen lustig, den Preis für die Lächerlichmachung jedoch zahlt er selbst. Den Göttern ist er nahe durch seine kulturheroische „Uranfänglichkeit“ und seine enormen Kräfte, den Menschen durch seinen unstillbaren Erfahrungshunger und dadurch, daß sein Erfolg auf Betrug der Götter beruht, denen er ihr Geheimnis durch Nachahmung entreißt, auch wenn er dabei fast oder möglichst alles falsch macht oder gerade deswegen. Die Figur des Puck in Shakespeares “Sommernachtsraum” vereinigt die meisten Züge des Tricksters in seinem koboldhaften Wesen. In Diensten des Elfenkönigs Oberon tut er wie ihm geheißen, aber eben nicht akkurat, sondern mit schelmischem Eigensinn und unbändiger Lust daran, alles durcheinander zu bringen, mit ungebremster Schadenfreude. Ein Reflex dieser selbstruinösen Psycho-Logik findet sich bei Kierkegaard, der in seinen Tagebüchern auf die gnostische Sekte der Karpokratianer Bezug nimmt, die es sich zur Maxime gsetzt hatten, so viele Fehler wie möglich zu machen. Erst wenn man das erreicht hat, besitzt man die Reife für das Himmelreich. (Kierkegaard Tagebucheintrag Pap. I A 282 von 1836)
Die Unvollkommenheit der Welt ist die Folge der vorwitzigen Einmischung des Tricksters in den Akt der Schöpfung, die Welt hat aber gerade darum, aufgrund der Verbindung zur teuflischen Unterwelt, am Göttlichen teil. Gerade in ihrer Unvollkommenheit weist die Welt über sich hinaus, während die psychotherapeutisch propagierte Komplettheit der Individuen sie als Idioten in sich selbst einsperrt. Die Ehrenrettung des Mythos vor seiner platonischen Verharmlosung darf die unheroische, schmutzige und monströse Seite der Götter und Halbgötter nicht unterschlagen. Die im Mittelmeerraum verbreitete mythologische Figur des Eros hat übrigens vor ihrer Verharmlosung zum Putto auffällige Ähnlichkeit mit dem Trickster.
Weitgehend unerkannte literarische Spuren des Tricksters finden sich zu Hauf. Die “entwaffnete Kühnheit” Pinochios tritt in begriffliche Konkurrenz mit Nietzsches “Kopflosem”, auch der “Bejahung der Bejahung”, dem “Willen zu Wollen”, zum “Herrn ohne Sklaven”, auch sein “Begehren ohne Mangel” wäre zu nennen – zum Teil Begriffsversionen, die für Deleuze in Nietzsches Konzept des “Willens zur Macht” kulminieren. Der Wille ist dabei notwendigerweise “subjektlos” – eine Intentionalität ohne Intendanten. Gerade deshalb ist seine Wirkung bis zum letzten “wirksam”: Kein Gedanke, der nicht umgesetzt wird, keine Handlung, die nicht eine gewollte ist, werden durch ihn erzeugt. Dieser Wille produziert schöpferisch die Differenzen, die sich zueinander nicht-identisch verhalten, da sie in keinem Augenblick ihrer Entstehung eine Reproduktion eines schon Gedachten oder ein von einem Gott schon Vorgezeichnetes sind. Diese differentielle Kraft schafft einzig und allein “Singularitäten” oder “Ereignisse, die nicht vorhersehbar sind”.
Dienstag, 17. Mai 2011