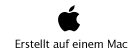Phaeton & Co
Als Phaeton einmal prahlte, dem Sohn der Io nicht nachstehen wollte und auf seinen Vater Phöbus pochte, ertrug es der Inachus-Enkel nicht länger und sprach: „Du Narr, glaubst deiner Mutter alles.“ Da errötete P., und Scham betäubte seinen Zorn. Vor seine Mutter Clymene brachte er die Schmährede des Epaphus. „Und um das Maß voll zu machen, Mutter“, sprach er, „ich Freimütiger, ich Stolzer – habe geschwiegen. Ich schäme mich, daß diese Beschimpfung gegen uns laut werden konnte und daß sie sich nicht widerlegen ließ. Bin ich aber wirklich von himmlischem Stamme, so gib mir einen beweis für diese hohe Herkunft und erkläre, daß der Himmel einen Anspruch auf mich hat.“
Sprach’s, schlang die Arme um den Hals der Mutter und bat sie bei seinem Haupte, bei dem des Merops und bei den Hochzeitsfackeln der Schwestern, ihm Beweise dafür zu geben, daß Phoebus wirklich sein Vater war. Clymene aber – tat sie’s weil Phaeton sie bat, oder vielmehr aus Zorn über das Vergehen, das man ihr nachsagte? – streckte beide Arme zum Himmel, blickte zur hellen Sonne und sprach_ „Bei diesem Licht, das glänzende Strahlen schmücken, das uns hört und sieht, schwör‘ ich dir, mein Sohn, daß du von diesem Sonnengott gezeugt bist, den du schaust und der die Welt ordnet. Wenn ich Erfundenes rede, soll er selbst mit seinen Anblick verweigern, und dieser Tag sei für meine Augen der letzte! Und du brauchst auch nicht lange Mühsal auf dich zu nehmen, um das Heim deines Vaters kennenzulernen. Das Haus, aus dem er aufgeht, ist unserem Lande benachbart; wenn du Lust hast, geh; dann kannst du ihn selbst danach fragen.“
Kaum hat seine Mutter so gesprochen, stürmt P. sofort freudig hinaus; er lebt nur noch in Gedanken an den Himmel, durchwandert sein Aethiopenland, dann das Gebiet der sonnenverbrannten Inder und geht unverdrossen zum Aufgang seines Vaters....
Kaum ist der Sproß der Clymene auf ansteigendem Pfad hier angelangt und hat das Haus des Vaters, an dessen Vaterschaft er zweifelt, betreten, lenkt er alsbald seine Schritte vor das väterliche Angesicht; doch muß er weit entfernt stehen bleiben, denn aus größerer Nähe ertrug er das Licht nicht... Darauf blickt der Sonnengott ... mit den Augen, mit denen er alles sieht, den Jüngling, den die ungewohnten Wunderdinge einschüchterten, und sprach: „Was ist der Grund deiner Reise? Was suchst du in dieser Burg, Phaeton, mein Sohn. Dein Vater verleugnet dich nicht.“ Er erwidert: „Gemeinsames Licht der unermeßlichen Welt, Phoebus, mein Vater, wenn du mir erlaubst, mich so zu nennen, und Clymene nicht unter trügerischer Maske eine Schuld verheimlicht, gib mir ein Pfand, mein Vater, damit man glaubt, daß ich wirklich dein Kind bin, und nimm von meinem Herzen diese Ungewißheit.“ Sprach’s: da legte der Vater den Strahlenkranz ab, der rings um sein Haupt blitzte, hieß ihn nähertreten, umarmte ihn und sagte: „Du bist es wert, daß ich mich zu dir bekenne, und Clymene hat über deine Herkunft die Wahrheit gesagt. Und damit du nicht mehr zweifelst: Erbitte dir ein beliebiges Geschenk, um es aus meinen Händen zu empfangen. Als Zeugen für dieses Versprechen rufe ich den Sumpf an, bei dem die Götter schwören müssen und den meine Augen nicht kennen.“ Kaum hatte er zu Ende gesprochen, da bittet der Knabe um den Wagen des Vaters und um das Recht, einen Tag die Rosse lenken zu dürfen, deren Füße geflügelt sind.
Da bereute der Vater seinen Schwur, schüttelt ... sein lichtglänzendes Haupt und sprach: „Leichtfertig ist mein Wort durch das deine geworden. O wäre es mir erlaubt, mein Versprechen nicht zu erfüllen. Ich bekenne es: Nur dies würde ich dir, mein Sohn verweigern. Doch abzuraten steht mir frei. Was du dir wünscht, ist gefährlich. Etwas Großes begehrst du, Phaeton, eine Gabe, die diesen deinen Kräften und deinen so jungen Jahren nicht entspricht. Dein Los ist es, sterblich zu sein: nicht sterblich ist, was du begehrst. Sogar mehr, als Göttern zuteil werden kann, beanspruchst du in deiner Unwissenheit. Mag auch jeder Gott viel von sich halten, so kann sich doch keiner außer mir auf die feurige Achse stellen. Auch der herrscher des großen Olymps, er, der mit furchtbarer Hand verheerende Blitze schleudert, wird diesen Wagen nicht lenken können: und was gibt es Größeres als Jupiter? Steil ist die erste Strecke des Weges; kaum bewältigen sie die Pferde, obwohl sie am Morgen ausgeruht sind. In der Mitte des Himmels ist die Bahn sehr hoch; selbst ich fürchte mich oft, von dort auf Meer und Land hinabzublicken, und die Brust erbebt mir vor beklemmender Angst. Die letzte Strecke ist abschüssig und verlangt eine sichere Lenkung; sogar Tethys, die mich dann im darunterliegenden Wasser auffängt, bangt oft, ich könnte in die Tiefe stürzen. Außerdem ist der Himmel von einem ständigen Wirbel erfaßt, zieht hoch oben die Sterne mit und dreht sie in raschem Umlauf. Ich stemme mich dagegen, mich überwältigt der Schwung nicht, der alles übrige mit sich fortreißt, und ich bringe meine hohe Fahrt ans Ziel, der heftigen Kreisbewegung des Alls entgegen.... Und du kannst nicht ohne weiteres die Rosse lenken; mit wildem Stolz beseelt sie das Feuer, das sie in der Brust tragen und aus Maul und Nüstern ausstoßen; selbst mich dulden sie kaum, wenn einmal ihr heftiger Mut entflammt ist; und ihr Nacken widerstrebt den Zügeln. Du aber, nimm dich in acht, mein Sohn, daß ich dir nicht ein verhängnisvolles Geschenk geben muß, und solange du noch darfst, berichtige deinen Wunsch. Natürlich, ein sicheres Unterpfand verlangst du, damit du glauben kannst, daß du Blut von meinem Blute bist. Ich gebe dir ein sicheres Unterpfand durch meine Furcht, und meine väterliche Angst um dich beweist, daß ich dein Vater bin. Hier: Sieh mein Gesicht! O könntest du in mein Herz blicken und darin die väterlichen Sorgen entdecken! Und schau dir schließlich ringsum alles an, was die reiche Welt besitzt, und verlange irgendeines der so zahlreichen und großen Güter im Himmel, auf der Erde und im Meer! Du wirst keine Zurückweisung erfahren. Nur dies eine nimm, bitte, aus, das eigentlich eine Strafe, keine Ehre ist; eine Strafe erflehst du dir, Phaeton, als Geschenk. Was umschlingst du meinen Hals, Ahnungsloser, mit schmeichelnden Armen? Zweifle nicht, du wirst alles bekommen, was du dir wünschest (ich habe bei den stygischen Fluten geschworen) – aber wähle einen vernünftigeren Wunsch!“
Er hatte seine Warnung beendet, doch P sträubt sich gegen die Worte, beharrt auf seinem Vorsatz und brennt vor Begierde nach dem Wagen. Solange er durfte, hat der Vater gezögert. Nun führt er den Jüngling also zum hohen Wagen.... Phaeton besteigt den leichten Wagen mit seinem jugendlich schlanken Körper. Schon steht er oben, freut sich, mit den Händen die leichten Zügel zu berühren, und dankt von dort aus dem widerstrebenden Vater. Inzwischen erfüllen die vier geflügelten Sonnenrosse Feurig, Morgenschein, Brand und Lohe die Lüfte mit flammendem Wiehern und schlagen mit den Hufen an die Schranken. Schon hatte Tethys diese aufgestoßen, ohne vom Schicksal ihres Enkels etwas zu ahnen, und den Rossen stand der unermeßliche Himmel offen: Da stürmen sie los, bewegen die Beine durch die Luft, zerreißen Nebelschleier, die ihnen im Wege stehen. Von den Flügeln emporgetragen, überholen sie die Ostwinde, die aus derselben Richtung kommen. Aber das Gewicht war so leicht, so daß es die Sonnenrosse nicht wiedererkennen konnten, und dem Joch fehlte die vertraute Schwere. Wie gebogene Schiffe ohne den rechten Ballast hin und her schwanken und, weil sie zu leicht sind, unstet über das Meer fortgetragen werden, so macht der Wagen, frei von der gewohnten Last, Sprünge in der Luft und wird in die Höhe geschleudert, als wäre er leer. Sobald das Viergespann dies bemerkt hat, stürzt es los, verläßt die ausgefahrene Bahn und läuft nicht mehr geordnet wie sonst. Phaeton ist erschrocken und weiß nicht, wohin er die ihm anvertrauten Zügel lenken soll, auch weiß er den Weg nicht, und selbst wenn er ihn wüßte, könnte er den Pferden seinen Willen nicht aufzwingen.
Damals erwärmte sich zum erstenmal das eisige Gestirn der sieben Dreschochsen am Strahl der Sonne, und sie versuchten vergebens, in dem verbotenen Meer zu baden, und die Schlange, sie, die ganz nahe am eisigen Pol wohnt, vor der sich bisher niemand zu fürchten brauchte, weil sie durch den Frost träge geworden war, wurde warm und bekam durch die Hitze neue Angriffslust... Doch als Phaeton von der höchsten Höhe des Äthers hinabblickte, der unglückliche, auf die Lande, die weit, weit unten hingebreitet waren, erbleichte er,, in plötzlicher Angst erzitterten ihm die Knie, und ungeachtet all des hellen Lichtes senkte sich die Finsternis über seine Augen. Schon hätte er lieber die Rosse des Vaters nie angerührt, schon reut es ihn, seine Herkunft erfahren und seine Bitte durchgesetzt zu haben, schon wünscht er sich sehnlich, ein Sohn des Merops zu heißen. Er wird fortgetragen wie vom rasenden Nordwind ein fichtenes Schiff, dessen Lenkung die verzweifelte Steuermann aufgegeben und das Göttern und gebeten überlassen hat. Was tun? Eine große Himmelsstrecke liegt bereits hinter ihm, eine größere vor ihm. Im Geiste schätzt er beides ab; bald blickt er voraus gen Sonnenuntergang – wohin zu gelangen ihm nicht beschieden ist – bald zurück zum Sonnenaufgang. Wie betäubt weiß er nicht, was er tun soll. Weder läßt er die Zügel los, noch kann er sie anziehen, noch kennt er die Namen der Pferdes. Auch sieht er , bunt über den weiten Himmel verstreut, Wunderwesen und die Bilder riesiger Tiere, die ihm Angst einjagen. ... Überall dort, wo die Erde am höchsten ist, wird sie vom Feuer ergriffen, bekommt Spalten und Risse und dörrt aus, weil ihr die Säfte entzogen sind. Das Gras wird grau, samt seinen Blättern brennt der Baum, und das trockene Saatfeld liefert seinem eigenen Unheil Nahrung.
Doch was ich beklage, ist noch gering! Große Städte gehen mit ihren Mauern unter, und der Brand legt ganze Länder mit ihren Völkern in Asche. Es brennen die Wälder mit ihren Bergen....
Da sieht Phaeton den Erdkreis von allen Seiten in Flammen stehen und hält die gewaltige Hitze nicht aus... Der allmächtige Vater rief die Himmlischen und auch den Geber des Wagens dafür als Zeugen an, daß alles einem schweren Verhängnis zum Opfer fallen werden, wenn er nicht Abhilfe schaffe. Steil steigt er zur höchsten Zinne empor, von wo aus er die weiten Lande mit Wolken zu überziehen pflegt, von wo aus er die Donner erregt und mit Schwung die Blitze schleudert.... dann holt er weit aus – bis zum rechten Ohr- und wirft den Blitz auf den Wagenlenker, raubt ihm zugleich den Stand und das Leben und bezähmt mit grausamem Feuer das Feuer. Scheu werden die Rosse, springen in verschiedene Richtungen, reißen den Hals aus dem Joch und hinterlassen zerfetzte Riemen. Hier liegt das Zaumzeug, dort, von der Deichsel abgebrochen, die Achse, hier die Speichen geborstener Räder, und weit verstreut sind die Reste des zertrümmerten Wagens.
Aber Phaeton, dessen Haar die verheerende Flamme rötet, wird kopfüber hinabgewirbelt und stürzt in weitem Bogen durch die Luft, wie zuweilen ein Stern von heiterem Himmel zwar nicht fällt, aber zu fallen scheint. Fern der Heimat, am anderen Ende der Welt, nimmt ihn der gewaltige Eridanus auf und wäscht sein dampfendes Gesicht. Hesperische Naiaden übergeben den Leib, der noch von dem dreizackigen Blitz raucht, dem Grabhügel, und sie ritzen in den Stein einen Spruch: „Hier ruht Phaeton, der Lenker des väterlichen Wagens; zwar konnte er ihn nicht halten, doch fiel er als einer, der Großes gewagt.“ Ovid, Metamorphosen
Phaetons Übermut war nach humanistischem Werturteil keineswegs verwerflich, sondern, obwohl Phaeton alle Warnungen des Vaters ausschlägt und sich anmaßt, etwas zu können und wollen zu können, was man allenfalls als Erwachsener vermag und was in diesem Fall sogar Nichtsterblichen vorbehalten ist, auszeichnendes Merkmal des Ausnahme-Individuums. Phaeton überflog nicht zufällig den Palazzo Ducale in Sabbioneta, wie auf dem zentralen Deckenfresko festgehalten ist, bevor er in den Eridamus stürzte, wie der Fiume Po in antiken Zeiten hieß, und seine tränenreich klagenden Schwestern zu Pappeln erstarren ließ.
Das Zitat des Phaeton-Mythos im Palazzo Ducale in Sabbioneta ist als poetische Überhöhung der Landschaft und als Huldigung an den genius loci zu verstehen, zugleich aber auch als emblematisches Selbstbekenntnis des Gründers Vespasiano Gonzaga im Sinne der Familien-Emblematik. Die Gonzage auch der in Mantua residierenden Hauptlinie führten in ihren Devisen und Emblemata das Labyrinth und die Figur des Daedalus, die ebenfalls die positive Umdeutung der Hybris in eine Tugend, die virtù erfuhren. Der Vater von Vespasiano Luigi Gonzaga wurde seines Mutes wegen Rodomonte genannt, was soviel wie Draufgänger bedeutet. Mit diesem Namen ging er ein in den „Orlando furioso“ von Ludovico Ariost. In Ariosts Roman ist dieser Rodomonte stark und kühn wie Orlando selbst.
In der Tradition der Ritterromane von Amadis bis Lancelot und Parcival, deren exzessive Lektüre später Don Quijote den Verstand rauben sollte, deren verheerende Wirkung noch in Flauberts Figur der Romane lesenden „Madame Bovary“ nachhallt, verirrt sich Orlando im Wald. In den Wäldern als Ort erotischer Irrfahrten geht die virtù, die Tugend der Männlichkeit, in ihrem eigenen Schatten in die Irre. Die Orlando-Dichtung beginnt mit der Flucht der betörenden sarazenischen Prinzessin aus der Gefangenschaft. In der Einleitungsszene flieht Angelica vor Orlando und Ferrau, während Orlando ziellos auf der Suche nach seinem Pferd umherwandert. Szenen, in denen furchterregende Ritter von ihrem Pferd fallen oder es durch Diebstahl oder Nachlässigkeit verlieren, finden wir ebenfalls in allen Ritterromanen. Diese Ritter ohne Pferd sind dank einer platonischen Analogie zwischen Reitkunst und virtù eine Allegorie für den Umstand, daß sich jemand momentan seiner Manneskraft und in weiterem Sinn der Orientierung, des rationalen kritischen Bewußtseins beraubt sieht. Diesem Vergleich zufolge ist die “tugendhafte” (die mit virtù begabte) Seele, Organ der Selbstbeherrschung: Das Bild ähnelt dem des Phoebushaften Wagenlenkers, dem es gelingt, seine beiden Rosse (Willen und Intellekt) auf gerader Bahn zu halten oder eben nicht.
Als Ferrau, der ebenfalls sein Pferd verloren hat, sich an einem Fluß zum Wasser hinabbeugt, um seinen Durst zu löschen, fällt sein Helm, den er vorher Orlando gestohlen hat, ins Wasser. Dies Mißgeschick kündigt symbolisch an, daß Orlando seinen Kopf, also den Verstand verlieren und wahnsinnig werden wird. Der Wald ist der Ort des Selbstverlustes, dort sind die Ritter Kräften ausgeliefert, die sie nicht kontrollieren oder lenken können, von denen sie häufig nichts wissen und deren Verführungskraft den verborgenen Tiefen ihrer eigenen Psyche und ihres Trieblebens entspringt.
Sein Ausbruch ist das narrative Zentrum einer sich immer wieder verlierenden, beständig abirrenden Erzählung. Orlandos Raserei in den Gesängen XXIII und XXIV bildet die Mitte der Dichtung, zerstört aber zugleich jeden Begriff eines Zentrums und verwandelt es stattdessen in einen Strudel von Selbstenteignung, einen Maelstrom, der das Begehren in einen Abgrund von Irrationalität und Gewalttätigkeit zieht.
Am Anfang dieses Strudels dieser sich aller Kontrolle entwindenden Bewegung steht die Zurückweisung Orlandos und der Umstand, daß Angelica sich in Medoro verliebt. Orlando wird darüber zum Rasenden, seine Raserei verleiht ihm übermenschliche Kräfte, die er jetzt gegen den Wald selbst entlädt. Mit bloßen Händen entwurzelt er riesige Eichen und spaltet ihre Stämme. Er verwüstet den ganzen Wald, der nie wieder einem Hirten oder seinen Herden Schatten spenden wird. Von dem großen Lärm aufgeschreckt, der aus den Wäldern dringt, versammeln sich die Hirten, um zu sehen, was da vor sich geht. Als sie den rasenden Roland erblicken, laufen sie davon. Doch Orlando holt sie ein, er fängt einen von ihnen und reißt diesem Unschuldigen mit einer Leichtigkeit den Kopf ab, mit der man einen Apfel vom Baum pflückt. Dann benutzt er den kopflosen Leichnam, den er an einem Bein hält und im Kreise schwingt, um die anderen Hirten zu prügeln. Damit Orlando wieder ausgerichtet werden kann, reist Astolfo zum Mond, um die Bruchstücke des entfremdeten Hirns zurückzuholen.
Da der Autor des Romans wie seine zeitgenössischen Leser der humanistischen Mode frönten, muß man annehmen, daß für sie “rasend” nicht nur auf einen cholerischen Charakter, auf physische Stärke und eine Veranlagung zur Brutalität hinwies, auch nicht auf Wahnsinn als Defekt, sondern daß man Wahnsinn als außerordentliche geistige Leistung und intellektuelle Begabung ansah und ihn verherrlichte als eine Verbindung von physischer Stärke mit einem geistigen Ausnahmetalent, mit einer genialischen Disposition, die sich notfalls auch im einsamen Gegensatz zur restlichen Menschheit und besonnener Vernunft behauptet. Die ruinöse Verirrung Orlandos wurde nicht gewertet als familiärer Skandal, sondern als besondere Riskobereitschaft und Folge nicht von Verantwortungslosigkeit, sondern als Ausdruck von Mut und Tollkühnheit.
Bei allen mythischen Gonzaga-Helden haben wir es mit ebendieser doppelten Konnotierung zu tun, von desaströsem Übermut und geistigem Höhenflug, ruinöser Unternehmungslust und Kühnheit, die einer Person zugestanden wird, die – wie auch in den Gestalten von Daedalus und Ikarus - selbst die Gefahr nicht scheut, bei zu großer Annäherung an die Sonne, als reine Idee und Licht der Erkenntnis sowie als Feuer der Triebhaftigkeit zugleich - zu verbrennen und abzustürzen, und sei es auch, daß er nicht nur wie Orlando einen Wald verwüstet, sondern gleich die halbe Welt in Brand setzt. Die Renaissance hält damit den Anschluß an die griechische Antike.
Dienstag, 17. Mai 2011