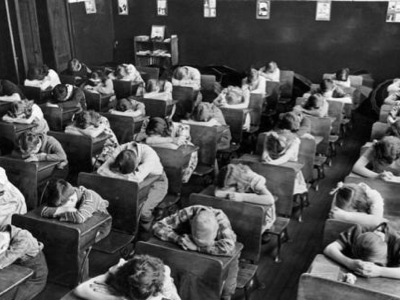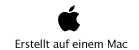der sokratische Narr
In ihrer hintergründigen, ironischen Humorlosigkeit oder humorlosen Ironie erinnern Don Quijote, Till Eulenspiegel, Jesus, Pinocchio und Deltschev aus dem Kriminalroman von Eric Ambler an Sokrates. Nicht der von Platon erfundene, sondern der vorplatonische Sokrates hatte sich auf die Suche nach Freiheit begeben. Nach der Freiheit von Meinungen und Urteilen, die ihm allesamt Vorurteile waren. Vorurteile nicht erst als Meinung zu etwas, sondern indem sie monologisch gewonnen und dekretiert wurden. Er selber besteht auf dem Dialog, bei dem etwas Drittes zustandekommt. Mit seiner Methode der Maieutik, der Geburtshilfe, wollte er aus seinem Gegenüber durch Fragen dessen Überzeugungen herausholen. Man sollte ihm erklären, was man meint, wenn man Frömmigkeit sagt, Tugend, Tapferkeit oder Gerechtigkeit, Schönheit, um dann selber die Aporien erkennen zu müssen, in die man sich zwangsläufig verrannt hat. “Sein Zweifeln beruhte auf dem Staunen darüber, daß es Menschen gibt, die davon überzeugt sind, etwas genau zu wissen. Er sah in solchen Menschen Gefangene ihrer Meinungen, und von diesen wollte er sie durch die Geburtshilfe seines Fragens frei machen. Wer sich, verlockt durch das Fragen, auf den Weg aus seinem Gefängnis macht, wer in sich den Eros des Suchens entdeckt und sich von ihm leiten läßt, der gerät unvermeidlich in Sackgassen, Aporien, verliert den Faden, kennt sich selbst nicht mehr aus. Die Freiheit, derer er sich dabei bewußt werden kann, ist die, sich mit seinem Nichtwissen und Nichtkönnen zu identifizieren.” (Klaus Heinrich)
Sokrates Philosophie war mit seiner Person verknüpft. Er nahm Geld dafür, daß er etwas mal recht und mal unrecht erschien lassen konnte. Das war riskant. In den Augen der Ordnungshüter des Staates galt dergleichen als Skandal. Platon stellte sich auf die Seite des um seine Sicherheit besorgten Staates, indem er Logik und Weisheit als etwas formulierte, das außerhalb von ihm selbst existiert und das vom Einzelnen erkannt und anerkannt werden kann.
Verdeutlichen wir die Differenz zwischen Sokrates und Plato anhand von Till Eulenspiegel, über den Klaus Heinrich schrieb: “Er nimmt, verfremdend, selbst an der Entfremdung teil. Er beginnt als Konformist (sonst hätte er sich nicht in jedermanns Vertrauen geschlichen, sonst wäre er an seine “Schüler” nicht herangekommen) und endet als Konformist; richtiger: als der einzige, der wahre, der durch sein Verhalten die Wahrheit über den Konformismus an den Tag bringt. Er spaltet die Welt nicht in Täter und Opfer, Sündenböcke und Verführte, sondern überführt die Opfer ihres Opferseins. Doch in dem Moment werden sie als die Täter kenntlich. Eine kleine Geste unterstreicht ihre Täterschaft: Obschon sie seine Schüler sind, die er belehrt, weiß er ihnen die Rolle des Auftraggebers zuzuschanzen. Freiwillig haben sie das verordnet, was er als Zwang zuende führt. Dies wirft ein Licht auf beide: Freiwilligkeit und Zwang. Der Sog, den die Geschichten, und gerade die bösartigsten unter ihnen, bis heute haben, ist nicht nur einer, wie er allem zwanghaften Geschehen zukommt. Es ist die Bewegung der Selbstzerstörung in ihnen, der oft der Demonstrierende selbst nur mit knapper Not entrinnt.” (35)
Das Schema aller seiner Geschichten macht sie zu “erkennender Darstellung” oder “dargestellter Erkenntnis” der verkehrten Welt. “Die scheinbar richtige verfremdend, machen sie diese als eine entfremdete sichtbar.” Heinrich sieht in der Rolle des mittelalterlichen und des antiken Narren wie in den Bildern der “verkehrten Welt” eine noch ganz unausgeschöpfte Fundgrube solchen darstellenden Erkennens. Zum Beispiel Sokrates war vielleicht ein eulenspiegelhafter Mann, wie Klaus Heinrich mutmaßt. Aristophanes suchte ihn in einem Angriff als einen zwischen Himmel und Erde hängenden Phantasten unschädlich zu machen. In seinen “Wolken” läßt er Sokrates in einem Korb über der Bühne hängen, zwischen Himmel und Erde, er führt ihn vor als Priester eines philosophischen Pseudomysteriums und läßt am Ende seine Denkschule niederbrennen. Aber der Angriff ging fehl. “Denn Sokrates trug keine Lehre vor, er verkörperte sie.”
Eulenspiegel, den seine Lehrherren als verstockten Bösewicht vertreiben und hinter dem sie sich bekreuzigen, lebt riskant. Er ist kein bloßer Wortverdreher. Er spricht auch nicht von außerhalb der verkehrten Welt in Metaphern und mit Fabeln, sein Sprechen ist ein Gefährdetes mitten in ihr – glücklicherweise eines, das sich keine Illusionen macht, wie es Eulenspiegels rasche Flucht nach jedem seiner “lustigen” Streiche beweist.” Pinocchio allerdings flieht nie rechtzeitig, er macht sich Illusionen. Er ist ganz und gar verstockt, wie in Eulenspiegels Wörtlichnehmen nur die Worte. Bei einem, der ganz aus Holz ist, freilich kein Wunder. Aber diesen Narren, der stillhält, wenn er Watschen einfängt, mit Sokrates zu vergleichen, grenzt das nicht an Blasphemie?
Foucault wie Deleuze betätigen sich als sokratische Narren, indem sie die Leser dazu verführen, das Gefängnis des Episteme, des gerade gültigen Denkregimes zu durchbrechen. Die sokratische Personwerdung geschieht im Dialog. Dieser Dialog führt einerseits zur Einsicht in die eigene Unzulänglichkeit, macht es aber zugleich möglich, sich in dieser Unzulänglichkeit als souverän zu erfahren.
Dienstag, 17. Mai 2011