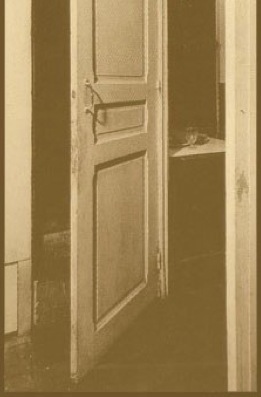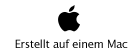Türen und Fenster
Breton berichtet, wie er und Nadja "erneut am Eisengeländer entlangwanderten, als Nadja sich plötzlich weigerte, weiterzugehen." Sie konnte ihre Augen nicht lösen von einem „niedrig angebrachten Fenster oberhalb des Kanals", von dem "alles mögliche ausgehen konnte. Es ist hier, wo alles beginnt" (85). Solch eine Äußerung scheint überfrachtet mit Bedeutung. Das Fenster wird behandelt als ein zweidimensionales Objekt, aber zugleich als Portal zu alternativen metaphorischen Assoziationen, die Nadjas mystisches, transzendentales System von Bedeutungen implizieren. Nadjas Fenster als ein mystisches Objekt, das unübersetzbar ist in die Alltagswelt, verhält sich parallel zu Bretons Insistieren auf Nadjas Flucht aus den konventionellen metaphorischen Mustern, die Bedeutung generieren. Die wahre Heimsuchung, der wahre Geist ist Nadja, die beständig dem Zugriff des Analysierenden entflieht, der sie auf den Begriff bringen will, und die selbst heimgesucht wird von dem, was sich möglicherweise nicht auf das Spiel von Licht und Dunkel auf dem Rechteck des Fensters reduzieren läßt. Breton hatte anläßlich der Begegnung gefragt: Wer bin ich? Er kommt zu dem Schluß, die "anspruchsvollere" Antwort lautet: "Daß, wenn die Frage nach dem ,Wer bin ich?' nicht beantwortet werden kann, dafür um so stärker die Idee des Transsubjektiven, Interaktiven eintritt. In der deutschen Übersetzung heißt es: „Wer bin ich? Wenn ich mich ausnahmsweise auf ein Sprichwort beziehe, warum kommt in der Tat nicht alles darauf an, mit wem ich umgehe.“ Bei der Übertragung des französischen Wortes ‚hante’ in das deutsche Wort ‚mit jemandem umgehen’ geht freilich die Nebenbedeutung des Verhexens verloren, so daß es, auch wenn das dann nicht mehr einer im Deutschen gebräuchlichen Redewendung entspräche, vielleicht besser wäre zu sagen: wen ich heimsuche? (haunt und haunted). Das Original lautet: Qui suis-je? Si par exception je m’en rapportais à un adage: en effet pourquoi tout ne reviendrait-il pas à savoir qui je „hante“? Je dois avouer que ce dernier mot m’égare, tenant à établier entre certains ètres et moi des rapports plus singuliers.
Nadja, die den Erzähler verfolgt und die er vielleicht auch verfolgt, repräsentiert und demonstriert die Kernpunkte des surrealistischen Manifests. Im Vorwort für einen Nachdruck schrieb Breton: „Ich glaube ganz einfach, daß zwischen meinem Denken, so wie es aufscheint in dem Material, das Menschen lesen können, das meine Signatur trägt, und mir, wobei die wahre Natur meines Denkens involviert ist in etwas durchaus Präzisem, das ich noch nicht weiß, daß es da eine Welt gibt, eine nicht wahrnehmbare Welt der Phantasmen. Das Ziel der Surrealismus ist, überall Phantome zu wecken" (S.35)
„Anstatt die Programmatik des Individuums zu festigen, erschüttern Bretons Phantome aus dem Jenseits unsere subjektive Sicherheit. Zufalls-Gegenstände der Alltagswelt, auf die man stößt auf dem Schuttabladeplatz oder in Cafés, exemplifizieren nicht mehr die determinierte Natur des Selbstbewußtseins, sondern spornen eher die Realisierung von etwas Neuem und Schockierendem an. Die „konvulsivische Schönheit“, die sie zur Schau tragen, hilft uns, die Konventionen abzuschütteln: ein Bewußtsein kreierend, in dem das Individuum sich repräsentiert als reine Subjektivität und zugleich, ohne daß dies paradox wäre, als reine Dynamik, die sich durch die Handlungen definiert." (Chenieux-Gendron, Jacqueline. Surrealism. Trans. Vivian Folkenflik. New York: Columbia UP, 1990. S. 90 ).
Die von Breton identifizierten Geister entfernen das Subjekt von überdeterminierender Kategorisierung, indem es charakterisiert wird als unvorhersehbares Resultat wie ein Fund (object trouvé), als Ergebnis der Zeit, die man auf dem Flohmarkt herumstreunend zugebracht hat.
Die Trope des Fensters bildet eine Spur sowohl zu den Überlegungen für eine surrealistische Revolution als auch zu Bretons literarischer Verrätselungstechnik. Der Witz dieser Trope gipfelt in der rätselhaften Geschichte von dem Mann, der die Concierge bittet, seinen Schlüssel aufzubewahren, um ihn davor zu bewahren, seine Zimmernummer zu vergessen, Eine Minute später erscheint derselbe Mann am Rezeptionstresen, völlig aufgelöst, seine Kleider über und über mit Matsch verdreckt, blutend, sein Gesicht konnte man kaum noch ein Gesicht nennen, und sagt: "Monsieur Delouit." - "Was meinen Sie mit Monsieur Delouit? Versuchen Sie nicht, mir etwas vorzumachen! Monsieur Delouit ist gerade die Treppe hinauf gegangen!" - "Es tut mir leid, das bin ich... Ich bin gerade aus dem Fenster gefallen. Was bitte ist die Nummer meines Zimmers?" (Nadja 156)
Das Fenster ist der Ort, wo das Cartesianischen Subjekt ausgehandelt wird (der verläßliche Agent des "Ich") und das determinierende soziale Netzwerk (das heimtückisch programmierende "Denken"). Das Zimmer ist ein Korrelativ des objektiven Selbst, aus dem das surrealistische Subjekt hervorgeht. Die Grenzen zwischen dem Möglichen und dem Realen zu testen, erfordert radikale Gelegenheiten, das Leben von dem organischen Plan zu befreien, sei es auch um den Preis, auf das Pflaster aufzuschlagen und buchstäblich das Gesicht zu verlieren. Aus dem Fenster zu stürzen ist eine Metapher für den gefährlichen Schritt, der Architektur zu entkommen, die gleichzeitig sowohl die Revolte als auch ihren Kontext konstruiert und reguliert.
Die surrealistische Tat besteht in der demonstrativen Übertretung, in der Empörung gegen Beschränkungen. Leben ist da, wo sich gegen Kontrollmechanismen und Denkverbote, Selbstdisziplin und Verinnerlichung von Normen die Lust am Verstoß regt. Im Akt der Übertretung zeigt sich das vitale Bedürfnis des Menschen, seine Souveränität zu erproben.
Nietzsche könnte die Stichworte gegeben haben, wenn er feststellte, daß Erfahrung der Übertretung bedürfe, zumindest das philosophische Wissen werde nicht auf dem Boden schematischer Erfahrung gewonnen. „Es ist dem Menschen im Tiefsten wesentlich, daß er sich selbst eine Begrenzung setzt, aber mit Freiheit, d.h. so, daß er diese Begrenzung auch wieder aufheben, sich außerhalb ihrer stellen kann.“
Die Romane Dostojewskijs sind voller Grenzorte, Zwischenräume, Lücken, Treppenhäusern, Kellerabgänge, Türschwellen. Raskolnikow beispielsweise lebt an einem solchen Ort. „Sein enges Zimmer, der sogenannte ‘Sarg’ (für Michail Bachtin ein karnevaleskes Symbol) geht direkt auf den Treppenabsatz hinaus. Seine Tür pflegt er, selbst wenn er fortgeht, niemals abzuschließen; der Innenraum, den er bewohnt, ist also von der Außenwelt nicht eigentlich abgegrenzt. In diesem ‘Sarg’ kann man kein biographisches Leben führen. Hier kann man nur Krisen durchleben, letzte Entscheidungen treffen, sterben oder wiedergeboren werden. Auf der Schwelle, in einem Durchgangszimmer, das direkt auf die Treppe hinausgeht, lebt auch die Familie Marmeladow... Die Schwelle, die Diele, der Korridor, der Treppenabsatz, die Treppe, die Treppenstufen, die zur Treppe hin geöffneten Türen, die Hoftore, die öffentlichen Plätze, die Straßen, die Fassaden, die Spelunken, die Brücken, die Wassergräben: das ist der Raum dieses Romans. Dagegen fehlt fast ganz das Interieur der Salons, Eßzimmer, Säle, Arbeitsräume, Schlafzimmer, in denen das biographische Leben abläuft, in denen sich die Ereignisse der Romane von Turgenew, Tolstoj und Gontscharow entwickeln.“
Dostojewskijs Räume sind Krisenräume, in denen aller privater Schutz schwindet und die Zeit still zu stehen scheint. Es handelt sich um Orte, an denen sich Katastrophen ereignen oder anbahnen, Wechsel vollziehen, das Unerwartete und Unerhörte eintritt, wo Grenzen überschritten, Verbote übertreten werden, an denen Anfang und Ende, Geburt und Tod einander begegnen, an denen in allem auch das Gegenteil enthalten scheint. Es sind weniger positiv fixierte Orte, als vielmehr negativ bestimmte Nicht-Orte, Löcher im Raum-Sinn-Kontinuum, Lücken, Risse in der Ordnung der Dinge.
Ein Film von Robert Wise von 1957 „Kein Platz für feine Damen“ spielt in einem Nachtclub, der in drei Bereiche unterteilt ist, das Büro, die Küche und den Speisesaal mit der Bühne. Diese drei Bereiche sollen dem Reglement des Etablissements zufolge strikt voneinander getrennt bleiben. Die Handlung bringt es jedoch mit sich, daß gut 130 mal die Türen geöffnet werden und die Personen nie an ihrem Platz sind, wenn man sie sucht. Dafür platzen sie stets in eine Szene, in der sie nichts zu suchen haben.
Der Einzelne hat in die Prinzipien keinen Einblick, nach denen trotz all der umfänglichen Registraturen das Leben immer weiter in seine einzelnen Funktionsbereiche zerfällt, was umso mehr erfahren wird, als sie durch die Form und das Ausmaß der rationalen Organisation zwar miteinander verbunden sind, aber auf eine für den Einzelnen nicht einsehbare Weise, quer zu seinen eigenen Bedürfnissen und Wahrnehmungsmustern, gleichsam hinter ihrem Rücken.
Adalbert Stifters Erzählungen, in denen man häufig Wanderern begegnet, die, am Ziel angelangt, sofort die Tür des ihnen angewiesenen Zimmers verschließen, um darauf die durchwanderte Landschaft durch das geöffnete Fenster zu betrachten. So als könnte man erst geborgen vor der Wirklichkeit in ein Verhältnis zu ihr treten, ohne die Selbständigkeit ihr gegenüber zu verlieren.
Das christliche Mittelalter erhöhte die Symbolik der Tür, indem es sie auf Themen wie die Verkündigung, die Heimsuchung oder den Einzug Christi verweisen ließ; für Aufbruch und Ankunft zitierte man das Stadttor Jerusalems oder die Vertreibung aus dem Paradies. Die Malerei kennt daneben auch die Erscheinung des Herrn oder das Erscheinen eines Engels bei verschlossenen Türen, wie der Film das entsprechende von Fantomas oder Heurtebise.
Die Tür von Duchamp ist surrealistisch, indem sie den einen Raum absperrt, den Zugang zu dem anderen öffnet.
Dienstag, 21. Juni 2011