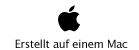die Angst der Modernen
Starke und umschließende, geschlossene Formen waren der Moderne verdächtig und sind seither ideologisch verpönt, obwohl wir auf dergleichen zumeist positiv reagieren, umso mehr, als wir sie zunehmend vermissen und in traditionellen Städten im Urlaub aufsuchen. Die moderne Avantgarde war obsessiv mit der Öffnung, Perforierung und Immaterialisierung der Wände beschäftigt. Neoromantische literarische Alpträume, die gleichzeitig in Mode waren, bezogen ihre Beklemmung aus übermäßig abgeschlossenen Räumen. Dabei bereitet uns Offenheit nicht weniger Unbehagen. Der grufthaften Hermetik der „Philosophy of the Furniture“ mit den karmesinfarbenen Vorhängen, dem Raben Nevermore und der tödlichen Identifikation von Geschlecht und Haus im „Usher“ stehen die Verstörungen aufgrund mangelnder Fixierung bei Kafka gegenüber.
Die Auflösung der Wiederauffindbarkeit und Identizifizierbarkeit der Räume, so daß nicht mehr erwartbar ist, was sich in ihnen vollziehen kann, und die fehlende Abgrenzung unterschiedlicher Handlungssphären erfährt man als Verlust von Sicherheit und als Aushöhlung der persönlichen Identität. Die bloße Betretbarkeit des Raumes wird zum Ausgeliefertsein, je weniger der Raum Handlungen differenziert, desto weniger sichert er Erwartungskonstanz. Das bereits bei Flaubert gestörte Verhältnis von Räumen und Handlungen – die Liebeserklärung auf der Landwirtschaftsausstellung in der „Mme Bovary“ - wird bei Kafka vollends dissonantisch. Die Verwirrung aufgrund des Abhandenkommens dieser fundamentalen Ordnungsleistungen von Ortsmarkierung und Grenzziehung wird in Kafkas Prozeß physisch greifbar. Räume wechseln beliebig ihre Bestimmung. Das Gericht tagt auf dem Dachboden, das Zimmer der Pensionsnachbarin Fräulein Bürstner wird als Verhandlungsraum benutzt. Kafka gestaltet die Auflösung der Schutzfunktion der Räume, die durch ihre klare Begrenztheit und ihre Lokalisierung und Auffindbarkeit, vor allem aber durch die eindeutige Zuordnung von Räumen und Funktionen gegeben ist und deren Mangel bei Josef K. allein schon das Gefühl des Angeklagtseins ausgelöst haben könnte. „Der Prozeß gegen Josef K. wird mitten im Alltag in Hinterhöfen, Warteräumen usw. an immer anderen, nie zu gewärtigenden Orten verhandelt, in die der Angeklagte sich oft mehr verirrt als begibt. So befindet er sich denn eines Tages auf dem Dachboden. Die Emporen sind voll von Leuten, die dicht gedrängt der Verhandlung folgen; sie haben sich auf eine lange Sitzung vorbereitet; aber da oben ist es nicht leicht auszuhalten; die Decke - die bei Kafka beinah immer niedrig ist - drückt und lastet; so haben sie denn Kissen mitgenommen, um den Kopf dagegen zu stemmen.“ (5)
In den bürokratischen Labyrinthen einer Welt aus Kanzleien und Registraturen gewinnt ein beliebiges Zimmer absolute Autonomie. Das Rahmensystem der einzelnen Verfahren wird negativ zitiert zur Darstellung der Unmöglichkeit, jemals zur Entscheidungsinstanz vorzudringen. Gleichzeitig ist das System auch in seinen schäbigsten Repräsentanten gegenwärtig. Das Verfahren, das eigentlich sichern muß, daß der Richter kein Zahnarzt oder Losverkäufer ist, schließt gerade diese Sicherheit aus. Es hat immer schon angefangen. Man kann nur zu spät kommen, und man wird nie mehr erfahren, ob man selbst überhaupt gemeint war. Mit jeder Frage macht man sich mehr verdächtig und verstrickt man sich tiefer in einen fiktiven und zugleich tödlich realen Schuldzusammenhang.
Kafkas Unbehagen angesichts des Effektes der Auskugelung der Raum-Sinn-Gelenke ereilt uns noch heute, womöglich mehr denn je, während dasjenige, das Unbehagen, das von extrem übermäßig fixierten und kartierten Räumen herrührt und ihrer Geschlossenheit zugeschrieben wird, uns seltsam abgestanden und überholt vorkommt. Denken wir an Dr. Mabuse, der mit „1000 Augen“ über ein Hotel wacht, aus dessen Zimmern ihm versteckte Kameras Bilder auf sein Schaltpult liefern. Das ganze Gebäude ist auf einen Blick verfügbar, wie auf einem Grundriß. Ordnung stellt sich immer als Ausrichtung auf ein Machtzentrum dar. Räume werden zu Kerkern und Menschen ihre Gefangenen, sobald der kurze Augenblick gefunden ist, da ein Leben außer Kontrolle gerät, dazu verdammt, sich selbst zu zerstören. Eine zu enge, jeden freien Willen zur Chimäre machende Verknüpfung von Raum und Handlung, wie man sie auch von anderen Fritz-Lang-Filmen kennt, die ausnahmslos von Menschen in unausweichlichen Situationen handeln, berühren uns nicht mehr.
Woher nahm die Avantgarde die Gewißheit, auf dem Weg in die Zukunft zu sein? Wenn man sich heute die Diskussionen ins Gedächtnis ruft, die nach dem Krieg über die Entnazifizierung Deutschlands geführt wurden, fragt man sich, wie man damals so sicher sein konnte, zu wissen, welche Architektur der Demokratie günstig ist. Man verband mit einer heute grotesk wirkenden Überzeugung mit den Entwürfen von Le Corbusier und Scharoun unneurotische Liberalität. Ihre Entwürfe hielt man als die Antwort auf die Frage nach den Vorbedingungen der Demokratie und danach, wie sie stabilisiert werden können.
Wenn wir sehen, mit welchen formalen Eigenschaften man diese ethische und politische Aufgabe von Stadtplanung und Architektur erfüllen wollte, Zeilenbau, Orientierung Licht und Luft, Zurückhaltung der Form, Exorzismus des Ornaments mäandernde Fußwege und Straßen, und strikte Trennung von Auto- und Fußgängerverkehr, Wohnen und Arbeiten, dann dies alles Prinzipien, die aus guten Gründen wieder aufgegeben wurden zugunsten der Rückkehr zu Blockrandbebauung und erhöhter urbaner Verdichtung. Nicht auszudenken, daß ganz Berlin so antiurban hätte aussehen sollen wie das Hansaviertel und so peripherieartig wie die Viertel östlich des Alexanderplatzes.
Funktionstrennung und Zonierung wurden als ideologische Prinzipien aufgefaßt, die alle formalen Eigenschaften der Moderne bestimmten. Bei kritischer Beleuchtung allerdings wird das Dogma der Differenzierung von Zonen mit monokultureller Nutzung erkennbar als nervöse und neurotische Reaktion auf ein Übermaß an Offenheit, als tatsächlich konservative Reaktion auf ein kafkaeskes Zuviel an Offenheit.
Es ist vor allem Le Corbusier, der sich in seinen Äußerungen verrät. Er, der Straßen und Plätze aus seinen Plänen verbannte, der das Landhaus mit freiem Blick auf die Natur für alle und himmelhoch gestapelt wollte, er haßte in eigenen Worten das „theatralische Gewimmel“ der alten Stadt. Der Anblick so vieler Menschen, "Gesichter und Begierden" sollte den Bewohnern seiner „strahlenden Stadt“ erspart bleiben. Sie sollten durch die gläserne Wand einer luxuriösen Klosterzelle die in die Stadt hineinkomponierte Landschaft, "Ruhe, Einsamkeit und Licht" genießen können.(x) Daß in seiner optimistisch klingenden Zukunftsvision latente Angst zum Ausdruck kommt, wird deutlicher in der folgenen Passage: „Das Problem liegt darin: Alles ist heute in den Städten durcheinander. Die oben genannten Faktoren, die aufeinanderfolgende Eigenarten des Lebens darstellen, sind im Gegenteil aufeinandergehäuft und untereinandergemengt; das eine kompromittiert das andere und nichts geht mehr.“ Die „städtischen Mischungen“ wurden als Chaos empfunden, gegen das man Ordnung setzen müsse. Die städtische Umwelt der vormodernen Stadt ist eine, in der „Planlosigkeit wütete“.
Als Therapie-Rezeptur sah er den der Industrie abgeguckten „Willen nach Organisation“. Man solle das, was sich tatsächlich täglich in einer Großstadt vollzieht, rein herausarbeiten und so organisieren, daß die Reibungsverluste vermindert werden und die Einzelteile sich nicht gegenseitig hemmen oder blockieren, Man solle die Leistung der Stadt erhöhen. „Die Stadt wird den Charakter eines im voraus durchdachten Unternehmens annehmen, das den strengen Regeln eines allgemeinen Planes unterworfen ist. Kluge Voraussicht wird ihre Zukunft ... und das Anwachsen der Bevölkerung wird nicht mehr zu diesem unmenschlichen Gedränge führen, das eine der Plagen der großen Städte ist“. „Der tägliche Zyklus der Aktivitäten“ in den Stadträumen sollte sich als „Kette von Operationen“ vollziehen dürfen, wie das in den modernen Fabriken Nordamerikas zu bewundern war.
Die Entmischung der Nutzungen nach dem Muster der innerbetrieblichen Organisation gilt als Inbegriff von heilender Ordnung. Le Corbusier in seinem Kommentar zur Ville Radieuse: „Die Organisation der kollektiven Funktionen der Stadt wird die individuelle Freiheit bringen. Ein Mensch, diszipliniert in seinen Beziehungen zum Ganzen“. Und an anderer Stelle: „Bei Ford ist alles Zusammenarbeit, Einheitlichkeit der Absichten, Einheitlichkeit des Ziels, Übereinstimmung der Totalität der Gesten und Gedanken“.
Das vordergründige Motiv der Leistungssteigerung durch Fordisierung, mit der die Industriellen Michelin, Thomas Bat’a oder Henry Ford ihrer Belegschaft den „Krieg gegen Verschwendung und Verlustzeiten“ erklärt hatten, wird von Le Corbusier adaptiert, um den Reibungsverlusten in der „strahlenden Stadt“ den Kampf anzusagen. „Die diabolische Tyrannei der Unordnung versäumt keine Möglichkeit zum Handeln; es genügt, daß ihr Gelegenheit geboten wird durch die mißglückte Anordnung von Gebäuden und Zugangswegen, z.B. durch die Unterbrechung zusammenhängender Folgen oder das unangebrachte Vorhandensein von Wegen, Straßen, Plätzen, Alleen etc., die zu nichts anderem dienen, als zum Vorwand zu werden für Spaziergänge, unnützen Verkehr von Produkten und Materialien ...“
Was als Freiheit und Offenheit proklamiert wird, soll in Wahrheit eine Freiheit und Offenheit sistieren, die in der Stadt wüten. Es ist der Blick aus dem Flugzeug auf dem Weg von einem Vortragsort zum anderen, der beruhigt und das Modell für Planung abgibt: „Der Mensch ist eine Ameise mit den Gewohnheiten eines präzisen Lebens, einem einheitlichen Verhalten.“ Wovor er eigentlich Angst hat, die abwehrt werden muß, das ist die Börse. Das Gewimmel wird synonym für den Markt, für Spekulation. Das negative Schreckbild der modernen Avantgarde sind jene Straßen um die Börse herum, die beherrscht werden von einer „motley crowd, who all day long make the neighbourhood hideous with their shoutings, yellings and quarrelings. the sidewalk is impassable because of boistereous overflow of commotion. they speak all at once, yelling and screaming like hyenas. The pandaemonium cannot be wilder. Hier lauert der dämon aller dämonen.
Am Anfang der Zeichnungen eines Le Corbusier oder Hilberseimer steht die Unterdrückung der Frage nach der Emergenz der Masse: Wie kann aus vernunftbegabten Individuen eine irrationale Masse entstehen, Hyppolite Tarde und Gustave Le Bon (unter dem unmittelbaren Eindruck der terreur) zufolge ein Wesen mit ganz anderen Eigenschaften, als die Elemente haben, aus denen sie sich zusammensetzt. Durch Erwartungsübersteigerung wird eine ansteckende Atmosphäre geschaffen, in der sich die Dynamik des Mobs entfalten kann. Die Masse ist anfällig für Suggestion, Gerüchte und Halbwissen, Aberglauben, Spleens und idées fixes sowie für spektakuläre Objekte. Soziologen und Psychologen sprechen von der madness of crowds.
Traditionell suchte man gegen dieses Phänomen das gebildete Publikum der bürgerlichen Öffentlichkeit zu stellen und warb für deren Kultivierung und bewahrung. Man versuchte, eine klare Grenze zwischen einem demokratischen Publikum und einem zur Demokratie unfähigen Außen zu ziehen, einem Außen, das auf seine körperliche Materialität reduziert ist. Zum Publikum zählten die Besitzenden, während die Eigentumslosen als potenzieller Mob verdächtigt und dämonisiert wurden. Heute weiß man, die als Publikum Inkludierten reichen nicht aus, um Gesellschaften zu integrieren und Wirtschaften am Laufen zu halten. Ein gewisses Maß an Entfesselung muß zugelassen werden. Es genügt nicht, daß die Reichen spekulieren, auch die einfachen Leute müssen auch Aktien kaufen. Zuviel Geld wird aus dem Produktiosnkreislauf abgeschöpft und muß investiert werden. in die Länder, die zur EU dazustoßen, in die Armen, die überredet werden, Häuser auf Kredit zu kaufen, in Schwellenländer, die sich verschulden müssen.
Die Frage ist daher, auf welche Weise man heute versucht, die Angst vor der Masse zu neutralisieren, wie man glaubt, die Masse zulassen zu können, ohne daß sie irreversibel gefährlich werden kann, worauf man dabei vertraut, und welche Rolle Architektur und Stadtplanung hierbei spielen oder spielen können.
Im Nationalsozialismus und im Faschismus wurde erstmals die Masse der Gesamtbevölkerung als suggestible und manipulierbare als Volk angesprochen und auch architektonisch in Regie genommen. Monumentalität und Ornament der Masse sowie der Siedlungsgedanke waren die Leitbilder der Architektur. daher rührt bis heute der intellektuelle vorbehalt gegenüber geschlossenen und eindruck machenden formen. Doch auch in der modernen Demokratie muß die Grenze zum Außen des Publikums immer weiter hinausgeschoben werden und die Masse insgesamt als inkludierbar angesehen werden. Die Unterscheidung hat keine markierte Außenseite. Als konstitutive Außenseite muß sie durch den Universalisierungsdruck stets weiter einbezogen werden. Die einst als Bollwerk gefeierte bürgerliche kritische Öffentlichkeit wird nun selbst zur Gefahr, die Expansion zu blockieren. Das neueste Konzept ist die Idee einer all-inklusive democracy, wie sie bei Walt Whitman vorgezeichnet ist: die Massen sind ein unentbehrliches Fundament für die Demokratie; ein alles umfassender Affekt ersetzt die konfliktreiche demokratische Urteilskraft. Der Affekt soll durch die Beteiligung am Geldmarkt gesichert und zugleich in Schach gehalten werden.
Wie anfällig diese Strategie ist, hat der Finanzcrash bewiesen, er konnte freilich nicht dazu führen, dieses Konzept in Frage zu stellen. Die Frage ist, wie man innerhalb dieses Wirtschaftssystems die Auslöser (trigger) des ansteckenden (contagious) und unkontrollierbar werdenden Dynamik der Masse minimieren zu können glaubt, während man die Möglichkeit ihrer Emergenz zugleich in immer höherem Maße zulassen muß. Die moderne Gesellschaft fürchtet sich vor diesen Mechanismen, zumal sie die Suggestibilität der Massen braucht, da ihre anonymisierten Abläufe auf blinden Gehorsam angewiesen sind, der nur über Suggestion funktionieren kann. Blind obedience is a social virtue.
Man kann nicht mehr der Ordnung einfach das Chaos gegenüberstellen, sondern man muß anerkennen, daß die Konstitution des Sozialen selbst eine dunkle Unterseite hat. Aus der einen Ordnung kann eine andere Ordnung werden, die beide zur Natur des Sozialen gehören. Das Soziale läßt sich ohne den unter der Oberfläche lauernden Mob nicht mehr denken. Suggestion und Suggestibilität sind nicht mehr krankhafte Zustände und Gefahr für die demokratie, sondern grundlegende Funktionsweisen des Sozialen. Suggestion wird integraler Bestandteil der medial vermittelten Kommunikation.
Man will die Menschen massenhaft zur Teilnahme am Geldmarkt bewegen, ihre Ersparnisse einzubringen ins Casino. Das Spektakuläre soll die Spekulation sein. Die Minderheit der rational spekulierenden Fachleute und die Masse der unter Suggestion Mitspekulierenden sollen als Einheit erscheinen. Es gilt, die Anfälligkeit dieser imaginären Einheit für Gerüchte und Paniken, die automatisch Anschlußfähigkeit erzeugen und reflexive Prüfung der Informationen nicht mehr zulassen, durch das All-inclusive-Ideal des Populären zu bannen. Zugleich erhält das Bedürfnis nach Abgrenzung gegen die Masse der unter Siggestion Spekulierenden und damit die Unterscheidung zwischen Masse und Publikum neue Nahrung. Beide Aspekte, Ausdehnung der Mitspieler und Abgrenzung gegen Irrationalität sind zwei Seiten derselben Medaille und müssen immer wieder neu austraiert werden. Was im Falle der Massenbildung geschieht, die Schwächung der Grenze zwischen Individuum und Umwelt, das soll zum permanenten Zustand werden. Naive Gutgläubigkeit soll jederzeit in Massensuggestion verwandelbar sein. Zugleich soll die Kopflosigkeit des Mobs jederzeit wieder unter Kontrolle zu bringen sein.
Die Börse lebt von dem Selbstvertrauen des Einzelnen, besser zu sein als alle anderen. Ihr Funktionieren beruht auf einem Überverrauen (over-conficence) in die eigenen Fähigkeiten und intuition und auf dem Vertrauen auf in den Massengeist der anderen. Zwar stiftet die Illusion grenzenlosen Reichtums eine thematische Gemeinsamkeit, aber es geht dabei nicht um einen Reichtum, der der Masse insgesamt zugute käme, sondern um eine kollektive Täuschung, deren Ziel einzig, wie beim Lotto, individueller Reichtum ist. die gemeinschaftliche Illusion dient zugleich als Mittel zur Individualisierung, wie sie auch Mittel zur Integration dient, da der Individualismus in Form der Selbstbewunderung ansteckend wirkt.
Panikkommunikation ist der Zusammenbruch dieses Übervertrauens und der Umschlag in sein Gegenteil. Auch in der Panik findet aber eine Individualisierung statt Bei Ausbruch eines Feuers in einem Theater versucht jeder für sich den Ausweg zu finden. Auch in der Panik wird der Individualismus wiederum ansteckend und so zu einem Massenphänomen. Zudem besitzt die Panik für die Außenstehenden große Anziehungskraft. Für die Zuschauer wird sie zu einem ästhetischen Phänomen. Panik ist ohne Beobachter, der sich an ihr schaudernd erfreut, nicht zu denken. (223) Die Theatralik der Panik verstärkt wie die Panikkommunikation den gleichheitsaspekt. Im Zusammenbruch wird zugleich das Zuviel an Inklusion in einem selbstregulierten Prozeß wieder zurückgenommen. der hochgradige Ansteckungseffekt der Panik hebt dann auch die Grenze zwischen Publikum und Masse tendenziell auf. Affekte sind integraler Bestandteil des Sozialen. die Affekte finden sich auf der Seite des Publikums ebenso wie auf der der Masse.
Die Abschließung der Räume zum Zwecke der Effektivitätssteigerung wie zum Schutze der Privatsphäre vor dem Staat und gegen Lärm und Mob ist nur solange nicht depressionsanfällig, wie die Teilnahme am Schauspiel der Masse nicht ausgeschlossen wird. Das Publikum tendiert stets dazu, sich in eine reflektorische Masse zu verwandeln, die sich selbst zur spektakulären Attraktion wird und damit inklusionsverstärkend wirkt, ohne dabei die Individualisierung der Massenelemente in Publikumsmitglieder garantieren zu können. „Die Massierung der Kunden, die den Markt, der die Ware zur Ware macht, eigentlich bildet, steigert deren Charme für den Durchschnittskunden“. (W. Benjamin) Baudelaire sagte: „Wer imstande wäre, sich in einer Menschenmenge zu langweilen, ist ein Dummkopf“.
Die Selbstbezüglichkeit, die sich im Spaktakulären wie in Paniken steigert und vervollkommnet, hat Goethe auf seiner italienischen Reise angesichts der arena von Verona beschrieben: "Als ich eintrat, mehr noch aber, als ich oben auf dem Rande umherging, schien es mir seltsam, etwas Großes und doch eigentlich nichts zu sehen. Auch will es leer nicht gesehen sein, sondern ganz voll von Menschen (...) Denn eigentlich ist so ein Amphitheater recht gemacht, dem Volk mit sich selbst zu imponieren, das Volk mit sich selbst zum Besten zu haben." Wenn nämlich das Volk "sich so beisammen sah, mußte es Über sich selbst erstaunen; denn da es sonst nur gewohnt, sich durcheinander laufen zu sehen, sich in einem Gewühle ohne Ordnung und sonderliche Zucht zu finden, so sieht das vielköpfige, vielsinnige, schwankende, hin und her irrende Tier sich zu einem edlen Körper vereinigt, zu einer Einheit bestimmt, in eine Masse verbunden und befestigt, als eine Gestalt, von einem Geiste belebt."
Goethe erscheint diese Form der Architektur so sinnreich und unverzichtbar, daß er sich vorstellt, sie sei aus dem Bedürfnis und dem sozialen Handeln auf natürliche Weise wie von selbst hervorgegangen. "Wenn irgend etwas Schauwürdiges auf flacher Erde vorgeht und alles zuläuft, suchen die Hintersten auf alle mögliche Weise sich Über die Vordersten zu erheben: man tritt auf Bänke, rollt Fässer herbei, fährt mit Wagen heran, legt Bretter hinüber und herüber, besetzt einen benachbarten Hügel, und es bildet sich in der Geschwindigkeit ein Krater. - Kommt das Schauspiel öfter auf derselben Stelle vor, so baut man leichte Gerüste für die, so bezahlen können, und die Übrige Masse behilft sich, wie sie mag. Dieses allgemeine Bedürfnis zu befriedigen, ist hier die Aufgabe des Architekten. Er bereitet einen solchen Krater durch Kunst, so einfach als nur möglich, damit dessen Zierat das Volk selbst werde."
Die Masse ist von sich selbst gefangengenommen. sie genießt sich selbst. die Selbstbezüglichkeit der Masse, die Selbstbewunderung der Individuen in der Spekulation, die Suggestibilität gegenüber besonderen Attraktionen, das Übervertrauen in Imitationsströme wie die Selbstverstärkung der Panik, all dies legt nahe, die Eignung des psychoanalytischen Begriffs des Übergangsraumes für den Architektur-Diskurs zu prüfen, den Winncott in die Psychotherapie eingeführt hat.
analog zu dem geschützten Interaktionsraum des psychoanalytischen Settings, in dem die Übertragung stattfinden kann, um die Wiederherstellung einer symbioseähnlichen Verschmelzung des Kindes mit der Mutter zu ermöglichen, die vorzeitig zerstört worden war, und dem Patienten die Möglichkeit geben, wie es ein Psychoanalytiker heute ausdrücken würde, in kindlichen oder archaischen Selbstobjekt-Konfigurationen Halt zu finden, die eine verwundbare Selbstrepräsentation stärken, könnte man von der Stadt als Übergangsraum sprechen, in dem Übertragungsprozesse stattfinden. Wie in der Analyse die zuvor zurückgestopften Selbstwahrnehmungen oder Affekte können nun fragil und tastend wieder auftauchen, größeren Raum gewinnen und in der Phantasie mit der imaginierten perfekten Selbstheit einer anderen Person verschmelzen können, so verleitet die emotionale Atmosphäre der Stadt dazu, Übervertrauen zu entwickeln, naive Gutgläubigkeit in Anfälligkeit für Suggestion zu steigern.
In seiner Novelle „Tod in Venedig“ hat Thomas Mann diesen Vorgang geschildert. Der Held wird eingangs so konditioniert und geprägt geschildert, daß er seinem Empfinden nach psychisch nur dann überlebensfähig sei, wenn er seine Gefühle “für sich behalten” konnte, damit sie sich nicht veränderten und ihm verloren gingen, läßt er sich überreden, urlaub zu machen. Er praktizierte eine Art defensiven Selbsthaltens seines Affektzustandes, bis er nun an einen Ort gelangt, der sich geeignet erweist, ihm eine haltende Umwelt zur Verfügung zu stellen, in der er seine verdrängten Gefühle gefahrlos erforschen zu können glauben kann. Weil die geschlossene und selbstgenügsame Welt der Dichters Aschenbach als Quelle untrüglicher Stärke erlebt wird, stellt sie ihm als Kind, das er einmal war, einen imaginären Kokon zur Verfügung, in dem sich die weitere Entfaltung und Erforschung des Selbsterlebens ohne Abspaltung der kindlichen Bedürfnisse nach Wärme und Anerkennung vollziehen können. Die Verschmelzung mit der phantasierten Stärke der Bewohner dieses fremden und perfekten, gegen die Cholera immunisiert scheinenden Milieus ermöglicht die Illusion einer “haltenden Umwelt”, die dem Besucher unbewußt die nötige Sicherheit verleiht, die er braucht, um Affekte zu Tage treten zu lassen, die er zuvor als abwegig und bedrohlich empfand, und ihn sogar verführt, das Risiko, sich lächerlich zu machen, ja jämmerlich zugrundezugehen, gering zu schätzen. Aschenbach ist zutiefst beunruhigt, aber er kommt einfach nicht dazu, sich in Sicherheit zu bringen. Als wollte er kein Detail seines eigenen Untergangs verpassen.
Thomas Mann versinnbildlicht das selbstentwaffnete und ruinöse Sichverströmen in den Übergangsraum im Bild der Krankheit. Für den erwachsenen Touristen gerät alles ins Rutschen, er befindet sich auf einer schiefen Ebene, die unaufhaltsam in Selbstverlust und Tod führt, in die psychische und physische Selbstauflösung. Der Vertrag oder die Bindung des Touristen mit der Stadt und ihren schönen Gästen, der polnischen Gräfin und ihrem Sohn, wird hinterlistig und einseitig aufgekündigt. Je mehr er selbst sich zur Treue aufgerufen fühlt, desto weniger fühlen sich die anderen an die imaginäre Vereinbarung gebunden.
Die beharrliche Spiegelung der augenblicklichen inneren Zustände Aschenbachs fördert archaische Zustände und die archaische Bindung, weil sie es ermöglicht, daß sich zwischen ihm und dem Gegenüber, bestehend aus der Stadt und jenen Personen (so als handelte es sich um die Bindung zwischen dem Patienten und dem Analytiker) eine imaginierte Identität des inneren Erlebens entwickeln kann.” Er fühlt, daß er sich blind machen muß für die Desillusionierung. Er muß immer wieder erleben, daß die Welt den Anforderungen des haltenden Übergangsraumes nicht entspricht. Er darf aber aus diesen Erfahrung nicht lernen und verbietet sich, Realismus und Rationalität an den Tag legen. Was er verkörpert, ist das Wesen, das für sein seelisches Wachstum eines geschützten Übergangsraumes bedarf, ob er nun gegeben ist oder nicht. Er kann nicht mehr anders, als die Stadt als einen solchen Übergangsraum anzusehen, weil er das ist, was in einer Obhut-Situation aus einer Person herausgesetzt wird, eine Verkörperung der archaischen Anteile der psychischen Organisation in der sterbenden Hülle des erholungsbedürftigen Erwachsenen. Als Kind wächst er, während er als Erwachsener zugleich zerfällt. Mit Psychologie, die stets mit dem erwachsenen Individuum rechnet und eine Entwicklung in eine Richtung postuliert, ist derlei nicht mehr adäquat zu erklären, weil die zweite und wichtigere Hälfte des Vorgangs, der umgekehrte Weg vom Ich zum Es unterschlagen wird.
Mit Winnicott gesprochen ist die Übertragung “eine Probe seelischer Wirklichkeit in Reinkultur”. Sie gehört zu dem, was er “das Reich der Illusion” genannt hat, ein “intermediärer Raum der Erfahrung, unbefragt bezüglich der Zugehörigkeit zur inneren oder äußeren Realität”. So wie wir das Kind nicht fragen, ob sein Übergangsobjekt (sein Teddybär) seine eigene Hervorbringung ist oder ob es ihm von jemandem gegeben wurde, fragen wir gegenüber der Übertragung nicht nach der “Realität”.
Wenn das Imaginäre einmal gestartet, der Übergang einmal beschritten, die Übertragung einmal in Gang gekommen ist, sorgt fortan die Psyche dafür, daß ihr Besitzer die Umwelt als geschützten Raum wahrnimmt, ob sie diese Zuschreibung nur verdient oder nicht. Zuweilen befällt einem ein Schwindel ob der eigenen Kühnheit, die von Blindheit nicht mehr zu unterscheiden ist: “Auf welchen Wegen bin ich, was geh ich da für einen Weg?” seufzt Aschenbach, indem er dem Jungen folgt, der immer weiß, wo sein Verehrer sich befindet und mit dem Rücken sehen kann, ob der ihm nachschaut oder nicht.
Das ostentativ Progressive der modernen Avantgarde ist eine Fassade aus Abwehrmechanismen. Dahinter steht die Angst, in dem Menschenauflauf um die Börse herum verloren zu gehen und sich zu verlieren, betrogen, verraten und verkauft zu werden, und die Sehnsucht nach Geborgenheit und danach, sich hingeben, sich überantworten zu dürfen, die man sich nicht zu haben gestattet. So verteufelt man die architektonischen Eigenschaften, die diese Sehnsucht und jene Angst evozieren und entwirft eine Welt des Vermeidens.
Vgl. Urs Stäheli, Spektakuläre Spekulation. Das Populäre der Ökonomie. Suhrkamp, Ffm. 2007
Samstag, 4. Juni 2011