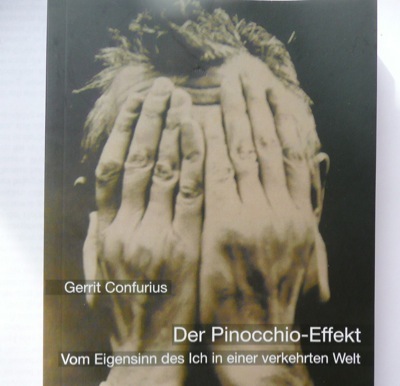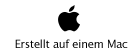Der Pinocchio-Effekt
Gerrit Confurius, Der Pinocchio-Effekt. Vom Eigensinn des Ich in einer verkehrten Welt.
Sonderzahl Verlag, Wien 2009. www.sonderzahl. at
ISBN: 978-3-85449-317-4
Englisch Broschur, 172 Seiten, 18 €
Carlo Collodis Buch wird stets als Kinderbuch gelesen. Gerrit Confurius widerspricht dieser Lesart und fragt vielmehr, warum wir ein Kinderbuch daraus machen. Denn wir könnten die animierte Holzfigur wie Don Quijote als Narren ansehen, als hoffnungslosen Psychopathen, als Traumatisierten. Als Erwachsener würde jemand, der sich wie Pinocchio verhält, uns peinlich berühren und Aggressionen auf sich ziehen. Sobald wir uns mit dem Protagonisten zu identifizieren beginnen und etwas von uns selbst wiedererkennen, müßten wir uns unserer eigenen Unbelehrbarkeit und Torheit stellen. Indem wir ein Kind aus Pinocchio machen, sind wir vor uns selber sicher.
Ausgehend von dem Bedürfnis, in der alterslosen Puppe ein Kind zu erkennen, unterzieht Gerrit Confurius den „Pinocchio“ einer präzisen Lektüre unter radikal verändertem Vorzeichen. Er versteht die Geschichte als Aufforderung an den Leser, mit sich selbst in einen Dialog zu treten. Eingeladen, sich mit Pinocchio als Kind einverstanden zu erklären, kann er seine eigene uneingestehbare Narrenhaftigkeit und Unzumutbarkeit für andere unverdächtig verkörpert finden.
Gerrit Confurius will dazu verführen, den von Walt Disney verhunzten „Pinocchio“ völlig neu zu entdecken, indem er ihn auf eine Ebene stellt mit „Don Quijote“ wie mit Dantes „Göttliche Komödie“, Bezüge zu Franz Kafka, vor allem dessen Typus der Gehilfen, herstellt, in der vegetabilen Symbolik Parallelen zu Odysseus aufzeigt und mögliche Vorbilder auch in der hellenistischen Satire ausmacht. Vor dem Hintergrund kulturanthropologischer Befunde erhalten verblüffende Parallelen mit der Jesuslegende breiten Raum. Gemäß einer psychoanalytischen Theorie des Lesens erweist sich die Lektüre der Erzählung schließlich als Protokoll dessen, was sich bei ihr mit dem Leser ereignet. Eher als mit einer Person haben wir es bei der lebenden Puppe mit einer Verkörperung des Ich zu tun. Das hehre Bild, das wir uns von unserem Ich machen, wird durch den unbelehrbaren Kobold heftig erschüttert.
Leseprobe: Auszüge aus den Kapitel n 1., 2. und 26
Er ist in Italien an Bekanntheit wohl kaum zu übertreffen, und auch außerhalb Italiens weiß fast jeder Mensch, wer Pinocchio ist, auch wenn kaum jemand, den man nach der gleichnamigen Erzählung fragte, den Namen des Autors und vom Inhalt mehr als den Umstand zu nennen wüßte, daß der Held eine Holzpuppe ist und seine Nase wächst, wenn er lügt. Wenn in den USA zur Zeit des Watergate-Skandals in Karikaturen Präsident Nixon mit einer langen hölzernen Nase dargestellt wurde, dann wußte man auf der ganzen Welt, was gemeint war. Daß es nicht nur Lügen mit kurzen Beinen gibt, weshalb man mit ihnen nicht weit kommt, sondern auch solche mit langen Nasen, woran man den Lügner sofort erkennen könne, ist sprichwörtlich geworden.
Jederman ist davon überzeugt, daß es sich, ähnlich dem Struwwelpeter, um ein Kinderbuch handle, und dieser Auffassung widersprechen zu wollen, erscheint auch angesichts des Sprachgestus abwegig. Pinocchio gilt als Inbegriff des ungezogenen Kindes. Zu dem im “Struwwelpeter” und bei “Max und Moritz” aufgeführten Schandtaten aufgrund versäumter Erziehung kommen bei Pinocchio noch das Lügen hinzu und die Leichtgläubigkeit. Man muß sogar Zweifel an seiner Erziehbarkeit haben. Pinocchio zählt zwar weder zu denen, bei denen jede Erwartung ethischen Verhaltens fehlginge, wie bei den bösen Buben von Wilhelm Busch, noch zu den Kindern, die wie Pippi Langstrumpf keine Erziehung nötig haben, sie sogar als Deformation erscheinen lassen, er verkörpert aber doch eine Vorstellung von Kind, die sich mit Erziehung nicht gut verträgt, und hat darum Ähnlichkeit mit dem “enfant sauvage”, wie man den im Wald von Aveyron aufgefundenen zwölfjährigen Jungen nannte, von dem man weiß, weil Truffaut über das für die Aufklärungszeit typische Erziehungs-Experiment des französischen Forschers Jean Itard einen Film drehte. Jener Viktor läuft immer wieder in den Wald und kehrt irgendwann zurück mit hängendem Kopf.
Pinocchio ist als verlorener Sohn nicht ohne Moral auf die Welt gekommen, er zeigt sich hilfsbereit und opfert sich ohne Zögern für einen Freund, er rettet den Vater unter Einsatz des eigenen Lebens. Er gleicht insofern Rousseaus “edlem Wilden”, den man in Amerika anzutreffen hoffte. Sogar Freuds Grundsatz bleibt von ihm in Frage gestellt, daß ohne Sublimierung und Verzicht, ohne Affektkontrolle keine Kultur und kein geregeltes Zusammenleben denkbar sei. Pinocchio besitzt allerdings nicht nur die erfrischende Natürlichkeit des nicht durch Domestizierung Verbogenen, wie sie die jugendlichen Helden in Mark Twains Romanen auszeichnet, nicht einmal die nervtötende aber dennoch Respekt abnötigende Konsequenz des Schwererziehbaren im ersten der Antoine-Doinel-Filme, “Sie küssten und sie schlugen ihn” oder dem Exemplar in Pialats “L’Enfance Nue”, sondern seine Obstruktion hat etwas Prinzipielles. Pinocchio ist nicht schwer erziehbar, er ist unerziehbar. Und zwar nicht deshalb, weil er, wie Max und Moritz, von Grund auf böse wäre, sondern weil er aus Fehlschlägen nicht lernt. Eher denn als ein auf sympathische und gesunde Weise ungezogener Junge erscheint er in seiner hölzernen Natur als Verkörperung prinzipieller Lernunfähigkeit, und damit durchbricht er das pädagogische Gehege der Kindheit auf ganz eigene Weise. (…)
2.
Pinocchio läßt kaum Zweifel daran, daß seine Bedürfnisse die eines Kindes sind, und wenn er zur Schule gehen soll, um etwas Anständiges zu lernen, dann läßt auch dies auf jugendliches Alter schließen. Auf seine Frage, ob er auch zu einem richtigen Menschen werden könne, wenn er groß sei, entgegnet die Fee jedoch, daß er nicht wachsen könne, ja überhaupt kein Alter habe. Eine Puppe sei, was sie ist. Die Fee will eine Ausnahme machen, knüpft diese Verheißung jedoch an Bedingungen, die Pinocchio allerdings nicht zu erfüllen vermag, obwohl er es sich immer wieder vornimmt. Irgendetwas hindert ihn daran. Es kommt ihm immer wieder etwas dazwischen, eine Verführung, der er nicht widerstehen kann, oder ein Konflikt, in den er sich aus Loyalitätsgründen gebracht sieht. Der Fee hat er ein Versprechen gegeben, aber den Freund kann er nicht verraten. Ihm geht es wie Franz Biberkopf in “Berlin Alexanderplatz”, ohne daß die sozialkritische Dimension jener Figur auch hier in den Vordergrund gerückt würde. Sein Versprechen nicht halten zu können, ist für ihn typisch. Was ihn daran hindert zu lernen, ist weniger die Unfertigkeit des Kindes, als eher die Festgelegtheit eines Typus. Einerseits ist Pinocchio eine unvollständig beseelte Puppe, anderseits ist er, wie Athene aus dem Bein des Zeus vollständig ausgereift und gerüstet hervortritt, mit einer spezifisch energischen Blindheit und fertigen Lerunfähigkeit auf die Welt gekommen, um sich, wie die mythischen Götter stets und für alle Zeit figurkonform zu verhalten.
Zu dieser Typik gehört auch, daß er teilweise über die erwartungsgemäß eingeschränkte Vernunft eines Kindes verfügt, er stellenweise aber die Umsicht der Erwachsenen übertrifft. Eine weitere Inkonsistenz besteht darin, daß Pinocchio sich zwar überwiegend wie ein Kind verhält, die Welt aber, in die er hineingeworfen wird, nicht eigentlich die eines Kindes ist, sondern eher dem “sadistischen Universum” eines J.W.F. Hermanns, den Kleistschen Panoramen des Bösen oder der absurden Welt eines Candide ähnelt. Während man bei Schilderungen von Abenteuern eines Kindes die schützende und helfende Hand immer mitdenkt, sehen wir uns mit Pinocchio in eine gottverlassene Natur und Menschheit versetzt, ähnlich jener, die Manzoni in “Die Verlobten” darstellt. Bei jenem herrscht alles andere als göttliche Vorsehung. Und wenn Gott sich doch einmal einschaltet, um ein Machtwort zu sprechen, dann schickt er den Menschen die Pest. Von der Seite der Menschen gibt es nichts als Unheil: Schlechte Regierung, Mißwirtschaft, Krieg, Einfall der marodierenden Landsknechte, Feigheit und Dummheit, Hinterhältigkeit und Verrat. Im “Pinocchio”, wo sich Tiere und Monster unter die Menschen mischen, ist dies in eher noch höherem Maße der Fall. Keine Anzeichen einer vernünftigen, durchdachten Zivilisation relativieren das Elend, die Brutalität und die Gleichgültigkeit. Nichts Gepflegtes, Elegantes, keine Sensibilität, nichts ist da, dem man sich anvertrauen, niemand, auf den man sich verlassen könnte. Gepetto ist herzensgut, aber ein Trottel. Einzig die Fee hält zuweilen die schützende Hand über ihn, doch ist auch auf sie kein Verlaß.
Die Welt wird von etwas zusammengehalten, das sich als unüberwindliche Intransigenz präsentiert und sich als perverses Spiel unversehens gegen den Einzelnen wenden kann. Verurteilt werden immer die Opfer. Mit der blinden Justiz wird weniger ein staatlicher Mißstand und eine verbreitete menschliche Schwäche angeprangert, es geht nicht um einzelne “Gebrechen der menschlichen Verhältnisse” (Kleist), vielmehr wird alles zum Element einer verkehrten Welt: der Richter ist ein Affe. Selbst die Fee, die gelegentlich der Erwartung entspricht, über den Helden müsse eine schützende Instanz wachen, erweist sich immer wieder als unzuverlässig und, indem sie Pinocchio dazu verleitet, sich auf sie zu verlassen, geradezu als Falle.
Die Wirklichkeit, in die es Pinocchio verschlägt, läßt an mythische Zeiten denken, in denen Götter die Erscheinung von Kindern und Greisen haben, ohne darum diesen Altersgruppen im menschlichen Sinne zugerechnet werden zu können. Ihre Eigenschaften als Riesen oder Zwerge, Männer oder Frauen besitzen eher symbolische Qualität, die aus Urzeiten herrührt. Das Leben von Göttern gehorcht anderen Regeln als denen biologischer oder entwicklungspsychologischer Konstrukte. So häufen sich doch die Zweifel an der Kind-These. Pinocchio ist eher als mit einem Menschenkind vergleichbar mit Dionysos, der erwachsen zur Welt kam, lachend und lärmend, so daß dessen Mutter, eine Nymphe, so entsetzt war, daß sie ihn verstieß.
Die Mischung von Menschen- und Tiergestalten, über die sich im “Pinocchio” niemand zu wundern scheint, erinnert daran, wie in den jonischen Tierfabeln des Äsop Menschen in Tiergestalt auf dem Niveau der Tiere reflektiert werden, die wiederum anmuten wie eine späte Rückversetzung der anthropomorphen griechischen Götterwelt auf deren theriomorphe Vorstufen, die als Kuhäugigkeit oder Eulenäugigkeit noch bei Homer gegenwärtig bleiben. Auch in Menschengestalt behalten die Götter die Eigenschaft, sich typisch, eben tierisch zu verhalten. Sie machen keine Geschichte in dem Sinne, daß eine ihrer Geschichten Spuren in einer folgenden hinterließen, so gut die einzelnen Götterviten auch miteinander verwoben sind. Mythische Götter sind typische Götter, wie die Tiere verhalten sie sich typustreu. Nicht ihre moralische Integrität, nicht die Identität mit vergangenen Handlungen und die Kontinuität auf zukünftige hin, wie es von den Menschen verlangt wird, sondern die Gleichartigkeit der mit ihrer speziellen Zuständigkeit verbundenen Eigenschaften und Wirkungen macht ihre Bezugsfähigkeit aus. Die Götter sind zwar anthropomorh geworden, aber sie tragen dieses Menschwerden noch an sich. Und die Menschengestalt steht immer im Verdacht der Maskerade. Wenn ein Gott nicht erkannt werden will, ist er für den Angeredeten ein Mensch. Insofern als die Menschen, mit denen Pinocchio zu tun hat, sich durch Vergeßlichkeit und Unzuverlässigkeit auszeichnen, sind sie wie Götter, die sich verstellen.
Man könnte angesichts der Düsternis auch an die Hölle denken, die Hölle auf Erden oder an einen Hadesbesuch, von dem Pinocchio nichts weiß, weil die anderen es ihm nicht verraten, weil sie vielleicht auch nicht wissen, daß sie sich in der Hölle befinden, oder weil die Strafen, die sie ewig erleiden müssen, für sie so normal geworden sind, daß man kein Wort mehr darüber verlieren muß. Zahlreiche Motive der Hadesfahrten, die in der hellenistischen Satire zu den Standardtopoi zählten, als Demütigung der einst Mächtigen, die erwartet hatten, in den Himmel aufzusteigen, lassen sich im “Pinocchio” wiederfinden.
Nun gibt es Brutalität und Düsternis auch in anderen Büchern, die offiziell als Kinderbuch ausgewiesen sind, die für Kinder geschrieben wurden und von Kindern handeln. Man denke an Otfried Preußlers “Krabat” und die Schornsteinfegerkinder in Benito Mazzis „Hunger, Ruß und Kälte“, “Die Besorger” oder an die Dickens-Romane. Auch die Geschichten von Momo und Harry Potter sind voller furchterregender Situationen und Gestalten. “Der Zauberer von Oz”, die Träume von Little Nemo, die Filme von Spielberg sind ebenfalls nicht ohne, und aus Grimms Märchen sind Kinder ohnehin einiges gewohnt. Als die Sammlung der Gebrüder Grimm 1814 in Wien erschien, wurde sie gleich darauf verboten.
Aber die Protagonisten all dieser Erzählungen sind im Grunde gut, und ihnen eignet eine kindliche Unschuld, selbst wenn sie in Verbrechen verwickelt sein sollten. Dies kann man von Pinocchio nicht behaupten. Er ist keineswegs nur ungezogen, benutzt oder verführt worden, sondern gelegentlich unerwartet gewalttätig und nach den Maßstäben des Bürgerlichen Gesetzbuches tatsächlich delinquent. Man könnte sogar sagen, daß er nicht nur in eine sadistische Welt geraten ist, sondern daß auch er selber sadistische Züge trägt - freilich nicht im sexualpathologischen Sinne verstanden, sondern eher im Sinne Maurice Blanchots. Die Moral de Sades, so Blanchot, “gründet sich auf die Urtatsache der absoluten Einsamkeit. (…) die Natur läßt uns allein geboren werden.“ Es gibt zu dieser Zeit „keinerlei Bindungen zwischen einem Menschen und einem anderen. Die einzige Verhaltensregel besteht also darin, daß alles, was mich glücklich macht, Vorrang genießt, und daß ich alles für nichts oder gering erachte, was aus meiner Vorliebe an Schlechtem für andere hervorgehen kann. Der größte Schmerz der anderen zählt immer weniger als mein Vergnügen. Was macht es aus, wenn ich den schwächsten Genuß mit einer unerhörten Häufung von Untaten erkaufen muß; der Genuß ist mir angenehm, er ist in mir, aber die Wirkung des Verbrechens berührt mich nicht, sie ist außerhalb von mir.“ (Blanchot 1949; Bataille 1963, S. 1649 Der Sadist bleibt sein Leben lang Kind. Das Kindhafte dieser Amoralität ist nicht an den Lebensabschnitt der Kindheit gebunden.
Pinocchio glaubt, ein Recht auf seinen angeborenen Sadismus zu haben, aber dummerweise wird er immer nur Opfer der Gemeinheiten der anderen. Der Sadismus Pinocchios kommt nicht in der Weise zum Tragen, daß er wie ein Libertin agierte und die anderen seine Komplizen oder seine Opfer wären, ganz im Gegenteil: Immer wieder wird er selber Opfer von Gewalt und Verschwörungen und ist gleichwohl als vermeintlicher Täter das Ziel administrativer und autoritärer Aufmerksamkeit. Und auch diese Pechvogel-Lächerlichkeit bei eingebildeter Souveränität gehört zu ihm als Typus.
Wenn Pinocchio nur Mißverständnisse, Täuschungen und Niederlagen erfährt, wenn er, wann immer er Zuneigung verspürt, die Erfahrung machen muß, daß man ihn nur ausnehmen wollte, wenn sein Vertrauen regelmäßig ausgenutzt wird und er immer nur wie durch ein Wunder mit dem Leben davonkommt und sich ihm Recht regelmäßig in Unrecht verkehrt, dann muß man sich fragen: Woher kommt seine Fröhlichkeit, die anscheinend doch durch nichts zu besiegen ist und sich nach jedem Schlag erstaunlich schnell wieder erholt, gerade so als wäre nichts gewesen? Man neigt unweigerlich dazu, diese Stehaufmännchen-Fähigkeit der Lebensenergie des Kindes zuzuschreiben. Nur ein Kind vermag so viel natürliche, instinktive Widerstandskraft aufzubringen. Ein Erwachsener würde wohl resignieren, es sei denn er hieße Buster Keaton, Candide, Simplicissimus oder Don Quijote oder sei der Held, dem in Henry James „Das Tier im Dschungel“ nichts zustoßen kann. Und doch ist auch hier die Kind-Assoziation irreführend.
Die Narren zeigen, daß die Pinochio’sche Mixtur aus unverwüstlicher Fröhlichkeit und chronischem Scheitern nicht an das Kindesalter geknüpft sein muß, auch wenn man mit dem Etikett des Narren in der Nähe des Kindes im Sinne von Naivität und kindischem Verhalten bleibt, wobei man freilich mit ‘Kind’ dann nicht eigentlich eine Altersgruppe meint, sondern ein Nicht-Erwachsensein oder Nicht-Erwachsenwerden-Können, ein retardierendes oder regressives Moment. Der positiv besetzten Fröhlichkeit wird dabei etwas Negatives beigemischt. Aus einem Überschuß wird ein Mangel. Energie mischt sich mit Zurückgebliebensein, Tapferkeit mit Idiotie. Dies aber wollen wir Pinochio nicht zumuten. Sein Charme verlangt, daß wir ihn nicht trotz seiner Garstigkeiten und Ungeschicklichkeiten, seiner Frechheit, seines Egozentrismus und seiner Blödigkeit lieben, sondern gerade ihretwegen. Daß wir uns mit ihm identifizieren, nicht obwohl er ständig dabei ist, unsere Gunst und Achtung zu verscherzen, sondern gerade deswegen. Er verlangt stets, daß man ihm die Würde zurückerstattet, die er gerade verspielt hat. Dieser Bonus läßt Pinocchio in unseren Augen zum Kind werden, da wir dieses Vorrecht Kindern vorbehalten.
Freilich wäre auch der Narr nicht eine derart erfolgreiche und historisch zähe Figur, die sogar seine Abschaffung durch die Aufklärung überlebte, wenn sich sein Prinzip in Stupidität, passiver Aggression und sein Geist in Blödigkeit erschöpfte. Bei Pinocchio hat man zwei Möglichkeiten: Man kann ihn wie Don Quijote als Narren verspotten oder ihn voller Rührung für ein Kind halten. Die Zuschreibung des Kindes ist gründlicher und sicherer: Als Kind ist seine Narretei weniger peinlich und zuverlässiger entschuldigt. Sie kommt uns weniger nah. Das Etikett des Narren schlösse das Risiko nicht so vollständig aus, sich durch Identifikation selbst als Narren erkennen zu müssen. Mit der Erklärung Pinocchios zum Kind hat man diese Möglichkeit ausgeschlossen und die mögliche Assoziation der eigenen Narreteien weit genug von sich weggerückt.
Allerdings ist die Kind-Annahme auch nicht ganz risikofrei. Gerade weil einem dabei entgeht, was man selber tut. Man wähnt sich in sicherer Distanz und ist doch gerade darum bereits in etwas verwickelt, das man nicht unter Kontrolle hat. Das Wohlwollen oder Mitleid mit dem Kind, die Sympathie mit dem hilflosen Wesen, das auf die anderen angewiesen ist und darum unschuldig bleibt, wenn es von anderen ausgenutzt und betrogen und hintergangen wird, schlägt in uns selbst eine Saite an, die einen Echoraum in unserem Innern öffnet, in dem das Kind, das wir einmal waren, noch anwesend ist, wie eine Puppe, die jederzeit wieder mit Leben erfüllt werden kann und die wir dann für ein Monster halten. Indem wir uns mit Pinocchio als Kind in Sicherheit zu bringen meinen, haben wir uns in der hinterhältigen Dialektik dieser Figur längst verfangen. Die Verkindlichung hat den unbemerkten Effekt der eigenen Öffnung und alle Vorsicht vergessenden Bloßlegung.
Solch blindes Rennen des Protagonisten in Sackgassen, wie es Pinocchio vollführt, würde, wenn wir es bei einem Erwachsenen beobachteten, erst Peinlichkeit, dann Ermüdung und schließlich Widerwillen bewirken: Ja, wenn jemand so blöd ist, dann ist ihm nicht zu helfen. Und wenn sich das in einem tolerierbaren Zeitraum nicht gibt, schlägt die Ungeduld in Verachtung und Hohn um, und dann wird von dem Betreffenden und seinem Treiben offiziell Kenntnis genommen: in Form der Ächtung, einer Verurteilung oder gar einer Einweisung. Bei Kindern bewirkt dasselbe Verhalten Rührung. Es geht zu Herzen, wenn ein unschuldiges Kind wieder und wieder auf die Probe gestellt wird, hofft und verliert, sich in Sicherheit glaubt und betrogen wird. Der Hehler Fagin, schwankend zwischen Zärtlichkeit und Habgier, bietet Oliver Twist Unterschlupf in seiner Kinderbande, um ihn als Dieb auszubeuten, und er würde ihn ohne Bedenken über die Klinge springen lassen, um seine eigene Haut zu retten. Wir durchschauen ihn und sind doch gerührt, weil es einem Kind gegenüber angemessen wäre, ihm ohne Hintergedanken Schutz zu bieten. Wir sind fern davon, Oliver seine Naivität vorzuwerfen.
Bei Collodi sind wir nicht so sicher, ob er es auf diesen Effekt der Rührung abgesehen hat, nicht nur weil er die Altersbestimmung Pinocchios in der Schwebe hält, sondern auch weil er sich dieses Zugeständnis mildernder Umstände dadurch verscherzt, daß er Pinocchio veritable Verbrechen begehen läßt. Doch um sich dieses Effektes zu bedienen, muß nur die Möglichkeit, aus dem Helden ein Kind machen zu können, nicht völlig ausgeschlossen sein. Da wir als Leser wissen, wie es uns bewegt, wenn derjenige, der von einem Schlamassel in den anderen gerät und ständig nur betrogen wird, ein Kind ist, und weil wir alle anderen Möglichkeiten verwerfen müssen, machen wir aus unserem Helden ein Kind, ob das nun durchgängig plausibel ist oder nicht.
Der Leser entwickelt über Pinocchio die Theorie, daß es sich um ein Kind handeln müsse, da es sich sonst um einen nervtötenden Idioten oder armen Irren handeln müßte. Aber genau darum geht es: Pinocchio konfrontiert uns gerade deshalb mit der Möglichkeit, uns zum Narren zu machen oder uns selbst als armer Irrer zu entpuppen, weil wir uns mit unseren Projektionen in Sicherheit wiegen wollen. Wir ahnen zugleich, daß in dieser Erzählung die Erkenntnis lauert, daß die soziale Gemeinschaft ist kein so sicherer Ort ist wie das naturwissenschaftliche Experiment, und ihr Schutzraum sich jederzeit in einen Alptraum verwandeln kann. Und auch die Seelen-Landschaft des “Pinocchio” ist trotz der Kind-Vermutung nicht ein so sicherer Ort, wie wir uns selber glauben machen, indem wir seinen “sadistischen” Charakter geflissentlich übersehen und seine Idiotie für nicht zurechenbar halten.
Pinocchio, das sind wir selbst als Kind, während wir erwachsen bleiben. Der Text lädt ein zu einer Spaltung des Lesers, zu einem schädelspalterischen Lesen. Indem wir uns mit Pinocchio anfreunden, erlauben wir uns, das zu genießen, was manch einem zusetzt, nämlich die Dissoziation von kindlichen und erwachsenen Anteilen der Person. Wir können dies zulassen, weil wir unser eigenes Potenzial für die Eigenschaften eines anderen halten. Das Kind ist immer der, der wir nicht sind. Das Kind ist in diesem Verstande kein ontologischer Begriff, sondern ein Konstrukt, mit dem wir uns mit anderen und anderem in Beziehung setzen. Wir können auf diese Weise etwas anerkennen und zulassen, ohne es als etwas anerkennen zu müssen, was uns selber betrifft. Wir konstruieren so eine experimentelle Schizophrenie. Was wir Pinocchio zugestehen, können wir im selben Atemzug einem Erwachsenen absprechen. Zu etwas Kindhaftem, was wir durch Pinocchio in uns selbst wiedererkennen, können wir uns ohne Konsequenzen bekennen, während wir zugleich die Möglichkeit behalten, es an uns selber wie an einer anderen Person, die uns mit ihrer Naivität oder Unbelehrbarkeit belästigt, für unverständlich zu halten und als unzumutbar zu diskriminieren. Indem wir in Pinocchio ein Kind sehen, erlauben wir uns, aus uns herauszugehen, um von uns selber abzusehen.
Wenn wir in Pinocchio das Kind sehen, dann sanktionieren wir die Werturteile und Normalitätskriterien, mit denen wir ein Verhalten, das Pinocchio an den Tag legt, bei einem Erwachsenen für anormal, für Idiotie halten, als kriminell oder krank bezeichnen würden, und verzichten zugleich darauf, uns selber gegebenenfalls mit diesem Potenzial in uns selbst in ihm wiederzuerkennen. Wir grenzen einen Bereich unserer selbst aus, von dem wir uns frei wähnen, dessen wir uns schämen würden, zu dem wir uns nicht bekennen dürfen, weil wir ihn für überwunden halten müssen. So betreten wir, indem wir in Pinocchio ein Kind sehen und das Buch als Kinderbuch lesen – falls wir eben darum nicht gleich darauf verzichten, es überhaupt zu lesen – einen Raum, indem wir ihn verlassen. Dieser Raum befindet sich hinter uns, wie ein verleugneter, verkaufter Schatten, wie die Kehrseite unserer selbst, unsere Hinterwelt. Pinocchio eilt uns voran, indem er uns folgt. Er entwischt uns, indem er uns einholt.
Der Leser des Pinocchio wird in einen Prozeß hineingezogen, wie der Dorfrichter Adam in Kleists Komödie. Er ahnt nicht, daß er am Ende wie jener auf sich selbst als Schuldigen treffen muß, und muß die von ihm selbst noch ohne dieses Wissen lauthals vertretene Vernunft an sich selbst vollstrecken. Er gerät in eine zyklische Prozeßstruktur, in der er sich gleichsam von hinten sieht und dadurch der Identifikation zunächst entzogen bleibt.
Wenn die Annahme, es sei ein Kinderbuch, nicht einfach von der Hand zu weisen ist, dann könnte es sein, daß der Autor uns eine Falle stellt. Nicht wie H.C. Andersen, der den erwachsenen Leser früh fischen wollte, damit der sich später daran erinnern möge, sondern in dem Sinne, daß wir aus der Reserve gelockt werden und uns doch sicher fühlen sollen, wenn wir Pinocchios Fehlverhalten als kindlich belächeln und entschuldigen, wobei, ohne daß wir es bemerken würden, von uns selbst etwas in den Bereich des Möglichen und Thematisierbaren gelangt, was wiederum die anderen nur entschuldigen würden, wenn es ein Kind täte, so daß wir uns also ihnen und ihrem Urteil ausliefern. Es geht also gar nicht um die unentscheidbare Frage, ob der “Pinocchio” ein Kinderbuch ist oder nicht, sondern die Frage ist, warum und wie wir ein Kinderbuch daraus machen, obwohl das gar nicht so einfach ist, und wir dabei viele Inkonsistenzen und Gefahren in Kauf nehmen müssen, so daß wir darauf vertrauen müssen, das dies niemand merkt und daß alle mitspielen.
26.
(…)Momente dieses Strukturprinzips des unentschiedenen Erzähler-Ichs, der nicht festlegbaren Identität der Handelnden und der falschen Fährten, (denen wir im „Goldenen Esel“ von Apuleius begegnen), finden sich auch im “Pinocchio”. Der Streit der beiden Reisenden über die Glaubwürdigkeit des gerade Erzählten im “Esel” (Buch 1, Kap 2. und Kap 20.) läßt an den Streit der beiden Tischler denken, mit dem der “Pinocchio” beginnt. Haltung und Identität der Fee und anderer mitwirkender Figuren schillern in beiden Romanen gleichermaßen. Und der Held beider Romane durchläuft Metamorphosen, die nur durch ein höchst fadenscheiniges Geflecht von Motiven und Stationen zusammengehalten werden. Es wird zwar im “Pinocchio” im Unterschied zu Apuleius Roman aus der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts aus der Distanz der dritten Person erzählt, die Erzähl-Strategie ist gleichwohl wie bei Apuleius unzuverlässig und darauf angewiesen, daß der Leser sich auf falsche Fährten und in Sackgassen führen läßt, um sich selbst in seinen Erwartungen brüskiert und in seinen Vorurteilen bloßgestellt zu finden. Das Verständnis setzt eine Bereitschaft des Lesers voraus, sich bezüglich des Common-sense und der Lese-Routinen buchstäblich vor die Tür setzen zu lassen.
Die Lektüre des “Pinocchio” “glänzt durch ausreichend viele Lücken in der Logik, die der Leser durch Sprünge der Einbildung zu überbrücken gezwungen ist…” Roland Barthes nannte die Bereitschaft, beim Lesen über manche Lücke und Unstimmigkeit mit der Vorstellungskraft hinwegzuspringen, die “Lust am Text”. Der Lustleser mit seiner Lektürelust ist derjenige, der die Leseneurose zur halluzinierten Form des Textes in Beziehung setzt. Gleich zu Beginn seiner Notizen fordert Barthes dazu auf, uns ein bizarres Wesen vorzustellen, das sich von der Angst, sich zu widersprechen, befreit hat, das Sprachen miteinander vermengt, die als unvereinbar gelten, und das den Vorwurf des Illogismus stumm erträgt. Die Regeln unserer Institutionen, schreibt Barthes, würden eine solche Person zu einem Außenseiter machen. Wer kann schon ohne Scham im Widerspruch leben? “Nun, dieser Anti-Held existiert: Es ist der Leser eines Textes in dem Moment, wo er Lust empfindet.” (Roland Barthes)
Was den “Pinocchio” vor vielen anderen literarischen Erzeugnissen auszeichnet und was er mit dem “Don Quijote”, der “Odyssee”, der “Göttlichen Komödie” sowie mit “Moby Dick”, dem “Prozeß”, dem “Schloß”, mit der “Antigone” und auch mit den Evangelien gemein hat, das ist die spezifische Haltung, die der Text zu diesem Vorgang der Spaltung und ihrer Überbrückung einnimmt, die wir beim Lesen eingehen. Nicht um die Anwendung einer allgemeinen Theorie auf einen Einzelfall handelt es sich, wenn wir Pinocchio lesend zu verstehen suchen, sondern eher um ein nachträgliches Reflektieren dessen, was uns selber dabei passiert ist. Wir lesen den “Pinochio” wie ein “retroaktives Manifest”, wie etwas, das sich scheinbar ganz ohne Theorie beim Lesen ereignet hat, das ich zwar selbst getan habe, das gleichwohl kopflos passiert ist, und das der Theorie bedarf, die wir im Text, den wir lesen, vorfinden. Der “Pinocchio” formuliert keine Theorie mit der Absicht, sie uns beizubringen, uns von etwas zu überzeugen, eine Ansicht nahezubringen, sondern er handelt blind antizipierend davon, daß sich etwas in uns ereignet haben wird, als Effekt, obwohl oder gerade weil wir bewußt nichts dazu beigetragen, sondern sogar alles versucht haben werden, es nicht eintreten zu lassen. Das Besondere des “Pinocchio” liegt darin, daß er diese Spaltung des Lesers, diese kreisförmige ödipale Dialektik von Verkennen und Wiedererkennen, selbst thematisiert. Er handelt vom mich vereinzelnden und spaltenden Gelesenwerden meiner selbst.
Der Sinn dieses selbstreferentiellen und selbstreflexiven Lesens (des Lesen des Lesens) besteht in dem, was uns zu Beginn beschäftigte, nämlich in der Möglichkeit, hinter der Maske der Erwartung an die schelmenhaft gebrochene Heldenhaftigkeit der Hauptfigur unsere Kleinheit und unsere Ohnmachtserfahrungen in das Lesen einzuschmuggeln und einer sprachlich vermittelten Verarbeitung ohne unsere bewußte Mithilfe zugänglich zu machen. Unsere Hysterie müssen wir vor uns selber verheimlichen. Diese Arbeit müssen wir gleichsam, hinter unserem eigenen Rücken verrichten. Wir selbst dürfen nicht bemerken, was wir da tun, wenn es wirksam werden soll. Wir müssen uns selbst überlisten, um uns selbst überraschen zu können. Ebendazu verhilft uns Pinocchio.
Literatur fungiert bei diesem subversiven Geschäft als etwas, das dem offiziellen Verständnis nicht weniger widerspricht, als wir selbst als Leser hinter unserem eigenen Rücken unseren eigenen Lese-Erwartungen zuwiderhandeln. Literatur offenbart, wenn wir uns unserer eigenen verleugneten Lese-Interessen bewußt geworden sind, ihre Qualität als Medium der Selbstanalyse. Literatur, gelesene wie selbst verfaßte, besitzt in unterschiedlichem Maße generell diese Qualität. Nicht daß in ihr Themen angesprochen und narrativ umgesetzt werden, ist unter diesem Gesichtspunkt ihr Verdienst, sondern daß sie den entsprechend disponierten Leser in ihre Dramatik hineinzieht, ihn in ihr Geschehen aufnimmt, indem sie als die haltende Instanz fungiert, die er benötigt, um einst gescheiterte Kommunikation erneut verflüssigt und seine zurückgehaltenen Affekte zur Sprache gebracht zu finden, aber eben nicht auf thematische Weise, sondern in der Konstellation zwischen Personen und Wörtern evoziert. Ein literarischer Text verhält sich wie ein Vermittler zwischen der Person des Analysanten und der des Analytikers, indem dieser sich als das Andere des Patienten als das Gegenüber in einer dialogischen Situation anbietet.
Die psychoanalytische Praxis legt diesen nicht auf Rezeptionsästhetik reduzierbaren Gedanken nahe, in dem Maße, wie sie (nach ihrem “intersubjective turn”) den intersubjektiven Charakter der analytischen Situation einräumt und den Patienten nicht mehr nur als passives Objekt und wie eine Sache begreift und die Person des Analytikers entsprechend nicht mehr als einzigen Schauplatz der Reflexion des interaktiven Vorgangs versteht, so daß nicht mehr sämtliche Äußerungen des Patienten im Kontext von Übertragungen des Analysanten verstanden werden müssen, sondern es erlaubt ist, daß der Analysant sich als Subjekt positioniert, das er auf angemessene Weise auch unbewußte Konflikte des Analytikers zum Ausdruck bringt.
Ich überlasse mich lesend einem Anderen und mir selbst als einem Anderen, ohne darauf Einfluß zu haben, was dabei herauskommt, ohne mich dabei einer anderen lebenden Person anvertrauen zu müssen. Ohne daß eine fremde Person leibhaftig involviert wäre, setze ich mich einem interaktiven Prozeß mit imaginierten Personen mit offenem Ende aus und überlasse ich mich so einem Anderen. Ich mache mich zu meinem eigenen Gehilfen. Literatur setzt mich in die Lage, mir selbst zu helfen, indem ich mir schade, als negativer Schelm.
Die Praktizierung der selbstanalytischen Potenz von Literatur muß nicht nur nach dem Modell des psychoanalytischen Gesprächs geschehen, sie kann umgekehrt auch dazu beitragen, die metatheoretische Selbstreflexion der psychoanalytischen Praxis zu befördern, weil deutlich wird, daß der Analytiker für den Analysanden nur eine Personifizierung seines eigenen Ichs als Anderer ist, das als imaginäre Person aus seiner experimentellen Selbstspaltung hervorgeht, wobei Spaltung nicht das Gegenteil von Identität ist, sondern deren Möglichkeitsbedingung darstellt insofern, als sie zu ihrer Stabilisierung im Verlauf der Zeit unerläßlich ist. Der Analytiker bildet sich nur ein zu existieren, und der Analysand toleriert diesen Wahnsinn. Der Analytiker stellt sich als Hülle für dieses Besessenwerden vom anderen Ich des Patienten zur Verfügung. Die wechselseitigen Übertragungen entbehren nicht einer gewissen Lächerlichkeit. Aber beide machen, wie Don Quijote und Sancho Pansa, ernste Miene zum närrischen Spiel.
Wir sehen uns bei der Lektüre des “Pinocchio” in ein üppiges Gestrüpp der Signifikanten verwickelt, die uns festhalten und dann wieder loslassen, uns tragen und wieder schwimmen lassen, und plötzlich reißt der Faden ab, die Führung reduziert sich auf vage Andeutungen, oder uns drängen sich Definitionen auf, die alles umstülpen. Gedankenketten verknoten sich, um gleich darauf auseinanderzufallen. Ich bin bei der Lektüre mit körpersprachlichen Präsenzerfahrungen des Helden konfrontiert. Mich überfordert das Unheimliche der Leibhaftigkeit von Gedanken, mit dem schon der Ghepetto und die beiden Streithälse zu Beginn der Geschichte zu kämpfen haben. Je mehr ich mich darauf einlasse, desto mehr werde ich mir dabei selber fremd. Pinocchios “Geburt” markiert für mich den Beginn dieses Sich-selber-Fremdwerdens, und umgekehrt wird die Selbstentfremdung als Sprung in jener zweiten Geburt des Menschen als soziales Wesen symbolisiert. (von Gravenitz)
Einmal in die Welt hinausgestoßen, einmal mit dem Lesen begonnen habend, ist das Wesen nicht mehr einfach so zu bändigen. Vielleicht hat jeder Mensch sein bestimmtes Phantasma, Bilder, die auf der Lauer liegen, in uns herumschleichen, ein Leben lang, um sich bei der Begegnung mit einem bestimmten Wort oder einer bestimmten Geste auszukristallisieren. Es kann ein Phantasma nur geben, wenn es einen Schauplatz findet, wenn es einen Ort gibt für seinen Auftritt, und sei es auch im Schutz eines Vexierbildes, auf das wir vorläufig noch im falschen Abstand starren. Das Stichwort, dieser entscheidende Signifikant, macht das Phantasma seiner Erforschung zugänglich. Es wird dann abgebaut wie ein Kohle-Flöz. Oder man tritt eine Reise an mit unbekannter, aber durch nichts zu verkürzender Dauer, eine Odyssee, bis in metaphorische Details hinein. Alles, was ich über mich weiß und ahnte findet auf dieser Reise seinen Ausdruck, ohne daß ich gleich wissen müßte, daß es sich um mich handelt.
Es geht mir hier nicht darum, die Psychoanalyse zur Interpretation des vorliegenden literarischen Erzeugnisses zu mißbrauchen – Papierpersonen lassen sich nicht analysieren - sondern darum, an diesem Beispiel das psychoanalytische Potenzial von Literatur in Konkurrenz zum analytischen Setting zu ergründen. Es handelt sich nicht darum, eine Geschichte psychoanalytisch aufzuschlüsseln, sondern die Erzählung als etwas zu begreifen, das ein psychoanalytisches Konzept repräsentiert, es selbst in Szene setzt, indem sie gelesen wird. Und dies in einer Weise, die die Fähigkeiten jedes Analytikers übertrifft, da ich als Leser alles falsch und damit richtig mache, und das Problem der nicht ausreichenden Gegenübertragung, sofern es der Eitelkeit und dem Enactment-Profit des Analytikers geschuldet ist, gar nicht aufkommen kann. Der Literatur in ihrer philologischen Vielschichtigkeit und ihrer Fähigkeit der Verführung zur Überinterpretation wird zugestanden, meine Gefühlswelt aufzuladen und durch Übercodierung der Zeichen transparent werden zu lassen. Diesem Archetypus der Literatur kommt der Pinocchio unter allen Exemplaren der Weltliteratur vielleicht am nächsten.
Wem all dies nachwievor als Überfrachtung einer Bagatelle erscheint, als unangemessene Beanspruchung eines harmlosen und mittelmäßigen Kinderbuches, der mag bedenken, daß hier lediglich der Aufwand getrieben wird, der erforderlich ist für die Reflexion dessen, was sich beim Lesen des “Pinocchio” in jedem Leser tatsächlich ereignet, und was wir ohnehin selber tun, wenn wir zwischen den Deutungen und Selbstbildern unaufhörlich hinundherwandern. Was Pinocchio uns zu erkennen einlädt, kann nicht thematisiert und doziert werden, sondern es muß gemäß Kierkegaards Erkenntnisbegriff beim Lesen tatsächlich stattfinden, es muß sich “ereignet” haben.
Die eigentümliche Art der Verzauberung, der wir beim Lesen erliegen, wird in dem Satz präzisiert, mit dem Rosalind Shakespeares “As you like it” beendet: “My way is to conjure you.” Wobei to conjure sowohl meint, jemanden zur Übernahme einer Verantwortung zu bewegen, als auch eine durch Zauber bewirkte Verwandlung zu erfahren.
Buchcover: Jorge Molder, Lissabon