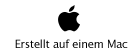Ichzwang
Leseprobe
Wenn ein Individuum sich gedemütigt sieht, wenn ihm Gewalt angetan wird, wenn seine Biographie, etwa aufgrund des Verlustes der Arbeit oder des Scheiterns einer Ehe, entwertet, ihm seine Ohnmacht vor Augen geführt wird, der Weg nach vorne versperrt ist, wenn er in eine „Man-kann-nicht-gewinnen-Situation“ (Bateson) geraten ist, tritt etwas in Kraft, das die zugemutete Negation subjektiv in einen Triumph ummünzt. In einen Triumph allerdings, den der Betreffende nicht genießen kann, der ihm nicht nur nichts einbringt, sondern im Gegenteil alles noch schlimmer macht. In diesem Manöver ist der Betreffende Täter und Opfer zur selben Zeit. Das tätige Opfer einer solchen Gewalt ohne Schuldige schadet sich selbst über den aktuellen Anlaß hinaus. Dies kann der Betreffende jedoch nicht ohne weiteres und, wenn überhaupt, nur mit erheblicher, zumeist jahrelanger Verzögerung erkennen. Der selbst zugefügte Schaden überdauert die Wunden.
Entscheidend ist, daß dieser Triumph sich trotz seines eindeutig zu hohen Preises nicht vermeiden läßt. Während der Betreffende, in die Enge getrieben, in der selbst gestellten Falle gefangen, verzweifelt auf Abhilfe sinnt und die Ausweglosigkeit der Lage und seine Hilflosigkeit vor sich selbst relativieren muß, findet in ihm etwas statt, das der Rettung seiner Selbstachtung dient, ohne daß er selbst gefragt wird. Das Rettungsprogramm wird automatisch gestartet, und dessen oberstem Ziel wird in schwerer Bedrängnis und vollends in der Not absoluter Ohnmacht alles sonstige untergeordnet. Die Psyche unternimmt dabei alles mögliche, um dem Subjekt selbst die Einsicht in diesen Automatismus und seine Kosten zu verstellen, solange dies notwendig ist, um die Mission nicht zu gefährden.
In Notlagen angesichts von Schmerz durch Verlust, bei Trauer wird notorisch der mögliche Fall unterschlagen, daß dem Betroffenen seine Not gar nicht erst zu Bewußtsein kommt. Man übersieht die Möglichkeit, daß die Rezeption der Not und des Schmerzes bereits im Ansatz unterbrochen wird. Solche Rezeptionsblockade bleibt nicht auf inzwischen bekannte Formen beschränkt. Zwar räumt man mittlerweile ein, daß jemand, der mit dem Verlust eines geliebten Menschen nicht zurechtkommt, Zuflucht bei magischem Denken nimmt, um den Verlust ungeschehen zu machen und eine trügerische Gegenwart des Verlorenen herzustellen. Nach wie vor wird ein solches Zufluchtnmehmen aber als Schwächung oder Aussetzen der Ich-Funktionen bewertet. Um welche Instanz es sich handeln könnte, die zur Aktivität magischen Denkens greift, bleibt im Dunkel. Das Ich müßte sich demnach selber schwächen, um sich über seine tatsächliche Aktivität und Energie zu täuschen. Das Ich muß das tun, was Ödipus sich antat, sich zu blenden, doch nicht, nachdem er seine Taten vollbracht und seiner Verfehlungen inne geworden ist, sondern vorher, damit er handeln kann, damit er seine Mission erfüllen kann.
Etwas im Menschen sorgt dafür, daß dieses Ziel nicht aufgegeben wird, und sei es auch um den Preis der Realität, des Kontakts zur sozialen Welt, des Verlustes allen materiellen Vermögens sowie des Verlustes des sozialen Ansehens, der bürgerlichen Existenz. Der Verstand, der ihm sagen will, daß keine Möglichkeit zur Gegenwehr und zur Rettung besteht, oder daß es deutliche Anzeichen dafür gibt, daß er einen Fehler zu begehen im Begriff ist, daß er geradewegs in eine Falle läuft, daß man ihn nur ausnutzen will, daß man sich über ihn lustig macht, muß partiell abgeschaltet, eingeschläfert werden, um der Imagination, die auf Rettung der Selbstachtung fixiert ist, Raum zu geben.
Der Sinn für Risiken und Chancen auf materiellem Gebiet wie auf dem des sozialen Ansehens, der uns im Wachzustand zu Gebote steht und eben noch zu Gebote stand, muß außer Kraft gesetzt worden sein, damit die Seele jene allem anderen übergeordnete Aufgabe erfüllen kann. Das Ziel, die Würde zu bewahren, kennt keine Argumentation, keine Moral und keine Güterabwägung. Das Programm läßt so wenig mit sich handeln wie die Schwerkraft. Es bildet die unübersteigbare Grenze allen rationalen und ökonomischen Erwägens. Es gilt absolut, und sei es auch um den Preis des persönlichen Ruins und des Weltverlustes. Es verschafft sich zur Not auch Geltung durch Selbstsabotage.
(…)
Entgegen dem gewohnten Bild vom Ich als Instanz der Selbstgewißheit und Affektkontrolle, der persönlichen Souveränität, das in engem Zusammenhang steht mit der Annahme der Abgegrenztheit und Integrität des Individuums, wäre das Ich als etwas zu erkennen, das sich auch gegen die eigene Person kehren kann, als unsicherer Kantonist und als Kippfigur.
Während wir uns unseres Ichs noch sicher wähnen und von ihm erwarten, uns Sicherheit zu geben, kann es sich bereits in einen Dämon verwandelt haben, der hinter unserem Rücken das Geschehen lenkt wie der metaphysische Regisseur einer weitreichenden Inszenierung, wie der Puck eines Sommernachtstraums. Dem Mythos des Ich, jenem Konzept, das ein Ideal als Realität unterstellt, das in der Wirklichkeit nicht existiert, das gleichwohl als Grundlage für ein ganzes Wissenschaftsgebäude und eine Gesellschaft herhalten muß, wäre ein Konzept gegenüberzustellen, das der Fähigkeit des Ich Rechnung trägt, sich gegen den Träger zu wenden.
Ins Extrem gesteigert ist die Lage desjenigen, der seinen Stolz auch um den Preis des Verdienstes wahrt, zu vergleichen mit der aus Action-Romanen bekannten Figur eines entkleideten und an einen Stuhl gefesselten Mannes, der dem Schurken, der ihm mit Tod und Folter droht, höhnisch ins Gesicht grinst oder ihn gar anspuckt. Der Held spitzt eine Situation noch freiwillig zu, um seine Verachtung für die Anmaßung des Schurken und dessen Stil auszudrücken. Stiere aus guter Zucht besitzen diesen Mut in hohem Maße. Sie akzeptieren die für sie veranstalteten Turniere und kämpfen aus einer immer schwächer werdenden Position heraus weiter bis in den Tod. Jeder kennt diesen Kult des beharrenden Mutes, der so genannten Kämpfernatur. Beim Publikum nährt er die märchenhafte Hoffnung, daß sich das Blatt noch wenden und er dennoch siegen könnte. Das Verteidigen der eigenen Integrität gewinnt seltsamerweise in Situationen, in denen es keine Zeugen gibt, noch an Bedeutung.
erschienen bei Matthes & Seitz
Abbildung: Marion Bataillard
Freitag, 8. Juli 2011