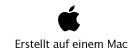der Antichrist
Händels Oper „Rinaldo“ geht auf die Dichtung „Gerusalemme Liberata“ von Torquato Tasso zurück. Goffredo, General des christlichen Heeres, hat dem Ritter Rinaldo die Hand seiner Tochter Almirena versprochen, als Lohn für einen Sieg gegen die feindlichen Sarazenen. Deren König Argante gelingt mit Hilfe der ihm ergebenen Zauberin Armida die Entführung der Braut. Durch die Entführung Almirenas wollen sie auch Rinaldo in ihre Gewalt bekommen und so die Schlacht für sich entscheiden. Die Befreiung des christlichen Liebespaares gelingt Goffredo mit Hilfe des Zauberers Mago. In der Zwischenzeit muß sich Almirena in der sarazenischen Gefangenschaft der Zudringlichkeiten Argantes erwehren. Ihre unglückliche Lage besingt sie mit der Arie Lascia ch´io pianga mia cruda sorte (Lass mich beweinen mein grausames Schicksal). Der Text zu Händels Sarabande von Giacomo Rossi lautet: Lascia ch’io pianga/ Mia cruda sorte,/ E che sospiri/ La libertà./ Il duolo infranga/ Queste ritorte/ De’ miei martiri/ Sol per pietà. Lars von Trier verwendete dieses Lied für den Prolog und Epilog seines Films „Der Antichrist“. Was er sich dabei gedacht haben mag, ist nicht einfach zu durchschauen. Vergegenwärtigen wir uns, was in diesem Prolog geschieht. Wir sehen, wie ein Mann und eine Frau sich leidenschaftlich dem Sex im Badezimmer hingeben. Während das Paar langsam zum Höhepunkt kommt, klettert der Sohn der beiden aus seinem Bett, Nick, der sie beim Sex beobachtet hatte, steigt aufs Fensterbrett und stürzt oder springt, zeitgleich mit dem Orgasmus, zu Tode. Sollen wir das namenlose Ehepaar aus Seattle mit Rinaldo und Almirena vergleichen? Oder geht es um die Zudringlichkeit Argantes? Oder steht der kleine Sohn für den Rinaldo im Tasso-Text? Der Film erzählt, wie die Frau und der Mann mit diesem Schicksalsschlag weiterzuleben versuchen. Der Tod des Sohnes reißt die Mutter in tiefe Trauer und Selbstvorwürfe. Sie versinkt in Depression und wird sie heimgesucht von Panikattacken. Aus Sorge, sie könnte sich etwas antun, beginnt ihr Mann, selbst Psychiater, gegen die Grundregel seines Berufsstandes, seine eigene Frau zu behandeln. Obwohl ihm klar ist, dass er selbst zu involviert ist, um ihr therapeutische Hilfe leisten zu können, glaubt er andererseits, sie nicht im Stich lassen zu dürfen. Als überzeugter Rationalist glaubt er fest daran, daß eine Konfrontationstherapie das Mittel der Wahl sei. Gefragt danach, wovor sie am meisten Angst habe, antwortet sie, vor der Natur. Also brechen sie auf, tief in den Wald, in eine Hütte, die den Namen «Eden» trägt, in der sie im Sommer zuvor mit ihrem Sohn weilte, um sich ihrer Dissertation über Hexenverfolgung zu widmen. Der perfekte Ort für seine Therapie, so glaubt der Mann. Wie in „Szenen einer Ehe“ von Bergmann sezieren sie ihre Situation mit verbaler Offenheit. Es kommt zu Spannungen zwischen den beiden, hervorgerufen durch den bedingungslosen Willen des Mannes, seine Frau zu heilen einerseits und der Verzweiflung der Frau andererseits, zwischen der Überzeugung des Mannes, sie auf den Boden der Realität zurückbringen zu müssen, und den Erklärungsmodellen der Frau. Sie wirft ihm seine distanzierte und rationale Art vor, die sie als Arroganz empfindet, und reagiert mit emotionalen Ausbrüchen und aggressivem Sex. Sie soll zunächst durch Desensibilisierungsübungen die Angst vor der Natur verlieren und sich wieder frei im Wald bewegen lernen. Die Natur um die Hütte zeigt sich allerdings zunehmend objektiv als bedrohlich. Nachts prasseln mit schrecklichem Lärm Eicheln unaufhörlich auf das Hüttendach, morgens sitzen blutsaugende Zecken auf der Hand des Mannes. Er begegnet im Wald einem Reh mit einer Totgeburt, sowie einem Fuchs, der sich selbst verschlingt. Mit der Zeit wandelt sich die Verfassung der Frau: Mit einem Mal legt sie ihre Furcht vor der Natur ab, wofür sie ihrem Mann dankbar ist, jedoch wird sie zunehmend gereizter und abweisender ihrem Mann gegenüber. Beim Durchstöbern der Hütte findet er auf dem Dachboden die unvollendete Doktorarbeit über Hexenverfolgungen und Frauenmorde, mit Darstellungen der Folter, Verstümmelung und Verbrennung von Frauen. Als der Mann die Frau auf seinen Fund anspricht, gesteht sie in wirren Worten, dass sie alle Frauen für von Grund auf böse halte. Durch einen an die Frau adressierten Brief, den er öffnete, erfährt er, dass seine Frau ihren verunglückten Sohn im letzten Sommer in Eden gezwungen hatte, die Schuhe seitenverkehrt zu tragen, womit sie seine Füße deformierte. Das Zerwürfnis der beiden gipfelt schließlich darin, dass sie ihn während eines Geschlechtsaktes niederschlägt und seine Hoden mit einem Holzblock zerschmettert, sodass er in Ohnmacht fällt. Als sie seine trotz Ohnmacht weiterhin vorhandene Erektion bemerkt, masturbiert sie ihn, bis er Blut ejakuliert. Sie bohrt ihm zudem eine Eisenstange mit einem daran befestigten Schleifrad in den Unterschenkel und wirft anschließend den hierfür verwendeten Schraubenschlüssel fort. Als der Mann aus seiner Ohnmacht erwacht und sie im Walöd weiß, versucht er unter entsetzlichen Schmerzen zu fliehen. Er versteckt sich vor seiner zurückkehrenden Frau in einem Fuchsbau, wo jedoch eine Krähe laut krächzend aus dem Boden kommt, die, nachdem er sie erschlagen hat, ein zweites Leben dazu nutzt, ihn zu verraten. Seine Frau entdeckt ihn und schlägt mit einem Spaten auf ihn ein. Später gräbt sie den Verschütteten reumütig und unter Schluchzen wieder aus und schleift ihn zurück in die Hütte. Dort fragt sie der Mann, ob sie ihn umbringen wolle. „Noch nicht“, entgegnet seine Frau, jedoch stünde das Erscheinen der „Drei Bettler“ bevor, was den Tod eines Menschen fordere. Schließlich schneidet sie sich mit einer Schere die Klitoris ab, nachdem ein letzter Verführungsversuch an der Entkräftung des Mannes gescheitert ist. Im Laufe der Nacht treffen die drei Bettler in der Hütte ein, zunächst das Reh, der Fuchs und schließlich die Krähe, deren Krächzen der Mann unter dem Bretterboden der Hütte erneut hört. Als er sie sucht, findet er unter den zerborstenen Dielen den Schraubenschlüssel. Er beginnt hektisch, die Mutter von der Stange in seinem Bein zu lösen. Währenddessen ergreift die Frau die Schere, sticht sie ihm in den Rücken und entwendet ihm den Schraubenschlüssel. Unter enormen Schmerzen reißt er sich das Eisen aus dem Bein und erwürgt danach seine Frau. Dann verbrennt er ihren Körper auf einem Scheiterhaufen vor der Hütte und flieht von dem Ort. Wer ist der Antichrist? Zunächst könnte man meinen, es sei die Frau, die, wie schon im mittelalterlichen Gynocid, das Böse im Menschen verkörpert, das es auszumärzen galt. Immerhin hat sie sich als Ergebnis ihrer unvollendeten Doktorarbeit über die mittelalterlichen Hexenverbrennungen in das Thema soweit verstrickt, dass sie sich selbst für eine Hexe hält. Als er ihr vorhält, die Geschichte des Gynocids falsch, nämlich positiv verstanden zu haben, wirft sie ihm im Gegenzug vor, immer distanziert gewesen zu sein und arrogant. Frauen würden ihren Körper nicht beherrschen, sie werden beherrscht, wenn sie Lust empfinden, wenn sie schwanger werden etc., sie seien Objekt ihrer Natur. Während der Film zunächst um die Figur der Frau und ihre Trauer kreist, gerät mit der Reise in den Wald die Natur mit ihrem ambivalenten Wesen in den Blickpunkt. Die feindselige, unwirkliche Seite der Natur wird besonders betont und mit dem Schicksal des Paars in Verbindung gebracht, etwa durch die Totgeburt des Rehs, oder durch ein Raubvogelküken, das aus dem Nest fällt und gleich darauf vom elterlichen Vogel gefressen wird. Die nachts auf die Hütte prasselnden Eicheln und die Worte des Fuchses − „Chaos regiert!“ − verstärken diesen Eindruck noch, daß sie Natur, wie die Frau sagt, „des Satans Kirche.“ sei. Auf dem Weg zur Hütte passieren sie einen verdorrten Baum, der an die in bäume verwandelte Selbstmörder bei Dante erinnert. Also die Natur als Antichrist? Das Böse liege in der Natur des Menschen, behaupten alte Theorien, denen zufolge übergroße Nähe zum Naturzustand den Menschen entarten und die Errungenschaften der Zivilisation vergessen läßt. Oder sind die Natur des Waldes und die menschliche Natur zweierlei, wie die Frau nahelegt? Es ist kaum anzunehmen, daß von Trier die trivialpsychologische Behauptung bedienen wollte, die sexuelle Enthemmung der Frau würde die männliche Furcht vor der Kraft weiblicher Sexualität wecken, die ihren extremsten Ausdruck in den neurotischen Hexenverfolgungen fand. Allerdings sind da die Anspielungen auf das personifizierte Böse, den Teufel, dessen Pferdefuß nicht in den Schuh passt, den Gainsbourg ihm anzieht. Im Laufe des Films wandelt sich das Verhältnis der Eheleute zueinander. Zunächst hat der Mann, dank seiner Autorität als Therapeut und vermöge seiner bedingungslosen Forderung an die Frau, sich ihrer Furcht zu stellen, eine dominante Position inne, so daß man die Ansicht vertreten könnte, er sei der Antichrist, weil er seine Frau mit fiesen, sadistischen Therapieansätzen quält. Wenn er beim Sex sadistische Züge zeigt, dann nur, weil sie darauf bestand, daß er sie schlagen möge. Als er sie schließlich erwürgt, hat man das Gefühl, die habe es darauf angelegt, und der Scheiterhaufen ist nur noch die symbolische Überhöhung dessen, was sie selbst ins Werk gesetzt hat. War das nun Mord oder Notwehr? Hat der Antichrist nun gewonnen, oder wurde er vertrieben? Im Laufe des Geschehens gewinnt dann zunächst zunehmend die Frau die Oberhand, vermöge immer brutalerer Gewaltakte, bis ihre Aggressivität im Kastrationsakt und der Fesselung des Mannes gipfelt und sie sich am Schluss sogar selbst verstümmelt. Die Gewalt gründet in der paranoide Züge annehmenden Furcht, der Mann könne ihr entgleiten und sie am Ende verlassen. Erst der verweigerte Sex, dann das Gewicht am Bein und die Kastration sollen ihm unmöglich machen, fortzugehen und eine andere zu nehmen, wie schon die vertauschten Schuhe und die deformierten Füße verhindern sollten, daß sich ihr Sohn eines Tages selbständig machen könnte. Doch diese Gewalt sollte dazu dienen, jegliche Gewalt von dem Kind fernzuhalten, indem sie es an ihre Fürsorge für es band. Daß es sich laufend fortbewegt und in den Tod stürzt, konnte sie dennoch nicht verhindern. Sie wirft sich vor, ihn nicht zurückgehalten zu haben. Sie wirft sich gewissermaßen vor, daß die Fußdeformation nicht konsequent genug gewesen war. Sie war an dem Dilemma „Strafen oder Sterben“ gescheitert. Wenn vielfach der Orgasmus als kleiner Tod bezeichnet wird, dann ist das hier wörtlich genommen. Lust und Tod sind untrennbar miteinander verbunden. Ist dann vielleicht das Kind, das durch seinen Fenstersturz eine intakte Ehe zerstört, der Antichrist? Immerhin hat es der Mutter unangemessen zugelächelt, kurz bevor es in den Tod sprang. Und hat das Kind nicht auch rätselhaft schiefe Füße, so wie der Teufel auch einen Pferdefuß hat? Oder ist, auch wenn Freud tot ist, wie die Frau sagt, damit der Schwellfuß des Ödipus gemeint? Damit kämen wir der Sache wohl näher. Immer wieder konnte man lesen, von Trier lebe mit Antichrist wie schon in seinen Filmen vorher, seine Misogynie, seinen Frauenhass aus. Es gilt als gesichert, dass er es liebt, Frauen zu quälen. Jeder seiner Filme sei eine Passionsgeschichte einer unbescholtenen Heldin, der das Schicksal, das Leben und die Welt auf besonders üble Weise mitspielen. Lars von Trier beteuert allerdings, wenn in seinen Filmen Frauen leiden müssen, heiße das doch nicht, dass es ihm gefalle, dass sie leiden, dass er sie leiden sehen wolle. Sie würden leiden müssen, weil die Männer in seinen Filmen so dumm seien. "Also bevor man sich bei mir über Frauenfeindlichkeit beschwert, müsste man sich eher über Männerfeindlichkeit beschweren." Er wolle niemanden quälen. "Außer Gott", der habe es verdient. Es handelt sich nicht um ein Gender-Thema. Der Teufel ist weder männlich noch weiblich, er ist weder in der äußeren noch in der inneren Natur. Er ist im Zwischenmenschlichen, in der Interaktion, in der Übertragung, in der Liebe. Die Liebe versetzt den Menschen in eine Regression auf dyadische Verhältnisse, wie sie das Kleinkind mit der Mutter eingeht, in das es hineingeboren wird und hineinwächst und aus dem es in der ödipalen Krise herauswachsen muß. Die Depression könnte sich als Name für das Begleitgeräusch eines Schieflaufens der dyadischen Regression in dem Übertragungsgeschehen der Liebe herausstellen. Wenn Lars von Trier durchblicken läßt, daß der Film Resultat seiner Arbeit an seiner eigenen Depression sei, dann war er dem womöglich auf der Spur. Diese Spurensuche geht nicht ohne kritische Auseinandersetzung mit der behaviouristischen Psychotherapie, die vom Patienten verlangt, wie einst die Hexen unter den Torturen der Inquisition seinem Irrglauben abzuschwören, die ihn nicht als Subjekt seines Wahns ernst nimmt, sondern zum Objekt der Wissenschaft und zur willenlosen Puppe eines Trainingsprogramms degradiert, die ihm nicht dazu verhilft, für das Rätsel, zu dem er sich selbst geworden ist, eine eigene Sprache zu finden, sondern ihn seines persönlichen Erlebens enteignet. Vom Standpunkt des Patienten aus ist der Therapeut der Teufel, der ihn vergewaltigt und der ihn, wie einst Judas den Jesus, verrät und dem Tod überantwortet. Die behaviouristische Methode geht nicht. Er fragt immer, wovor sie Angst habe, ohne zu begreifen, daß die Angst einfach da ist. In den biblischen Symbolen gab sich die namenlose Angst ein Gesicht, so daß sie sagen kann, jetzt wisse sie, daß diese Angst schon immer in ihr war, I didn’t know it was fear. Er glaubt selbst nicht wirklich an seine Methode. Als sie ihm stolz mitteilt, daß sie geheilt sei, zweifelt er mit Recht daran. Sie reagiert gereizt: Du gönnst mir nicht, glücklich und fröhlich zu sein. Bei Nachlassen der Verzagtheit registriert sie in sich den Willen, an der dyadischen, präödipalen Abhängigkeit festzuhalten. Es ist der unbewußte Wille, die Neurose in der Psychose ausbrechen zu lassen. Das Lied der Almirena bedeutet in dieser Perspektive, die Bitte um die Erlaubnis, allererst krank werden zu dürfen. Heilung hat als Vorbedingung die Erlaubnis, krank werden zu dürfen. Sie überträgt ihre Angst auf ihn, gibt ihr die Gestalt der Angst, von ihm verlassen zu werden, was sie mit aller Macht und um jeden Preis verhindern muß. Dies kann man nicht alleine. Zu diesem Krankwerden braucht man den anderen und muß man lieben, da man das Grauen nicht willentlich ansteuern kann. Man muß sich mit Hilfe des Liebens selbst überlisten. Sich auf einen Weg begeben, auf dem man sich verirren muß, auf dem einem etwas begegnet, das stärker ist als man selbst. Wer derjenige ist, den die Psychose ereilt, ist unwichtig. In diesem Film geraten ohnehin beide in eine Psychose. Unter der Hand entwickelt sich die psychiatrisch angelegte Therapie in eine Psychoanalyse, bei der das Reale gerade nicht Inbegriff des vernünftigen Realitätsprinzips ist, sondern das Unbegriffene, das Verworfene, das erst noch der Symbolisierung bedarf. Im Epilog sieht man den Mann in der Morgensonne mit einer Krücke den sommerlichen Hügel vor der Hütte hinauf wandern. Er trifft wieder auf die drei Tiere, die friedlich im Gras ruhen. Als er sich umwendet, sieht er, wie unzählige gesichtslose Frauen von allen Seiten des Hügels auf ihn zuströmen. Am Ende ist er der Erlöser all der gesichtslosen Frauen, die unter dem Waldmoos in der Hölle schmorten und nun ins Paradies wandern wie in den Visionen der mittelalterlichen Malerei. Von Trier selbst verwies als Referenz auf das Inferno in Dante Alighieris „Göttlicher Komödie“, in der der Protagonist durch einen finsteren Wald irrt. Dem Scheitelpunkt des Lebens war ich nahe,/ da mich ein dunkler Wald umfing und ich,/ verirrt, den rechten Weg nicht wieder fand./ Wie war der Wald so dicht und dornig,/ o weh, daß ich es nicht erzählen mag/ und die Erinnerung daran mich schreckt. / Viel bitterer kann selbst der Tod nicht sein. (1. Gesang. Hölle) Der Dichter erzählt seine eigene Reise durch die Reiche der Toten. Der Protagonist verirrte sich in einen tiefen Wald, weil er den rechten Weg verloren hatte. Als er dem Berg der Tugend entgegenstrebt, wird er von einem Panther (dem Sinnbild der Wollust), einem Löwen (dem Sinnbild des Hochmutes) und einer Wölfin (dem Sinnbild der Habgier) in ein finsteres Tal abgedrängt wird. Dort begegnet er dem von ihm verehrten römischen Dichter Vergil, den er auch sogleich um Hilfe bittet. Vergil entgegnet ihm: „Du musst auf einem andern Wege gehen […] wenn du aus dieser Wildnis willst entfliehen.“ Dante wird daraufhin von Vergil durch die Hölle und auf den Läuterungsberg begleitet. Wie man inzwischen weiß, schrieb Dante unter dem Einfluß der provencalischen Poesie, die wiederum von der Weltanschauung der Katharer beherrscht war, derzufolge das Böse in uns sei, nicht abteilbar, nicht vermeidbar. Das Gute sei unauflöslich mit dem Bösen verquickt. Gott und Teufel seien eins. Der Philosophie der Gnostik wie der Mystik eines Johann vom Kreuz zufolge müsse man, um zur Heilung zu gelangen, durch das Böse hindurch. Erst wenn man den tiefsten Punkt erreicht und alle Fehler begangen habe, öffne sich der Ausgang. Der Regisseur zog auch Parallelen zu August Strindbergs Krise, die er selbst Inferno nannte. Von Triers Film bezieht sich auch auf die Filmgeschichte selbst. Ähnlich verstörend wirkte der Sex nur in Oshimas Skandalfilm „Im Reich der Sinne“. Die Genitalverstümmelung sind so schwer erträglich wie die Szene in Bunuels „Der andalusische Hund“, in der in Großaufnahme ein Auge zerschnitten wird. Der Film ist Andrej Tarkowski gewidmet. Die Hütte im Wald erinnert tatsächlich stark an Szenen in „Der Spiegel“ oder in „Das Opfer“ (Nostalghia). An Der Spiegel erinnern auch die Reminiszenzen an Werke großer Maler wie Leonardo da Vinci oder Pieter Brueghel, ebenso die in die Handlung eingeflochtenen Textzitate von Dante und Dostojewskij sowie die dort verwendete Musik Giovanni Battista Pergolesis und Johann Sebastian Bachs. Es ist nicht ohne Ironie, daß Triers Film bei der Kritik auf ebensolches Unverständnis stößt wie einst Tarkowskijs Filme bei der sowjetischen Filmbehörde Goskino, die den Film als schwer verständlich und mystizistisch, als „undurchdringliches Bilderrätsel“ und „freudinaische Nabelschau“ kritisierte.
Samstag, 24. September 2011