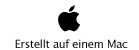Denk-Patt
Zwischen zwei Tatsachen besteht ein moralisches Denk-Patt. Einerseits hat das Spardiktat Griechenland Bevölkerung in die Armut und die Wirtschaft an den Rand des Kollaps gebracht. andererseits wollen die anderen Euroländer Griechenland nicht mehr unterstützen, wenn die Sparpolitik nicht weitergeführt wird. Noch mehr Schulden zu machen, wäre finanziell nicht möglich und würde „die Märkte“ veranlassen, gegen den Euro zu wetten. Einerseits sollen die Griechen demokratisch abstimmen, andererseits gibt es zum Sparprogramm keine Alternative. Den Linken wird deshalb vorgeworfen, das Land unregierbar zu machen und in den Ruin zu führen und die Eurozone insgesamt gleich mit. In diesem Patt zeigt sich die Grenze dessen, was Politiker und Journalisten zu denken vermögen. Zwei richtige Feststellungen schließen einander aus. Was tun? Gibt es eine Ritze zwischen den beiden moralischen Tatsachen? Man sollte mal versuchen zu denken, daß in Griechenland eine Variante dessen geschieht, was vorher und gleichzeitig in Chile, Argentinien, Großbritannien, in den USA, in Spanien, in Irland geschehen ist, nämlich eine Umformung von Wirtschaft und Gesellschaft nach neoliberalem Modell zum Zwecke der Profitsteigerung auf den Finanzmärkten auf Kosten der mittelständischen Realwirtschaft mit der Umwandlung der Bereiche Bildung, Gesundheit, Altersvorsorge, Infrastruktur in privatwirtschaftliche Unternehmen und Aktiengesellschaften. Bestimmte Kreise daran verdient haben, Euros in das Land hineinzupumpen, die man sich so gut wie zinsfrei hatte leihen können, und zu guten Zinsen verleihen konnte. Die Euroschwemme hat die heimische Wirtschaft zerstört und Geld in die Taschen von Spekulanten und Politiker gespült, das sie dann außer Landes gebracht haben. Die Banken haben inzwischen ihre in Gefahr der Nichtzurückzahlbarkeit geratnen Kredite verkauft an die europäischen Staatsbanken und haben nun begonnen, in Hedgefonds gegen den Euro und die Staatsanleihen südlicher Euroländer zu wetten. Um die Stabilität Griechenlands und Europas zu wahren, werden Spardiktate beschlossen, die die Armen und den Mittelstand treffen und aushungern und Steuergelder in Form von Rettungsschirmen und Bürgschaften bereitgestellt, so daß in großem Maßstab Geld von unten nach oben gepumpt wird. Den Armen wird genommen, damit den Reichen gegeben werden kann.
In einem Dossier des Deutschlandfunks (dradio.de) wurden unter dem Titel „Ein ökonomischer Putsch“ die Hintergründe ausgeleuchtet (in leicht geraffter Form): Joseph Stieglitz, Professor für Ökonomie an der Columbia University und Nobelpreisträger, jahrelang Chefökonom der neoliberal beeinflußten Weltbank, behauptet, daß die ISDA, die International Swaps and Derivatives Association, 1985 gegründeter Zusammenschluß der weltgrößten Banken und Spekulationshäuser, der zusammen 834 Firmen aus 57 Ländern umfaßt, angeführt als Direktor von Stephen O’Connor von der Morgan Stanley Bank und dessen Stellvertreter Michele Faissola, Vertreter der Deutschen Bank, daß ebendieses Gremium der vermeintlich unabhängigen Staatsbanken die Welt beherrscht und in ihren Untergang treibt. Stieglitz behauptet, daß dieses Gremium direkt die Finanzpolitik der vermeintlich unabhängigen Zentralbanken der Welt bestimme und damit die Politik der Regierungen. Es sei ein Gremium der Gewinner, die sich den Kuchen der öffentlichen Subventionen aufteilten. Das gemeinsame Interesse der Mitglieder ist das ungehinderte Agieren an den Börsen.
Ein ökonomischer Putsch ist wie ein militärischer eine Umkehrung der demokratischen Machtverhältnisse. Die Akteure aus Wirtschaft und Finanzwelt benötigen keine Militärs, um ihre Politik durchzusetzen. Mit abgesprochenen, gezielten Spekulationsattacken auf ganze Volkswirtschaften und auf Währungen wie den Euro können sie heute Regierungen zu Fall bringen und Demokratien aushebeln. Das kriminelle System der Banken braucht heute keine Polizeispezialeinheiten mehr, um unbotsame Politiker zu entmachten, wie damals in Chile. Papandreou, Zapatero oder Berlusconi werden heute lautlos abgeschoben. Es handle sich nicht um einzelne verbrecherische Handlungsweisen, das System ist wertezerstörend und nicht werteschaffend und gehorcht insgesamt dem Modell organisierten Verbrechens. Chile war nur der etwas laute Auftakt einer Entwicklung, die sich in England der Maggie Thatcher, in den USA unter Clinton und in Deutschland unter Schröder fortsetzte. Nach der Ermordung Allendes ging es in Argentinien darum zu beweisen, daß dass dieses Model auch mit einer formalen Demokratisierung einhergehen kann, dass es auch unter diesen Bedingungen umsetzbar scheint und deswegen als Modell auch für sogenannte Dritte-Welt-Länder oder Schuldnerländer möglich ist, wenn man eben nicht eine Militärregierung mit allen Mitteln an der Macht halten will, sondern daß auch demokratische, gewählte Regierungen in der Lage sind, solche neoliberalen Konzepte umzusetzen. Staat und Gesellschaft wurden vollständig umgebaut. Gesetze, staatliche Eingriffsmöglichkeiten und Staatsbesitz, die das Funktionieren der sogenannten freien Märkte störten, mußten verschwinden. In Argentinien wurde ausprobiert, was ab den 80er Jahren in aller Welt Verbreitung fand: die Privatisierung lukrativer Staatsunternehmen, der Abbau fast aller Gesetzesauflagen für die Privatwirtschaft, eine Senkung der Steuern für Großverdiener und eine rigide Sparpolitik, sprich: ein Abbau des Sozialstaats. Zugleich wurden die tariflichen Arbeiterrechte abgeschafft: Flexibilisierung nennen das die neoliberalen Theoretiker und produzieren Millionen Arbeitslose. Die Unternehmer verlangen jedoch nicht nur Steuererleichterungen, sondern Zuwendungen der öffentlichen Hand, sogenannte Subventionen. So begann in den 70er Jahren in Argentinien, wie in aller Welt, eine enorme Umverteilung von unten nach oben und die Verschuldungsspirale, die heute auch in Europa eskaliert, weil der Staat Kredite aufnehmen musste, um die neuen Ausgaben zu decken.
Argentinien sollte zeigen, wie man den politischen Widerstand der Zivilgesellschaft brechen oder verwirren kann. Die erste Durchsetzung der neoliberalen Politik während der Militärdiktatur in Argentinien hat über 30.000 Menschen das Leben gekostet. Nicht irgendwelchen 30.000 Gegnern der Regierungspolitik: Arbeiter, Künstler, Studenten und Wissenschaftler, allesamt „linke subversive“ Elemente. Unter den demokratischen Präsidenten mußten die Kräfte der Zivilgesellschaft betrügbar gemacht werden. Es galt zu testen, wieweit man mit der Privilegierung der Reichen und der Belastung der Armen durch rigide Sparpolitik gehen kann. unter den demokratisch gewählten Präsidenten rutschten zwei Drittel der Bevölkerung Argentiniens in die Verarmung, zogen von Eigenheimen oder Mietwohnungen in Slums, verloren Festanstellungen und verdingten sich fortan als Zeitarbeiter oder Straßenverkäufer. In der deutschen Medienöffentlichkeit gilt der Neoliberalismus auf dem Rückzug, als gescheitert und überlebt. Das ist eine Täuschung. denn auch heute werden die immergleichen Rezepte, die die Krise mit verursacht haben, als deren Lösung verkündet: Abbau von Sozialsystemen, Einsparungen bei Bildung, Kultur und Gesundheit, Umwandlung geschützter Arbeitsverhältnisse in ungeschützte. Das verlange die Wirtschaft, verkünden die Politiker, es gäbe keine Alternative. Das neoliberale System überlebt und gedeiht umso besser, je überzeugender es angeblich sein Scheitern beweist. Das Wichtigste ist, dass man diese Art von Politik als alternativlos darstellen und verkaufen muss. Und das kann man am besten tun, indem politische Akteure verschiedener Couleur nacheinander an die Macht kommen und letztendlich aber mehr oder weniger (lacht) das gleiche Konzept verfolgen müssen, vielleicht auch wenn sie vorher etwas anderes gesagt haben, und somit also dann eine Entmutigung der zivilgesellschaftlichen Kräfte stattfindet. Dass es als alternativlos erscheint: „wir können ja wählen, wen wir wollen, letztendlich kommen dieselben Maßnahmen heraus“. Foucault sprach im Zusammenhang mit der neoliberalen Machtergreifung, der frei entfesselten, keinen Regeln obliegenden Wirtschaft, die Politik und Gesellschaft nach ihren Vorstellungen formt und dem Dominantwerden des ökonomichen Denkens von der Regierung der Angst. Er zeigte, dass der Neoliberalismus ein Herrschaftsmodell ist, das alle Institutionen der Politik und Gesellschaft umformt. Die unhinterfragten Grundannahmen der neoliberalen Theoretiker sind dabei eine Undurchschaubarkeit der Wirtschaft, ein Verbot, das Gemeinwohl anzustreben, und die Annahme einer grundlegenden Ungleichheit zwischen den Menschen, die nicht beseitigt, sondern verstärkt werden müsse, damit das System des freien Wettbewerbs funktioniere. Denn der Neoliberalismus ist ein Spiel zwischen Ungleichheiten, bei dem wenige gewinnen und die meisten verlieren. Die Einsicht, die Foucault uns mitzuteilen hat, ist die, dass der Neoliberalismus nicht nur eine bestimmte ökonomische Doktrin oder Ideologie darstellt, sondern daß er als eine bestimmte Rationalität zu begreifen, als eine bestimmte Logik des Politischen und der Art und Weise, wie eine Gesellschaft eingerichtet sein soll. Der Neoliberalismus produziert eine Wahrheit, eine gesellschaftliche Wahrheit, bestimmte kulturelle Selbstverständlichkeiten. Er bereitet einen geistigen Horizont vor, von dem es fast unmöglich ist, sich zu lösen. Der Neoliberalismus ist nicht einfach ein Denksystem, das nur einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit betrifft oder die bestehende Wirklichkeit verkehrt darstellt, sondern er schafft Wirklichkeit, er schafft einen Totalitarismus. Er ist das, was heute die Wirklichkeit erschafft, in der wir leben. Foucault spricht vom „deutschen Modell“, weil der Neoliberalismus der 70er Jahre, die Chicagoer Schule mit Friedman und Co auf die Ordoliberalen der Freiburger Schule um Walter Eucken und Friedrich Hayek zurückgeht, die zu den Beratern des ersten Wirtschaftsministers der Nachkriegszeit Ludwig Erhard zählten. Mit der Neugestaltung der „sozialen Marktwirtschaft“ geschah nicht nur eine grundlegende Umwandlung der Wirtschaft, sondern des Denkens und Wahrnehmens allgemein. Profitgedanken und Konsumverhalten sollen das alleinige und bestimmende Modell in allen Lebensbereichen werden. Soziale Marktwirtschaft soll nicht die antisozialen Tendenzen des Wettbewerbs aufheben, sondern das was dem Wettbewerb entgegensteht, beseitigen. Michel Foucault zeigte in seiner Vorlesung, daß entgegen dem verbreiteten Irrglauben, der Neoliberalismus sei vor allem gegen den Staat, daß der Staat Hauptakteur bei der Umgestaltung der sozialen Wirklichkeit ist. Die Frage ist nicht, ob der Staat eingreifen darf, sondern wie er eingreifen soll. Staatliche Intervention und Bürokratie im Dienste der Wirtschaft sollen sicherstellen, daß Individuen und Gesellschaft sich so bilden, wie die Neoliberalen es verlangen. Die Freiheit des Marktes macht somit eine aktive und äußerst wachsame Politik notwendig. „ ich glaube, wir können in diesem permanenten Eingreifen des Staates das Spezifische des Neoliberalismus erkennen: Die Regierung soll so auf die Gesellschaft einwirken, dass der Markt die Gesellschaft regelt, so dass also die Wettbewerbsmechanismen in jedem Augenblick und an jedem Punkt das soziale Dickicht regeln. Wie Sie sehen, handelt es sich also darum, ein soziales Gebilde herzustellen, in dem die Individuen die Form eines Unternehmens haben.“ Es geht darum, unternehmerisches Handeln auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu etablieren. Eine solche Marktwirtschaft kann überhaupt nur funktionieren, wenn die Einzelnen selber unternehmerisch handeln wollen, ein bestimmtes unternehmerisches Ethos verinnerlichen. Das Leben des Individuums soll sich einfügen können in eine Fülle verschachtelter und miteinander verschränkter Unternehmen. Diese Umformen der Gesellschaft nach dem Modell des Unternehmens und zwar bis in die kleinste Einzelheit, ist ein Aspekt der Gesellschaftspolitik schon der deutschen Ordoliberalen. Es handelt sich darum, das ökonomische Modell im großen Maßstab anzuwenden, das Modell von Angebot und Nachfrage, von Investition-Kosten-Gewinn, um daraus ein Modell für die sozialen Beziehungen zu machen, ein Modell der Existenz des Individuums selbst. So ergreift die Wirtschaft nicht nur von Politik und Gesellschaft Besitz, sondern von den Individuen selbst, formt unser Innerstes und unsere Werte nach dem Modell von Investition-Kosten-Gewinn in der freien Konkurrenz der Ungleichheiten. Das versteht der Neoliberalismus unter Freiheit. Freiheiten an anderen Punkten müssen darum beschnitten werden. Deswegen benötigt der Neoliberalismus den Staat, um dieser rein wirtschaftlichen Freiheit als alleiniger zur Durchsetzung zu verhelfen, notfalls mit Gewalt. Die Individuen müssen, wenn es sein muß, wenn sie nämlich selber nicht in der Lage sind zu erkennen, was für sie gut ist, mit Zwang und Gewalt auf den Pfad der Freiheit gebracht werden. Erst so können sie als Autoren ihres eigenen Lebensschicksals erscheinen, ihres eigenen Glückes Schmied werden. Diese Form der Freiheit ist gekoppelt ist an die permanente Anreizung und die Produktion von Angst. Die neoliberale Gesellschaft lebt davon, daß sie einen permanenten Angstzustand erzeugt, indem das Erreichte prekär bleibt, immer wieder zur Disposition gestellt wird. Die Individuen werden fortwährend in Gefahrensituationen gebracht und darauf konditioniert, ihr Leben, ihre Gegenwart und ihre Zukunft als gefährdet zu empfinden. Die Devise des Liberalismus lautet mit Nietzsche: «lebt gefährlich!“ Dank der neoliberale Machtergreifung seit den 80er Jahren gehorchen heute fast alle Lebensbereiche den Regeln des freien Wettbewerbs und jeder ist in diesem Spiel seines eigenen Glückes Schmied, trägt privat die Risiken. Wappnet er sich nicht genügend gegen die Unwägbarkeiten des Lebens, ist er selbst schuld an
seinem Untergang. Das Ökonomische ist kein eng umgrenzter Bereich mehr, hat mit dem, was wir klassischerweise die Ökonomie verbinden, nichts mehr zu tun, sondern es hat alle Lebensbereiche ergriffen. Es reicht von der Wahl des Ehepartners über die Entscheidung, Kinderwünsche zu realisieren oder nicht, bis hin zur Frage, welche Bildungs- oder Ausbildungseinrichtungen werden gewählt, wo man wohnt, wie man sich kleidet, bei allem handelt es sich im neoliberalen Sinne um Investitionsentscheidungen, die im Hinblick auf einen möglichen Gewinn getroffen werden müssen. Die moralische Seite des Neoliberalismus besteht darin, daß die Einzelnen dann natürlich auch ganz allein selber schuld sind, wenn bestimmte Lebenspläne sich nicht erfüllen, bestimmte Investitionsentscheidungen sich nicht gelohnt haben. Ronald Reagan in den USA, Margaret Thatcher in Großbritannien und Helmut Kohl in der Bundesrepublik haben mit ihrer antisozialen Politik nachhaltig die Gesellschaften verändert und Hunger und Armut verursacht, nicht nur in der Dritten Welt. Ihre sozialdemokratischen Nachfolger Tony Bliar und Gerhard Schröder haben das Modell weiter vertieft durch die Liberalisierung des Arbeitsmarktes zugunsten von Leiharbeit, Zeitarbeit, Minijobs ohne Mindestlöhne und Lockerung des Kündigungsschutzes, und durch Deregulierung der Finanzmärkte. Auf diesem können nun Hunderttausende erfundener Hybrid-Produkte gehandelt werden, swaps, futures und allerlei Derivate, die mit der Realwirtschaft nichts mehr zu tun haben.
Für den Münchner Professor für Wirtschaftsstrafrecht Bernd Schünemann, der die Finanzkrisen seit vielen Jahrzehnten verfolgt, ist das Gebaren der Bänker und Spekulanten Symptom organisierter Kriminalität. „Das äußere Erscheinungsbild ist typisch maffiös. Also ich gründe ausländische Briefkastengesellschaften und sogar als deutsche Landesbank gründe ich ausländische Briefkastengesellschaften, um die Sache quasi aus der
Bankenkontrolle herauszuholen, um die Eigenkapitalgarantien zu unterlaufen. Das sind an sich ja also klassische Fälle von organisierter Wirtschaftskriminalität. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das sich niemand bewußt gemacht hat. Oder, das wäre auch ein interessantes Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungen, wenn herauskäme, daß tatsächlich die Finanzwelt aus einer Schar völlig unverantwortlicher im höheren Sinne gar nicht mehr zurechnungsfähiger Menschen besteht. Also dann wüßten wir, daß der Finanzmarkt, eine Ansammlung von moralisch Irren ist. Dann wüßten wir auch, wem wir uns ausgeliefert haben.“
Es handle sich übrigens bei den Bankrn übrigens nicht um einen Wille zu politischer Macht. „Denn nach wie vor ist bei der größten Zahl der Beteiligten Verachtung für Politik. Die Politiker, das sind so die zweitrangigen Leute, die eigentlich nichts Besseres geworden sind ... Politische Macht ist einfach das Abfallprodukt der eigenen Bedeutung. Die weltweit vernetzten Finanzakteure bestimmen mittlerweile so direkt die Politik, daß sie der Allgemeinheit die enormen Kosten ihrer Risiken und Skrupellosigkeit aufbürden können, unvorstellbare Milliardensummen. Nach der Bankenrettung ist vor der Bankenrettung, und vor allem, so zeigt die permanent gewordene Krise in Europa, kein Anlass zum Umdenken, sondern zur Verschärfung des neoliberalen Modells: Privatisierungen, Entlassungen, Sozialabbau...“
Für das, was bei einem Austritt Griechenlands aus der Eurozone geschehen könnte, gibt es ein Vorbild, den Staatsbankrott Argentiniens 2001. Die Bevölkerung hatte genug von den neoliberalen Experimenten, die ihr seit knapp dreißig Jahren zugemutet werden. Zu Hunderttausenden belagern Hausfrauen und Familienväter der ehemaligen und nun verarmten Mittelschicht den Regierungspalast, demolieren nicht nur ihre Kochtöpfe, sondern Bankautomaten, liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei. Sie haben genug gespart für die multinationalen Konzerne und die Banken und sie haben die Nase voll von den Politikern aller Couleur, die entgegen ihren Wahlversprechen doch nur die immergleichen Maßnahmen durchsetzen: „Que se vayan todos“ lautet ihr Schlachtruf, „Haut alle ab“. 39 Bürger verloren ihr Leben.
Am 20. Dezember 2001 ließ sich der argentinische Staatspräsident Fernando De la Rúa per Helikopter aus dem Regierungspalast evakuieren. Der Jubel der Bevölkerung war riesengroß. Drei Tage später erklärte Argentinien seine Zahlungsunfähigkeit. Der Internationale Währungsfond IWF unter dem damaligen Chef Horst Köhler bot Argentinien technische Hilfe an, wie heute Griechenland, Portugal oder Italien. Seine Experten empfahlen, im Sinne der Neoliberalen, Entlassungen, Sozialabbau und Rentenkürzungen, um die Schulden zu bezahlen, genau wie heute gegenüber Griechenland. Die Bevölkerung blieb auf den Straßen, ließ sich von alten Gesichtern in neuem Outfit nicht blenden und jagte nach De la Rúa vier weitere Übergangspräsidenten aus dem Amt, die eine neoliberale Politik verfolgen wollten. Die Weltbank drohte: Argentinien werde verschwinden. Private Gläubiger überzogen den argentinischen Staat weltweit mit Klagen. Militärausrüstungen des in anderen Ländern stationierten Militärs, Schiffe der Marine, das Präsidentenflugzeug, Botschaftseigentum usw. wurden gepfändet. Argentinien hat dann ein Moratorium erwirkt und hat die Gläubiger lange hingehalten und ganz ungeniert sehr harte Verhandlungen geführt. Siebzehn Monate nach den Protesten vom Dezember 2001 kam der neu gewählte Präsident Nestor Kirchner an die Macht und leitete eine Abkehr von der neoliberalen Politik ein, mit Staatsinvestitionen und einer Steigerung der Sozialausgaben, um die immense Armut aufzufangen und die Produktivität anzukurbeln. Die Bevölkerung blieb zunächst skeptisch und vertraute den neuen Politikern erst, als ein wirklicher Umschwung einsetzte. Den internationalen Großbanken und dem IWF verkündete Kirchner, das Land werde die Schulden nicht bezahlen, das Geld werde für Investitionen gebraucht, und bot den Banken einen Schuldenschnitt von 75 %. Mehr als zwei Jahre zierten sich die Banken und akzeptierten schließlich im Januar 2005, 50 % der Schulden des Landes zu streichen. Der Preis, den die argentinische Bevölkerung bezahlt hat war hoch. Die offizielle Arbeitslosigkeit lag bei fast 30 %, aber über 60 % rutschten unter die Armutsgrenze. Allein tausende Neugeborene starben in diesen Jahren an Unterernährung in den ersten Lebenswochen. Die Bevölkerung baute in Eigeninitiative Selbstversorgungseinrichtungen auf, die den fehlenden Sozialstaat ersetzten. Doch nach und nach wurden neue Arbeitsplätze geschaffen, Kirchner verstaatlichte zuvor privatisierte Unternehmen, etwa der Erdölbranche, und baute den Sozialstaat wieder auf, den die Neoliberalen abgebaut hatten. Vor allem leitete Kirchner durch die Abkehr vom Neoliberalismus aber eine geistige und kulturelle Wiederbelebung des Landes ein. Kein Politiker seit Juan Perón war in Argentinien je so beliebt wie Nestor Kirchner und seine Frau Cristina Fernández, die nach dem plötzlichen Tod des Staatschefs die Amtgeschäfte übernahm, und im Oktober 2011 mit 55 % der Wählerstimmen wieder gewählt wurde. Niemand hätte sich vorgestellt, dass das Land derart boomen und sich aus eigenen Kräften neu schaffen würde. Nach dem Verlust von ungefähr 20 % des Bruttosozialprodukts ist die Wirtschaft nach dem Moratorium ziemlich schnell wieder angesprungen. Die Entschuldung und die Abwertung des Wechselkurses waren entscheidende Faktoren dafür, daß Argentinien in den Folgejahren bis heute fast durchgehend Wachstumsraten von 6 bis 8 bis 9 Prozent hatte, was weit auch über dem Durchschnitt der Region liegt.
Argentinien hatte die Hilfe der IWF-Experten ausgeschlagen und hat mittlerweile seine Restschulden bezahlt. Argentinien sei, so die Regierungschefin, ausgestiegen, aus der Verschuldungsspirale, an der allein die Banken verdienen. Statt dem Diktat der neoliberalen Finanzinstitutionen zu folgen, tritt die Präsidentin Cristina Fernández heute in den internationalen Wirtschaftsgremien selbstbewusst auf, wie beim G-20-Gipfel in Cannes, im November 2011, der von den Drohungen der EU gegen Papandreous Volksabstimmung überschattet wurde, wo Fernández vor der versammelten Finanz- und Wirtschaftswelt forderte, dem neoliberalen Ausverkauf und den systemgefährdenden Spekulanten endlich ein Ende zu setzen und zurückzukehren zu einem seriösen Kapitalismus. „Meine Regierung hält die Nicht-Regulierung der Weltfinanzmärkte für das eigentliche Problem. Wollen wir weiterhin die Broker finanzieren, die Finanzderivate erzeugen, oder finanzieren wir diejenigen, die Nahrungsmittel, Waren und Dienstleistungen herstellen. Bereits beim Londoner Gipfel habe ich gesagt, wir müssen die Finanzmärkte zwingen, ihre Ressourcen der Realwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Denn ohne Konsum, gibt es keinen Kapitalismus. Ich schlage vor, zu einem wirklichen Kapitalismus zurückzukehren, denn das hier ist kein Kapitalismus, es ist die totale Anarchie des Finanzkapitals, bei der niemand niemanden kontrolliert. Wir müssen die Finanzwelt regulieren und einen wirklichen Wandel vollziehen.“
Auch Braslien wehrt sich gegen die Interventionen des internationalen Finanzkapitals. Ein großer Teil der aufgeblähten liquiden Geldmasse schwemmt in das Land, weil dort ungewöhnlich hohe Zinsen locken. Die brasilanische Präsidentin Dilma Roussef beschuldigte die Investoren, zu extrem niedrigen Zinsen Mittel aufzunehmen, um das Geld dann schnell nach Brasilien zu schaffen und zu lukrativen Zinsen anzulegen. Das sorge für wachsende Armut und gehe einher mit ungerechten Sparmaßnahmen. Sie sprach von einem Geld-Tsunami, der auf ihr Land zurolle, und betonte, Brasilien wolle nicht mehr als Bestimmungsland für spekulatives Kapital oder als Absatzmarkt für waren, die diese Länder produzieren, zur Verfügung stehen. „Wir brauchen das Geld der reichen Staaten nicht mehr“. Das hat Griechenland damals versäumt, weil an der Regierung und im Parlament korrupte Politiker saßen, die sich von Großbankchefs haben „beraten“ und die Zahlen frisieren lassen.
In Deutschland besitzen heute 1 Million Millionäre 2,2 Billionen € Privatvermögen. Die Gesamtverschuldung von Bund, Ländern und Kommunen beträgt 2 Billionen. In anderen europäischen Ländern ist das Verhältnis ähnlich. Dies ist das Resultat von Umverteilungen nach der Deregulierung der Finanzmärkte und einem eineinhalb Jahrzehnte dauernden Steuersenkungswettlauf und Sozialstaatsabbau. Durch europäische Finanzhilfen und Rettungsschirme wurden die Verluste der Finanzbranche und der Anleger kleiner und die der Steuerzahler größer. „Jeder Monat, um den die Hilfspakete den Staatsbankrott Griechenlands aufgeschoben haben, hat sich für die Banken, Hedgefonds und Spekulanten ausgezahlt.“ Die Milliarden, von denen man sagen wird, sie seien verbrannt, sind nicht verbrannt, „sie haben nur den Besitzer gewechselt. Was früher dem Staat gehörte, gehört nun den Aktionären und Anlegern.“ So Sarah Wagenknecht. Dann wird immer gesagt, der Sozialstaat ließe sich nicht mehr finanzieren, Sparmaßnahmen seien alternativlos. Der einzige über Gebühr gewachsene Posten aber war der zur Rettung der Banken und „der maroden Finanzindustrie“. Dies geschah, als der Sozialstaat bereits abgerissen wurde. „Dem Mißstand, daß Banken nicht wirtschaften können und wollen, wird durch Renteneinsparungen und Verkürzung der Sozialleistungen und der Etats für Bildung und Gesundheit nicht abzuhelfen sein“. Freie und unregulierte Märkte machen Starke noch stärker und Schwache noch schwächer. Private Banken verdienen an der Zinsdifferenz zwischen Notenbankenkrediten und Staatsanleihen. Stattdessen müßten, so die Linke, Notenbanken Staaten direkt zu niedrigen Zinsen Geld leihen. Dafür wurden sie eigentlich einst erfunden.
(Siehe: Der Ökonomische Putsch, Dossier im Deutschlandfunk 20.4.2012; Sarah Wagenknecht in FAZ 28.4.12)
Mittwoch, 16. Mai 2012